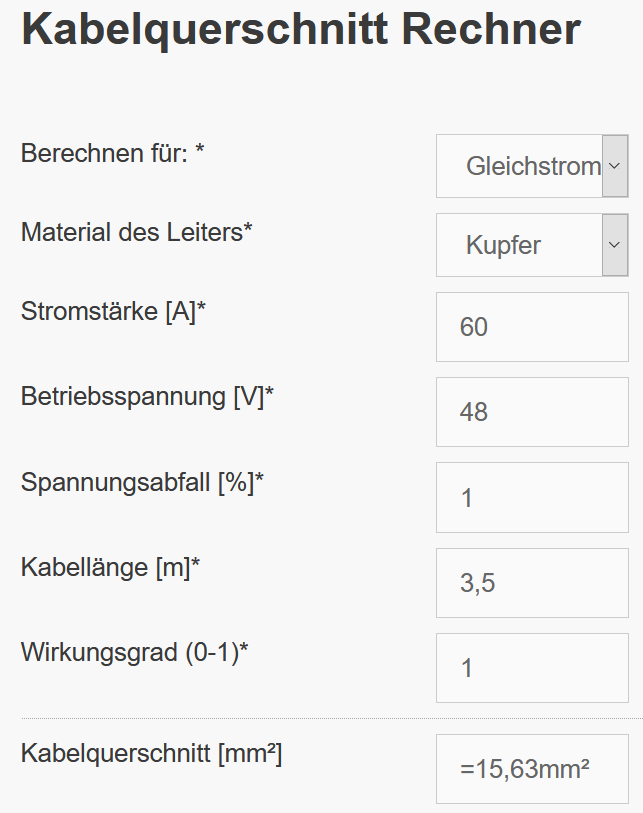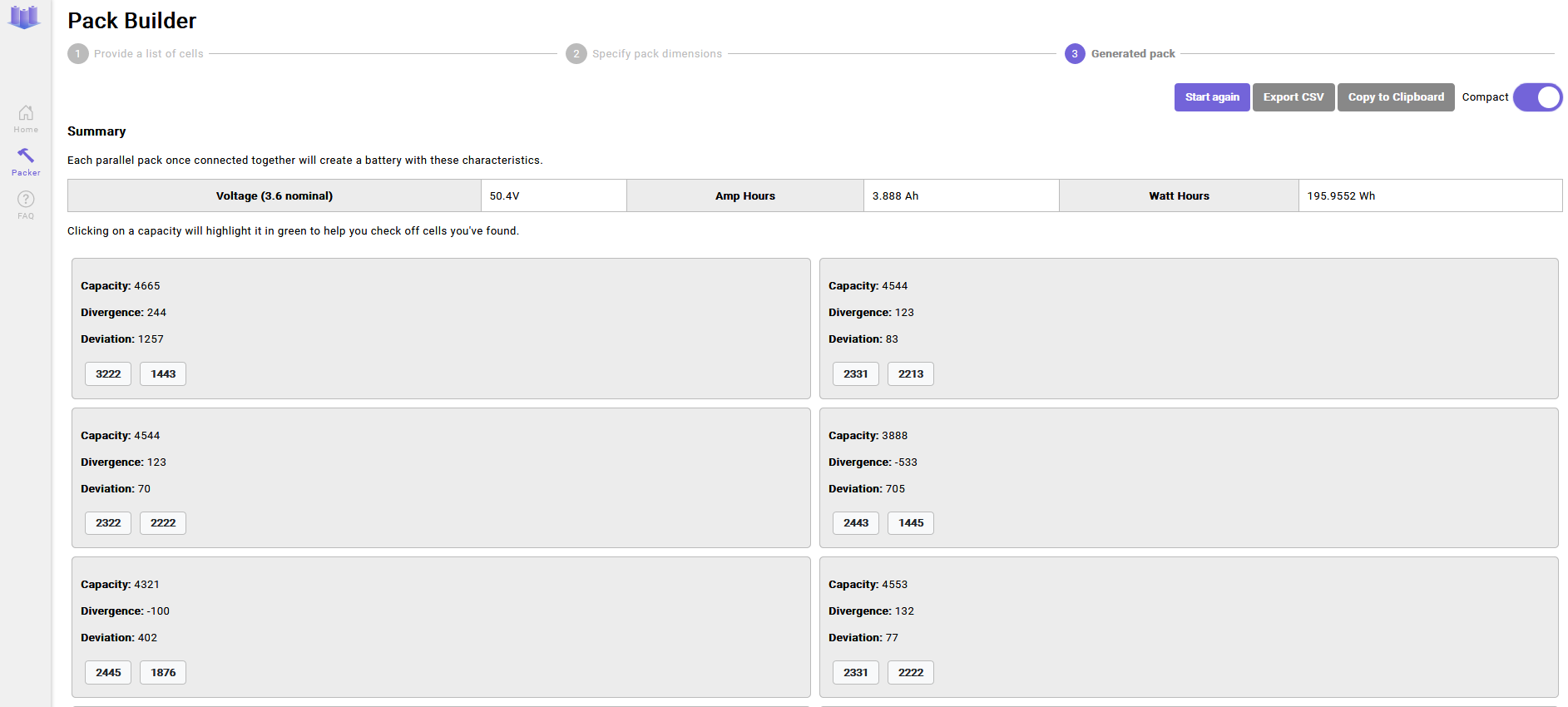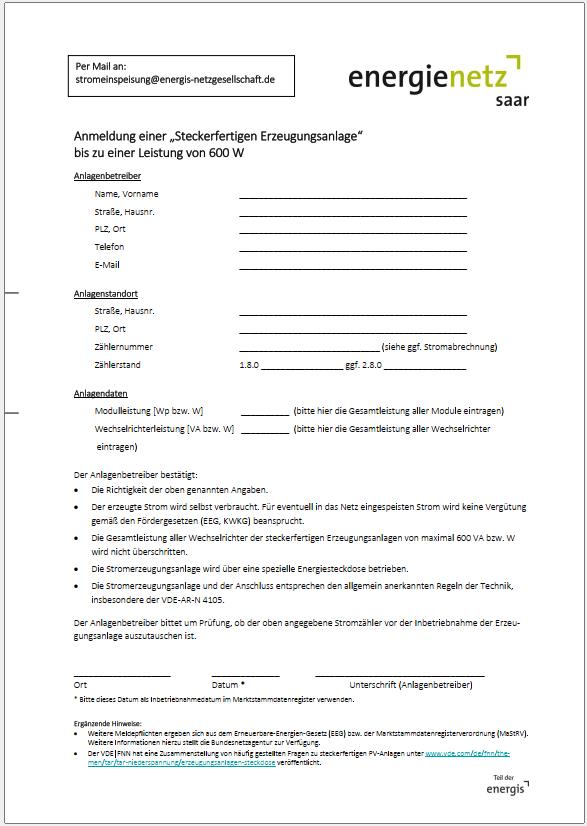Mittlerweile (Stand 2021) haben wir 75 KWh an effektiv nutzbarer Speicherkapazität aus insgesamt 10.800 recycelten Akkuzellen, die wir rein aus gebrauchten und defekten Laptop- & eBikeakkus gewonnen haben.
Wie, das kannst Du hier mit verfolgen.
Viel Spaß 😀
Inhaltsverzeichnis:
- 1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)
- 2 Idee + Plan
- 3 Akku-Arbeitsplatz
- 4 eBike Akku Komponenten
- 5 eBike Akku zerlegen
- 6 Laptop Akkus zerlegen
- 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte
- 8 neue Hülle für 18650
- 9 China-Akkutest
- 10 Werkzeuge + Messgeräte
- 11 Null-Watt Einspeisung
- 12 Modbus / RS485 Adapter
- 13 BMS + Balancer
- 14 aktiv Balancer BMS - JKBMS
- 15 Ladegeräte + Kapazitätstester
- 16 kpl. Akkupacks testen
- 17 Innenwiderstand Ri
- 18 Solar Laderegler
- 19 Wechselrichter, Inverter
- 20 Löten - Anleitung für Akkus
- 21 Schlüsselanhänger aus 18650
- 22 Sicherheitskonzept
- 23 Akkus Beschaffung - wie und wo?
- 24 WVC / SG / GMI / PVGS Mikroinverter
- 25 Schritt-für-Schritt zur 18650 Powerwall
- 26 ATS - Automatic Transfer Switch
- 27 Schottky Sperrdioden für Parallelschaltung
- 28 Balkonsolar & Balkonkraftwerk
- 29 Hybrid Wechselrichter einrichten
1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)
Angefangen hat alles, als ich zur Corona-Quarantäne einen mobilen Lautsprecher selbst gebaut habe, mit Bluetooth und Akku.

Dazu hatte ich mir im Internet ein paar LiIonen Akkus bestellt mit 5.800mAh, also einer ziemlich hohen Kapazität.
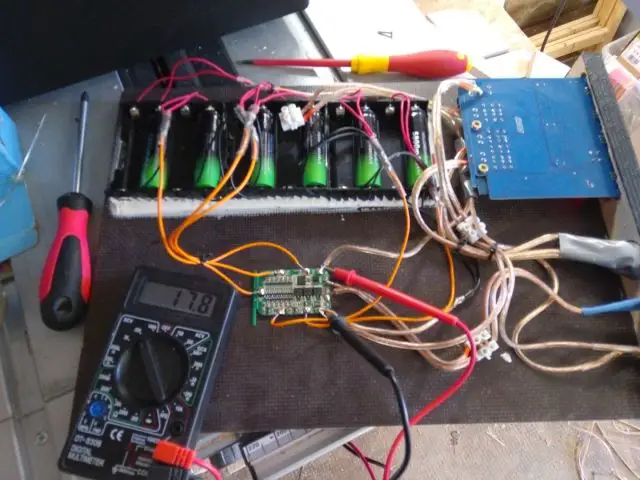
Doch trotz 12 Stück dieser Akkus mit der hohen Leistung ging die Musik nach nicht einmal 10 Minuten auf moderater Lautstärke aus.
Da wurde mir klar: das kann nicht stimmen, was da auf den Akkus aufgedruckt ist, die Angaben kommen nicht hin.
Also habe ich damit angefangen, im Internet zu recherchieren und schnell zwei Dinge festgestellt:
- die Herstellerangaben von Billig-Akkus aus China sind maßlos übertrieben. Aus diesem Grund habe ich dann einige Wochen später auch einen großen Chinaakku-Test durchgeführt und veröffentlicht, Du findest ihn hier im Menü unter 9 China Akkutest
- man kann mit LiIonen Akkus noch viel mehr tolle Sachen machen, also nur Akkulautsprecher und funkferngesteuerte RC-Modelle betreiben.
Inhaltsverzeichnis:
- 1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)
- 2 Idee + Plan
- 3 Akku-Arbeitsplatz
- 4 eBike Akku Komponenten
- 5 eBike Akku zerlegen
- 6 Laptop Akkus zerlegen
- 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte
- 8 neue Hülle für 18650
- 9 China-Akkutest
- 10 Werkzeuge + Messgeräte
- 11 Null-Watt Einspeisung
- 12 Modbus / RS485 Adapter
- 13 BMS + Balancer
- 14 aktiv Balancer BMS - JKBMS
- 15 Ladegeräte + Kapazitätstester
- 16 kpl. Akkupacks testen
- 17 Innenwiderstand Ri
- 18 Solar Laderegler
- 19 Wechselrichter, Inverter
- 20 Löten - Anleitung für Akkus
- 21 Schlüsselanhänger aus 18650
- 22 Sicherheitskonzept
- 23 Akkus Beschaffung - wie und wo?
- 24 WVC / SG / GMI / PVGS Mikroinverter
- 25 Schritt-für-Schritt zur 18650 Powerwall
- 26 ATS - Automatic Transfer Switch
- 27 Schottky Sperrdioden für Parallelschaltung
- 28 Balkonsolar & Balkonkraftwerk
- 29 Hybrid Wechselrichter einrichten
2 Idee + Plan
Die Idee
LiIonen Akkus werden in den unterschiedlichsten Anwendungen zu 99% im sog. "18650" Format produziert.

Dabei steht die 18650 für 18mm Durchmesser und 65mm Länge.
Diese Form der LiIonen Akkus erlaubt eine sehr hohe Energiedichte, d.h. auf den Platz gesehen enthält dieser Akkutyp sehr viel Strom.
Aus diesem Grund sind diese Akkus auch quasi überall verbaut.
- Taschenlampen
- E-Zigaretten Verdampfer
- RC-Spielzeug, Autos, Drohnen etc.
- Wildtierkameras
- Solarlampen
- Laptopakkus (die viereckigen Laptopakkus bestehen im Innern aus i.d.R. 6 bis 8 dieser runden 18650 Zellen)
- eBike-Akkus
- eScooter
- sogar Elektroautos haben schlussendlich mehrere Hundert oder Tausend dieser Rundzellen zu einem großen Akku zusammengefasst verbaut
Zudem können LiIonen Akkus auch dazu benutzt werden, um mit einer Photovoltaik Anlage überschüssigen Strom tagsüber zu speichern, um ihn dann nachts, wenn die Sonne nicht mehr scheint, zu benutzen um im Haushalt Strom, Fernseher und sogar Herd / Backofen etc. zu betreiben.
Solche Systeme heißen "Solarbatterie" oder "Pufferspeicher" und kosten als fertige Kauflösung je nach Größe und Hersteller um 10.000€
Aktuell (2020) kostet 1 KWh Solarspeicher etwa 1.000€
Die Idee: wir bauen soetwas selbst, und zwar viel preiswerter.
So in etwa wird das dann aussehen:
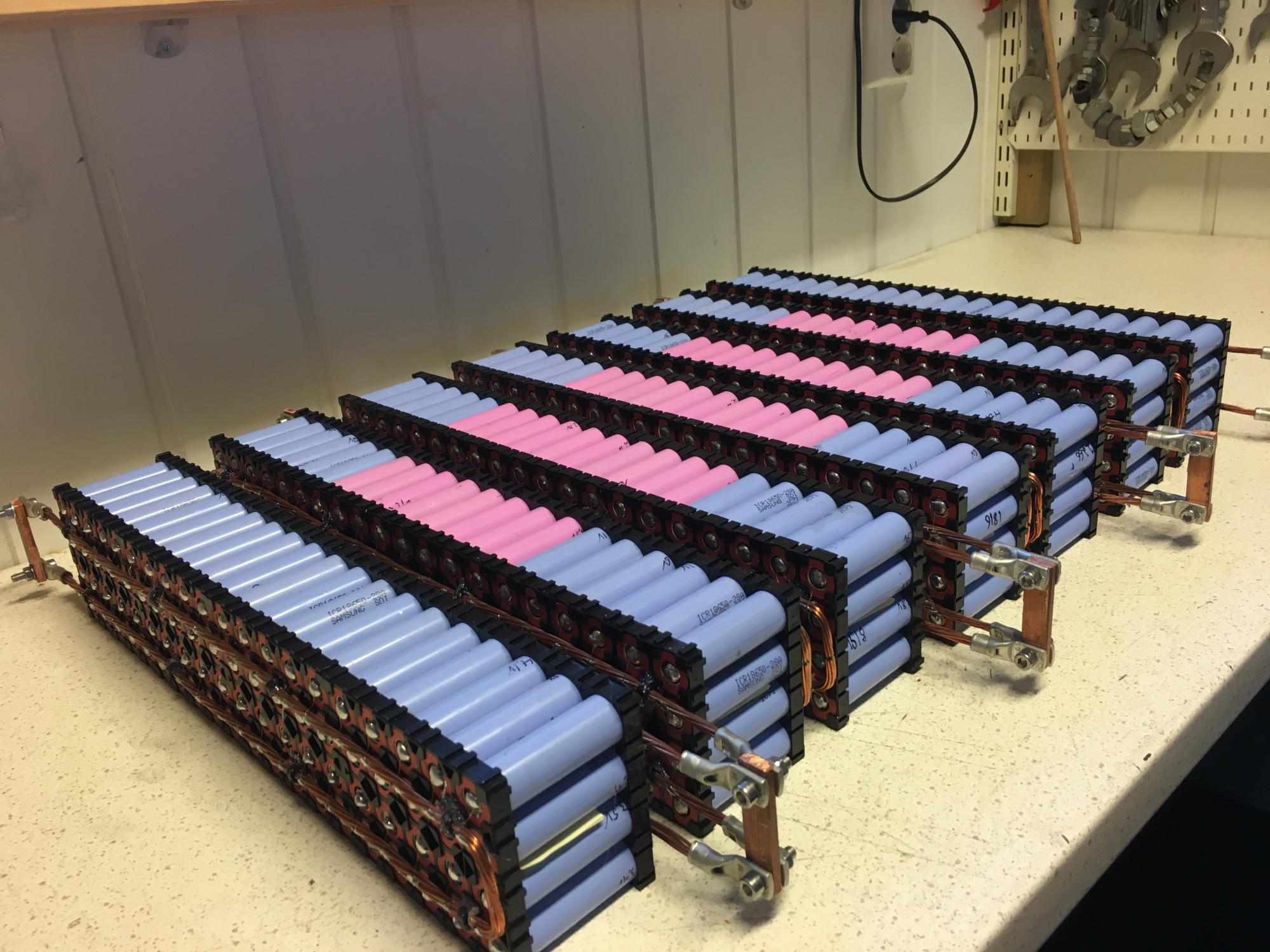
Der Plan
Einen Solarakku (= im Englischen oft Powerall) selbst bauen aus gebrauchten Akkus, und zwar aus ausgedienten oder defekten eBikeakkus und Laptopakkus.
In beiden Akkuvarianten stecken schlussendlich zu 99% diese runden 18650 Li-Ionen Akkuzellen drin. Und eBikeakkus sowie Laptopakkus sind weit verbreitet, da sollte man doch rankommen können.
Ziel: unseren Haushaltsstrom zu puffern. Wenigstens die Grundlast in Höhe von rund 250W permanent (TV, Kühlschrank, Standbyverbräuche etc.) sollten so abgepuffert werden.
Also ein Wochenende "geopfert" und per Google eine Liste erstellt mit allen Fahrradläden im Saarland, sowie solche die einen Onlineshop betreiben (bundesweit) und per Mail angeschrieben.
Ebenso Baumärkte, Verleihservices von eBikes und Akku-Repairservices.
Zum Schluss hatte ich etwa 80 Mails versendet mit einer Beschreibung, was ich vor haben und der Anfrage, ob man defekte Akkus bekommen könnte.
Die Resonanz war bescheiden. Etwa die Hälfte hat sich garnicht gemeldet, viele mit einer Absage samt Verweis auf die Batterieverordnungsvorschriften.
Ein Fahrradfritze hat sich darüber lustig gemacht, dass ich als Sozialarbeiter "Eh keine Ahnung von garnichts habe" (um mal vorweg zu greifen: zwar habe ich keine Ausbildung, um Fahrräder verkaufen zu können, aber immerhin mittlerweile erfolgreich einen selbst gebauten Batteriespeicher am Laufen, der das komplette Haus versorgt und mit dem auch das E-Auto zu 100% aus eigenem Solarstrom geladen werden kann).
5 Läden haben sich positiv zurück gemeldet, komplett verstreut über Deutschland. Zwei Wochen und rund 4.500 gefahrene KM später...

...hatte ich nun rund 120 eBike-Akkus zusammen.

und auch viele einzelne Akkupacks bereits ausgebaut aus eBike-Akkus

Details siehe hier -> KW18 - Solarakku - 18650 Zellen sammeln2
Damit lässt sich arbeiten.
Welchen Wechselrichter, wieviel PV-Leistung und wieviel Volt der Akku haben sollte ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht geplant.
Erstmal schauen, was man bekommt und dann überlegen, was man damit anfangen kann.
Inhaltsverzeichnis:
- 1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)
- 2 Idee + Plan
- 3 Akku-Arbeitsplatz
- 4 eBike Akku Komponenten
- 5 eBike Akku zerlegen
- 6 Laptop Akkus zerlegen
- 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte
- 8 neue Hülle für 18650
- 9 China-Akkutest
- 10 Werkzeuge + Messgeräte
- 11 Null-Watt Einspeisung
- 12 Modbus / RS485 Adapter
- 13 BMS + Balancer
- 14 aktiv Balancer BMS - JKBMS
- 15 Ladegeräte + Kapazitätstester
- 16 kpl. Akkupacks testen
- 17 Innenwiderstand Ri
- 18 Solar Laderegler
- 19 Wechselrichter, Inverter
- 20 Löten - Anleitung für Akkus
- 21 Schlüsselanhänger aus 18650
- 22 Sicherheitskonzept
- 23 Akkus Beschaffung - wie und wo?
- 24 WVC / SG / GMI / PVGS Mikroinverter
- 25 Schritt-für-Schritt zur 18650 Powerwall
- 26 ATS - Automatic Transfer Switch
- 27 Schottky Sperrdioden für Parallelschaltung
- 28 Balkonsolar & Balkonkraftwerk
- 29 Hybrid Wechselrichter einrichten
3 Akku-Arbeitsplatz
Um die vielen Laptop- und eBike Akkus zu zerlegen, die einzelnen Zellen zu testen und zu sortieren benötigt man Platz und Werkzeug. Zu Anfangs hatte ich das alles noch im Wohnzimmer gemacht aber dann schnell gemerkt - das wird so nichts, zu viel Unordnung, zu wenig Platz. Also musste ein neuer Ort her.
Als Winterprojekt hatte ich ein paar Monate zuvor eine Werkstatt in der Garage eingerichtet, das kommt mir jetzt gerade recht. 
ganz rechts ist die Ladestation. Aktuell nutze ich 6x LiitoKala Lii500 Engineer für Kapazitätstests, 2x XTAR VC8 zum Vorladen und zum Reaktivieren tiefentladener Zellen, 1x XTAR VC4 -> damit hat usprünglich alles angefangen. Das ist ein wachsendes Provisorium, das mir so noch gar nicht gefällt, hier bin ich schon am Planen, wie ich das besser und ordentlicher machen kann, und ohne dieses Kabelchaos. Ich hasse das

in der Mitte die bisher gesammelten Schätze Da ich später die Excelliste mit Repackr von Wolf nutzen möchte sammele ich gerade sortiert nach Zelltypen, das macht das Eintragen später einfacher. Auf dem Schreibblock halte ich die Zellendaten fest und auch "Geistesblitze" zwischendurch, seitlich sieht man noch ein Nitecore i2, mein allererstes LiIo Ladegerät. Ich find's eigentlich kacke, da man keinerlei Anzeigen hat außer (kryptische) Blinkcodes, behalte es aber trotzdem, da es eine ordentlichen Boost-Modus für 0V Zellen hat, wo die XTAR nur noch "Error" anzeigen und die Liito Kala sowieso rein garnichts mehr machen 
Generell hasse ich Ikea wie die Pest weil ich nie finde, was ich eigentlich brauche und aus Frust dann Zeugs kaufe, was ich nicht brauche damit die Fahrt nicht ganz umsonst waren. Aber diese Plasteboxen (Samla) sind super, hab damit mein komplettes Bastel- und Verbrauchszeugs sortiert, beschriftet und immer griffbereit.

Kosten auch fast nix

das Eck zum Zerlegen der Akkupacks. Zum Fotografieren blöd wegen Gegenlicht, zum Arbeiten aber gut da man trotz drinnen arbeiten dann doch wenigstens ein bissel Sonne abbekommt. Sieht man nicht aber ist rechts ums Eck: Bluetooth-Lautsprecherchen für Musik vom Handy

Mülltrennung

ganz links: Lötkram (Tipp: "Fluitin" ist echt topp zum Akku löten) und Sammelbox für BMSe, vielleicht bekommt man da noch den einen oder anderen Taler für. 
und zum Schluß: Lager für Akkupacks, die noch zu zerlegen sind. Die beiden alten ATX PC-Netzteile werden demnächst helfen, Ordnung in das Kabelchaos der Ladegeräte zu bringen

mal alles am Stück: die gesamte Werkbank hat übrigens 4,70m und ist komplett selbst gebaut, kleiner Baubericht gibt es hier -> Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 Teil 5 
achja, hier habe ich mal damit angefangen, ein paar Zellen, die ich für Bastelzwecke oder Freunde aufheben möchte, in die Schubladen einzulagern. Weiß noch nicht genau, ob ich das so lassen werde, aber da hab ich jedenfalls noch viel Platz

Update zur Ladestation:
Mittlerweile haben sich die Ladegeräte vermehrt und der Kabelsalat verringert -> 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte

Inhaltsverzeichnis:
- 1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)
- 2 Idee + Plan
- 3 Akku-Arbeitsplatz
- 4 eBike Akku Komponenten
- 5 eBike Akku zerlegen
- 6 Laptop Akkus zerlegen
- 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte
- 8 neue Hülle für 18650
- 9 China-Akkutest
- 10 Werkzeuge + Messgeräte
- 11 Null-Watt Einspeisung
- 12 Modbus / RS485 Adapter
- 13 BMS + Balancer
- 14 aktiv Balancer BMS - JKBMS
- 15 Ladegeräte + Kapazitätstester
- 16 kpl. Akkupacks testen
- 17 Innenwiderstand Ri
- 18 Solar Laderegler
- 19 Wechselrichter, Inverter
- 20 Löten - Anleitung für Akkus
- 21 Schlüsselanhänger aus 18650
- 22 Sicherheitskonzept
- 23 Akkus Beschaffung - wie und wo?
- 24 WVC / SG / GMI / PVGS Mikroinverter
- 25 Schritt-für-Schritt zur 18650 Powerwall
- 26 ATS - Automatic Transfer Switch
- 27 Schottky Sperrdioden für Parallelschaltung
- 28 Balkonsolar & Balkonkraftwerk
- 29 Hybrid Wechselrichter einrichten
4 eBike Akku Komponenten
eBike Akkus sind in der Regel ähnlich aufgebaut.
Obwohl sie äußerlich verschiedene Formen, Formate, Leistungsangaben und Gewicht haben bestehen sie in der Regel im Innern aus denselben, einzelnen Komponenten.
1.) Akkuzellen:
In etwa 99% aller eBike Akkus werden intern LiIon Zellen im standardmäßigen 18650 Format verwendet (=18mm Durchmesser, 65mm Länge). Ganz selten findet man die etwas größeren 26650 (=26mm Durchmesser, 65mm Länge).
Hier: Bosch Powerpack 500 Rahmenakku bestehend aus 40 Stück 18650 Zellen

Ebenso selten werden Flachakkus oder LiPo Akkus verwendet.
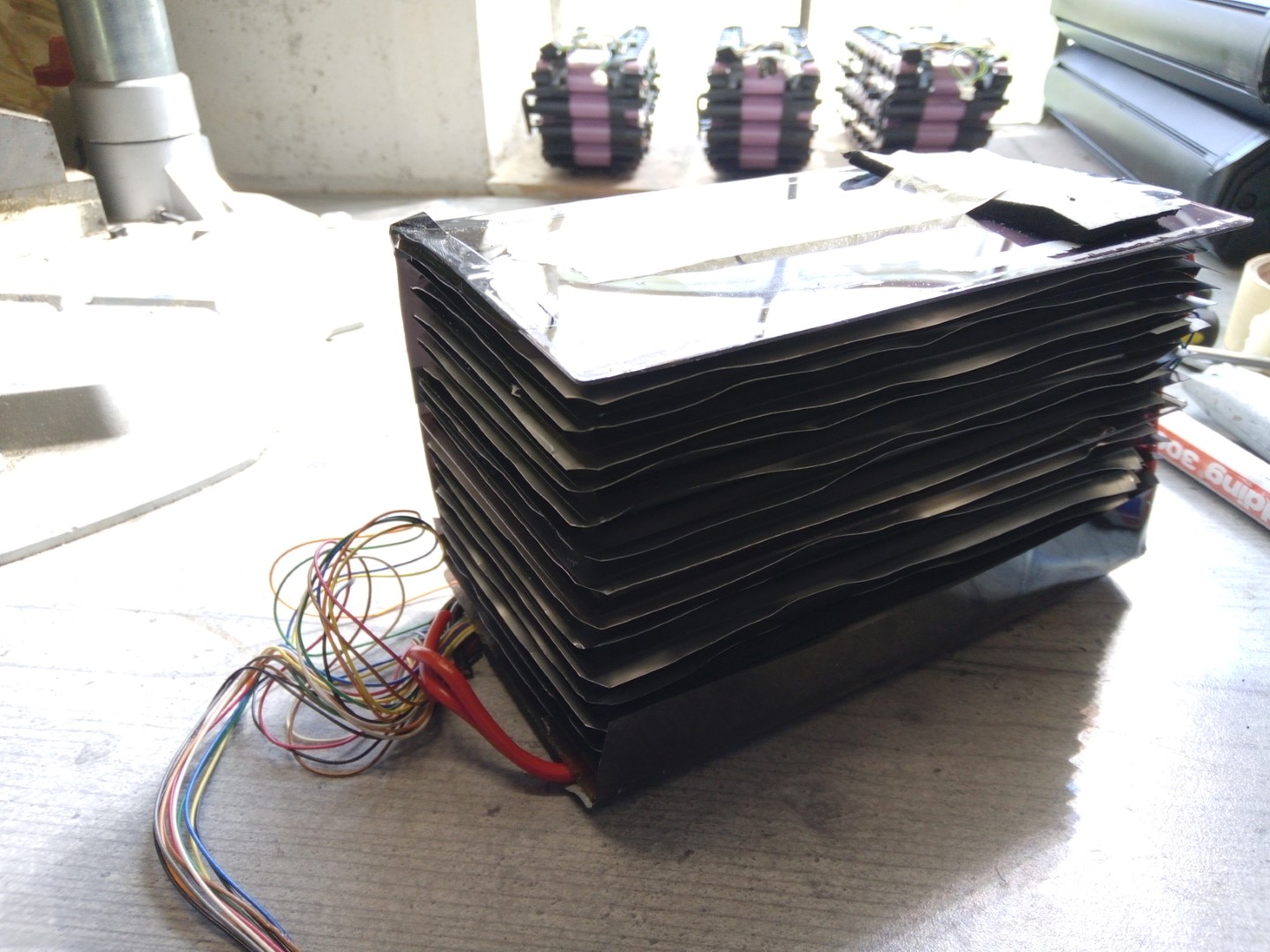
2.) BMS
Das Battery Management System ist bei allen LiIonen AKkupacks (nicht nur bei eBikes, auch in anderen Anwendungen) neben den Zellen selbst die wichtigste Komponente. Speziell bei eBikeakku ist das BMS zudem häufig der Grund für einen Akkudefekt. Hier: Bosch Powerpack mit BMS-Platine
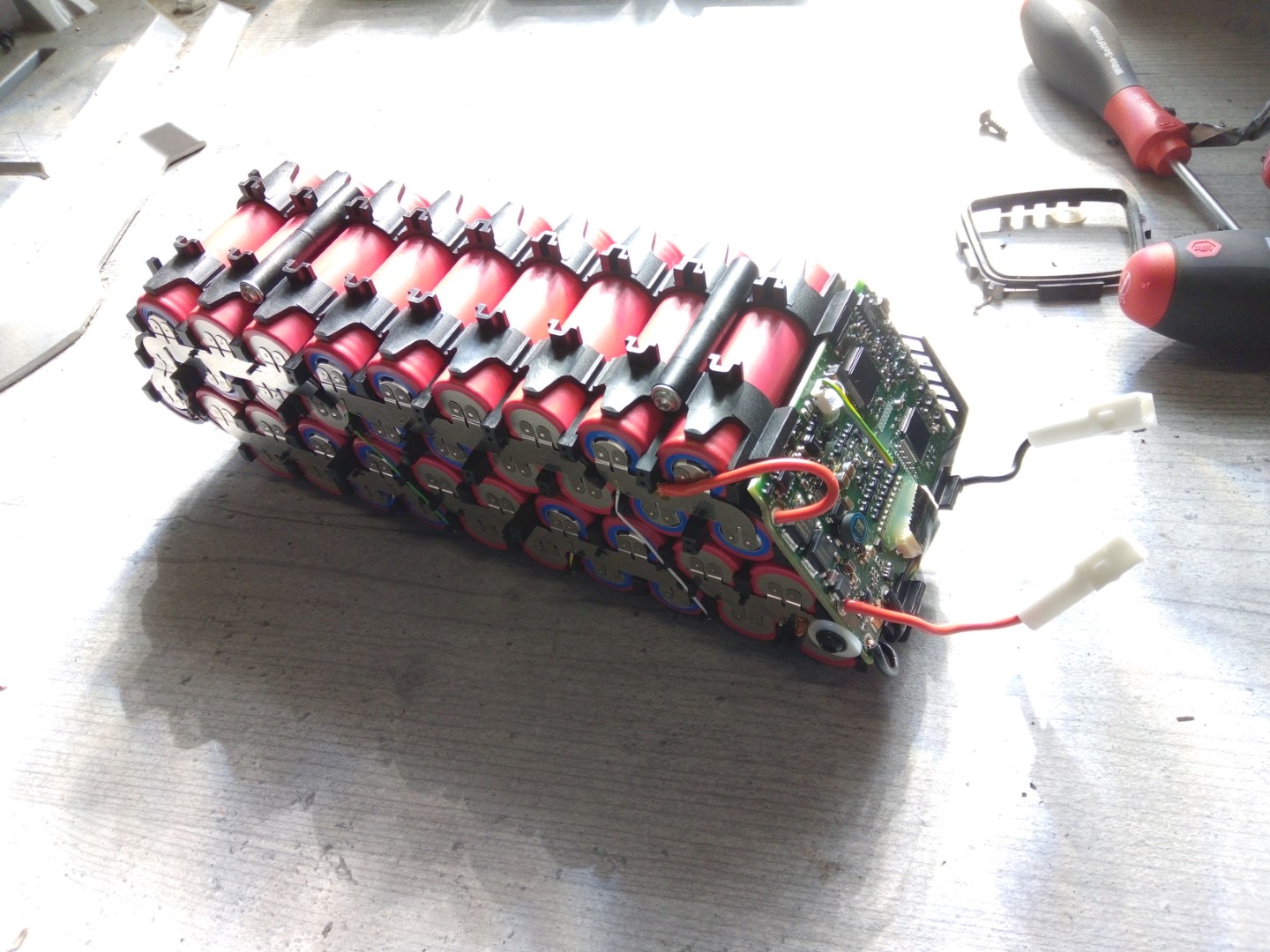
Das BMS bei eBikes besteht in der Regel aus drei Komponentenund hat vier unterschiedliche Aufgaben
- Ladecontroller / Laderegler: wenn dies nicht bereits das externe Netzteil regelt dann übernimmt das BMS die Aufgabe, die LiIonen Zellen korrekt zu laden. Dazu müssen unterschiedliche Ladecharekteristika eingehalten werden. Zum Beginn der Akkuladung wird im Modus CCC (= "constant curring" = konstante Stromstärke) geladen. Dabei steigt die Zellspannung kontinuierlich, die zugeführte Ampèrezahl jedoch wird limitiert auf einen gleichbleibenden Wert. Nähert sich die Zellspannung dann der Ladeschlussspannung schaltet der Laderegler um auf den Modus CVC (= "constant voltage charging" = konstante Spannung). Hier wird die Spannung bei 4,1 oder 4,2V fest beibehalten, während die Stromstärke kontinuierlich reduziert wird.
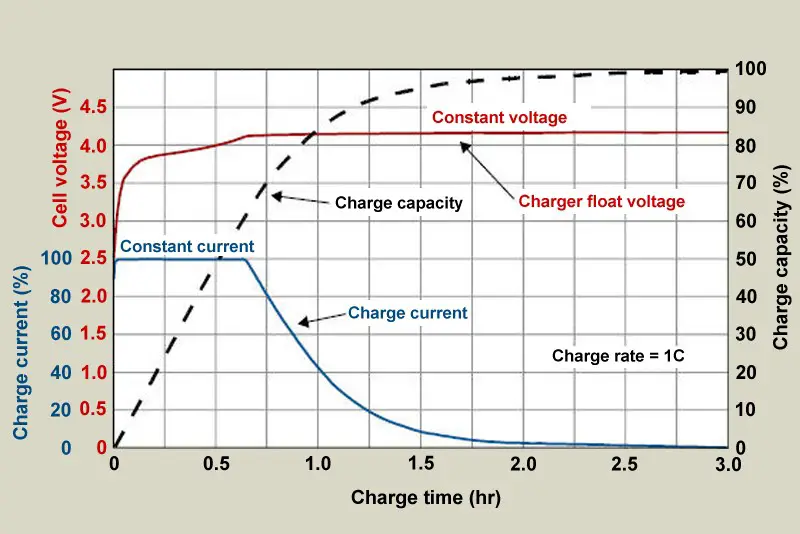 Bildquelle: BU-409: Charging Lithium-ion @ batteryuniversity.com
Bildquelle: BU-409: Charging Lithium-ion @ batteryuniversity.com - Über- / Unterspannungsschutz: Während der Benutzung sinkt bei Li Ionen Akkus deren Spannung, von idR 4,2V (= Ladeschlussspannung) über 3,7V (Arbeitsspannung, in diesem Bereich kann die Zelle die meiste Energie abgeben) bis hinunter zu 2,8V. Bei 2,8V muss das BMS nun die Last trennen, also den Motor und andere angeschlossene Verbraucher abschalten, damit der AKku nicht noch weiter entladen wird. Der Akku ist dann quasi leer. Richtig leer ist er bei 2,8V eigentlich noch lange nicht, aber sinkt die Spannung unter 2,5V nimmt die Zelle irreparable Schäden, man spricht man von einer Tiefenentladung. Im besten Fall verliert die Zelle nur an Kapazität, im schlechtesten Fall, bei längerer Lagerungsdauer im tiefentladenen Bereich, kann es zu einem internen Kurzschluss kommen und dann zu einem Akkubrand, hierzu im nächsten Abschnitt mehr. Li Ionen Akkus dürfen auch nicht überladen werden, d.h. wenn sie voll aufgeladen sind muss der Ladestrom unterbrochen werden. Andernfalls erhitzt sich die Akkuzelle, bis es im schlimmsten Fall zu einem Entzünden kommt. Das fatale im Fall von eBike-Akkus ist nun, dass selbst wenn zunächst nur eine Zelle überhitzt und entflammt, diese die benachbarten Zellen innerhalb wenigen Sekunden so stark erhitzt, dass diese sich ebenfalls entzünden. Es gibt eine Kettenreaktion, die nur noch sehr schwer zu kontrollieren ist, da sich Li-Ionen Brände kaum löschen lassen. Traditionelles Löschen mit Pulver oder CO2 bleibt wirkungslos, da beim Verbrennen von Lithium Sauerstoff freigesetzt wird und sich so der Brand quasi selbst am Leben hält und schürt. Ein Löschen mit Wasser ist bei Strom (Elektrobränden) generell nicht zulässig und im Falle eines Lithium Brandes sogar besonders gefährlich da hier Temperaturen von über 1.000°C erreicht werden und Wasser bei solch hohen Temperaturen in seine atomaren Bestandteile = Wasserstoff aufgespalten wird und verpuffen / explodieren -> s. auch Feuergefahr bei Lithium-Ionen-Akkus. Was tun bei Batteriebrand? @ elektroniknet.de
Brennende Akkus @ Institut für Schadenverhütung. Beitragsteil zu eBikes ab 1Min45
- Überhitzschutz: Nicht alle aber die meisten eBike Akkupacks haben einen oder mehrere Temperatursensoren innerhalb der vielen Akkuzellen sitzen. Erhitzt sich das AKkupack nun unzulässig, aufgrund von Überladung, Überbeanspruchung oder eines Defektes, dann schaltet das BMS die Last ab, sodass sich der Akku wieder abkühlen kann
- Balancer: Bei eBike Akkus werden immer mehrere LiIonen Zellen seriell, also hintereinander = in Reihe geschaltet. Das dient dazu, die Spannung zu erhöhen. Ein Standardwert bei eBike Akkupacks ist 36V. Das wird dadurch erreicht, dass zehn 18650 Zellen in Reihe geschaltet werden. 10x 3,6V = 36V. Nun unterliegen LiIonen Zellen immer gewissen Fertigungstoleranzen ab Werk, werden also bereits mit leicht abweichenden Werten ausgeliefert. Zudem nutzen sie sich im Gebrauch auch leicht unterschiedlich ab. Nun kann es also vorkommen, dass beim Fahren neun von zehn Zellen in diesem 10er Verbund noch bei gut funktionierenden 3,2V liegen, aber eine Zelle jedoch schon nur noch 2,9V hat und sich damit der unteren Spannungsgrenze nähert. Um einen Defekt zu verhindern muss das BMS also bald den kompletten Akku abschalten, obwohl der Großteil noch genug Restladung hat. Die Balancing Funktion sorgt nun dafür, dass Ladung von den volleren Akkus hin zu den schwächeren wandert, damit keine Spannungsdifferenzen entstehen. Tatsächlich geschieht dieses Ausballancieren permanent und zwar bereits ab dem Start und nicht erst, wie hier im Beispiel beschrieben, wenn es schon "fast zu spät" ist.
Inhaltsverzeichnis:
- 1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)
- 2 Idee + Plan
- 3 Akku-Arbeitsplatz
- 4 eBike Akku Komponenten
- 5 eBike Akku zerlegen
- 6 Laptop Akkus zerlegen
- 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte
- 8 neue Hülle für 18650
- 9 China-Akkutest
- 10 Werkzeuge + Messgeräte
- 11 Null-Watt Einspeisung
- 12 Modbus / RS485 Adapter
- 13 BMS + Balancer
- 14 aktiv Balancer BMS - JKBMS
- 15 Ladegeräte + Kapazitätstester
- 16 kpl. Akkupacks testen
- 17 Innenwiderstand Ri
- 18 Solar Laderegler
- 19 Wechselrichter, Inverter
- 20 Löten - Anleitung für Akkus
- 21 Schlüsselanhänger aus 18650
- 22 Sicherheitskonzept
- 23 Akkus Beschaffung - wie und wo?
- 24 WVC / SG / GMI / PVGS Mikroinverter
- 25 Schritt-für-Schritt zur 18650 Powerwall
- 26 ATS - Automatic Transfer Switch
- 27 Schottky Sperrdioden für Parallelschaltung
- 28 Balkonsolar & Balkonkraftwerk
- 29 Hybrid Wechselrichter einrichten
5 eBike Akkus zerlegen
Ich selbst habe im ersten Halbjahr 2020 über 120 eBike Akkuspacks zerlegt, mit dabei viele verschiedene Modelle von unterschiedlichen Herstellern.

Dabei sind die meisten Akkupacks ähnlich aufgebaut, bei einigen jedoch hat jedes Akkupack seinen eigenen Kniff oder Trick, um es auf zu bekommen.
Ich möchte hier ein paar Akkupacks kurz vorstellen, um das Öffnen zu erleichtern, oder einfach nur damit man mal sehen kann, wie sowas von Innen aussieht.
Hinweis:
Bitte sei vorsichtig und konzentriert beim Öffnen von Akkupacks, egal ob nun von einem eBike, Laptop oder Spielzeug.
Li-Ionen Zellen haben eine enorme Energiemenge gespeichert und können bei falscher handhabung, Kurzschluss oder Beschädigung anfangen zu brennen.
Daher lies Dir bitte aufmerksam durch, was hier steht und geh nicht einfach so mit dem Hammer auf ein Akkupack los!
1. Werkzeug
Wenn Du einen eBike-Akku nur zerlegen möchtest, um an die Akkuzellen heran zu kommen (so wie ich) um sie für ein Solarprojekt oder für andere Spielereien wie Akkulautsprecher, Modellbau, eScooter etc. zu benutzen, brauchst Du kein Spezialwerkzeug und alles, was Du benötigst ist hier auf dem Foto zu sehen, für egal welchen Akkupack egal welchen Herstellers

die drei wichtigsten Tools: abgewinkelte Spitzzange (= Telefonzange) mit 180 oder 200mm, Seitenschneider, robuster Flachschraubenzieher zum Hebeln

guter Flachschraubenzieher der vorn auch wirklich richtig flach ist, mittelgroßer Kreuzschlitzschraubendreher (idealerweise PH1), Torx TH15 als Schraubenzieher, notfalls auch als Bit oder Inbus

dünne Handschuhe (Montagehandschuhe, KFZ-Handschuhe) sind spätestens beim Entfernen der Nickelstreifen sinnvoll, Hammer sollte mittelgroß sein, etwas um 250 Gramm rum oder mehr
Dringende Empfehlung:
manchmal kommt es vor, dass man einen Kurzschluss fabriziert, der nicht mehr rückgängig zu machen ist.
- Beschädigung des äußeren Mantels einer Li-Ionen Zelle -> interner Kurzschluss
- ein Stück Metall / Nickelstreifen legt sich auf Plus und Minus und backt dort sofort fest
Wenn das Ganze dann noch im Zellverbund mit 40 oder 50 weiteren Zellen passiert führt dies schnell zu einer Kettenreasktion (Thermal Runaway) und ist kaum mehr zu kontrollieren. Die Folge ist ein Brand mit über 1.000°C
- Ein Feuerlöscher wird nicht viel helfen, denn der basiert auf dem Prinzip, dem Feuer den Sauerstoff zu rauben; was bei einem Lithiumbrand nicht funktioniert, da durch die Verbrennung Sauerstoff entsteht - das Feuer füttert sich somit selbst
- Wasser als Löschmittel ist absolut nicht zu empfehlen, da Strom + Wasser = noch mehr Kurzschluss, und außerdem wenn das Feuer bereits die 1.000°C erreicht hat kann es passieren, dass Wasser in seine atomaren Bestandteile aufgespalten wird und somit Wasserstoff entsteht - was extrem explosiv ist!
Daher die dringende Empfehlung:
Bevor Du damit anfängst, ein Akkupack zu zerlegen besorg Dir zwei Eimer oder einen Eimer und eine Kiste und etwas Sand und bau eine "Löschgrube"
- Kiste mit drei Handbreit Sand auf dem Boden
- daneben ein gut gefüllter Eimer Sand
- kokelnde / brennende Akkuzelle in die Kiste werfen, Eimer darüber auskippen
Der Sand wird der Akkuzelle die Wärmeenergie entziehen und diese soweit abkühlen, dass sie sich gar nicht erst entzündet.
Das habe ich schon mehrfach "ausprobiert", mit einzelnen Zellen, mit einem teilzerlegten Akkupack - das hat bisher immer sehr gut funktioniert und es ist nichts weiter passiert.
Nach einigen Stunden kann man die defekte Akkuzelle wieder entnehmen, wenn sie abgekühlt ist. Sie ist dann leer und es kann nichts mehr passieren.

Mülltrennung: Behälter für Elektronik-reste wie Kabel, BMS, Sensoren etc.

und Behälter Kunststoff / Klebereste / Gehäuseteile / Zellhalter / Restmüll

2. Akkulagerung / Sortierhilfe
Ich kann es nicht oft genug erwähnen: LiIonen Zellen sind kein Spielzeug und haben sehr viel Energie in sich. Umso gefährlicher, wenn viele Akkuzellen dicht zusammen kommen.
Beim Lagern sollte man darauf achten, diese nicht einfach lose in einen Karton oder Eimer zu werfen, wo schnell ein Kurzschluss entstehen kann, sondern am besten
- stabile Boxen / Kisten benutzen
- immer alle Akkus sauber stapelt sodass sie in eine Richtung zeigen
- mit Trennstreifen aus Karton o.ä. Plus und Minuspol voneinander trennt
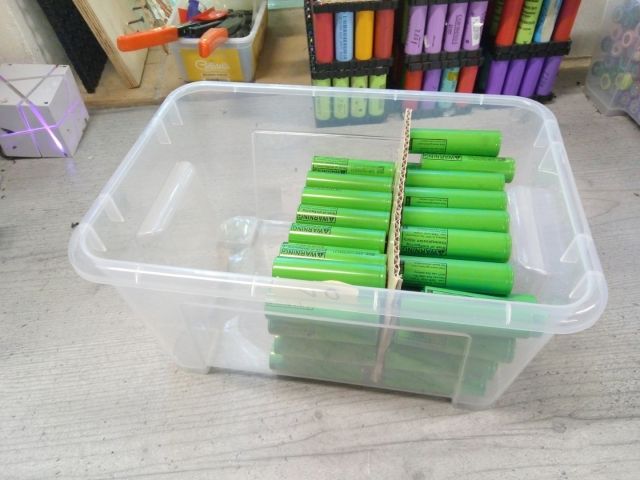
Auch wenn ich ansonsten von Ikea nicht überzeugt bin sind dessen"Samla" Plastikboxen ideal dazu geeignet, günstig und stapelbar

Nun haben wir alles zusammen, jetzt kann es an das Zerlegen der eBike Akkus gehen, wobei ich hier ausführlich nur auf den recht gängigen Bosch Powerpack 400 / 500 Rahmenakku, exemplarisch eingehen möchte.
Alle anderen eBike Akkupacks (Gazelle, Ansmann, BionX, verschiedene noname, Bosch Classic, Gepäckträgerakku & Powertube), bei denen ich das Zerlegen dokumentiert...
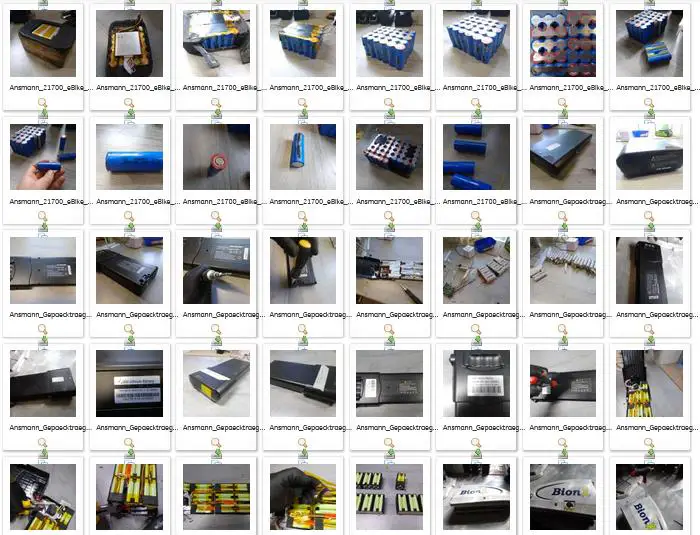
...habe findet Du mitsamt einer anschaulichen bebilderten Schritt-für-Schritt Anleitung hier -> eBike Akkus zerlegen
Bosch Powerpack 400 / 500 Rahmenakku
Dauer: 15 - 30 Minuten
benötigtes Werkzeug: Torx TX15, Flachschraubendreher klein + groß, Hammer, Telefonzange (abgewinkelte Spitzzange), Seitenschneider
Schwierigkeitsgrad: sehr einfach (so ziemlich der einfachste Akku zum Zerlegen)

auf der Unterseite sind 4 bzw. 6 Torxschrauben, je nach Produktionsjahr und -Ort. Eine davon ist idR mit Gummi versiegelt, das kannst Du einfach mit etwas Spitzem rauspopeln.
Das Metallblech oberhalb des Schraubenziehers auf diesem Bild brauchst Du nicht abschrauben

der Rahmenakku wird intern mit vielen Klippsen zusammen gehalten, die man, einmal eingerastet, von außen nicht wieder öffnen kann. Es gibt Anleitungen im Netz, die beschreiben, wie man diese von außen anbohrt, aufdrückt und dann die Löcher anschließend wieder verschließt.
Mein Ansatz ist einfacher, hinterlässt aber kleine Spuren im Bereich des Griffes. Kleiner (flacher) Flachschraubenzieher mit Hilfe des Hammers seitlich am Griff in etwa auf halber Höhe einschlagen, wie auf dem Bild zu sehen.
Vorsicht: auf keinen Fall an einer anderen Stelle des Akkus als im Griffbereich ansetzen, da man ansonsten zwangsläufig die Akkus im Innern trifft und einen Kurzschluss verursacht - Brandgefahr

dann den dicken Flachschraubenzieher zu Hilfe nehmen. Ein paar Mal vor und zurück biegen, bis jeweils ein lautes Knacken zu hören ist. Damit sind dann zwei Klippse auf gesprungen.

Mit etwas Glück schafft man es auch, dass drei Klippse aufspringen, aber das klappt nicht immer.
Bei der nachfolgenden Aktion darf man nicht zimperlich sein. Braucht man auch nicht, die Bosch Gehäuse sind äußerst stabil, das Kunststoff bricht nur sehr schwer und man kann es gut verbiegen, ohne dass etwas passiert:
durch den Schlitz mit beiden Händen das Gehäuse packen und auseinander ziehen. Ggf. nochmal den dicken Schraubenzieher zu Hilfe nehmen. Dabei ruhig mit Nachdruck (etwas Gewalt) an das Gehäuse rangehen

das kracht alles arg böse und hört sich schlimm an, aber in der Regel bleiben dabei alle Klippse unversehrt

Dann das Akkupack wie einen Kuchen aus der Form herausstülpen, dabei mit der Kante ruhig mal auf den Tisch / die Werkbank klopfen.
Vorsicht: wenn das Akkupack aus dem Gehäuse gerutscht ist dieses nicht direkt weg ziehen, denn da sind drei dünne Käbelchen, die man ansonsten einfach abreißt. Hier aufpassen und vorsichtig den kleinen Stecker am BMS abklippsen. Oder wenn man das BMS nicht braucht (so wie ich): die drei Käbelchen mit dem Seitenschneider einfach abknippsen.
Da isser nun. 40 Topp-Zellen

Die 400er Powerpacks haben idR Sanyo (selten), LG oder Samsung Zellen mit 2.850 oder 2.900mAh, die 500er Packs mit 3.500mAh je Zelle - das ist das Beste, was es derzeit gibt und das Maximum, was technisch machbar ist. Hier nochmal der Hinweis auf LiIonen Akkuzellen mit höheren Kapazitätsangaben als 3.500mAh: das sind definitiv und zu 100% dreiste Fakes, siehe auch -> China-Akku 18650 Test - 509.600 mAh in 62 Zellen
Das BMS ist mit nur einer Schraube befestigt, die beiden dicken Kabel (Plus / Minus) mit der Zange abschneiden, die dünnen Balancer-Käbelchen kann man einfach mit der Hand an den Akkuzellen abrupfen
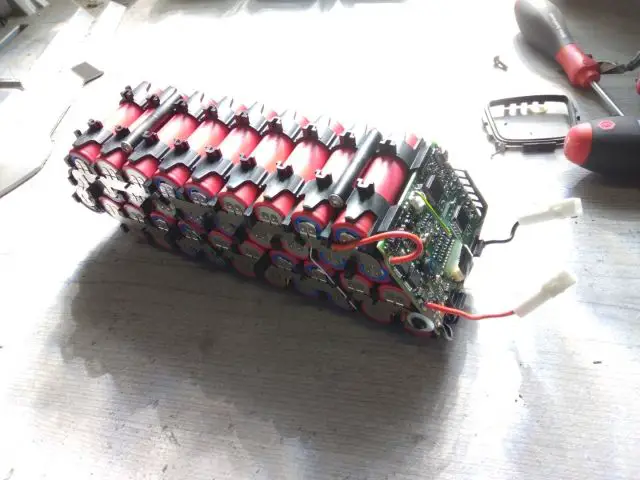
zum Entfernen der Nickelstreifen benötigt man am besten Handschuhe, die gebogene Spitzzange und den kleinen Schlitzschraubenzieher.
Um zunächst irgendwo mal einen Anfang hin zu bekommen kann man mit dessen Hilfe ein Stückchen Nickelstreifen hochklappen, sodass man es mit der Spitzzange schnappen kann.
Vorsicht: bitte nur am Minuspol (das flache Ende am Akku) ansetzen und hebeln. Tut man das am Pluspol dann verletzt man beim Hebeln die Isolierung des äußeren Randes, was ein Minus ist, und man hat einen Kurzschluss. An diesem Punkt am besten den oben genannten Sandeimer parat haben.

dann einfach mit der Spitzzange zupacken und beherzt dran ziehen. Der Nickelstreifen geht dabei kaputt, das lässt sich nicht vermeiden.
Vorsicht: unbedingt darauf achten, mit der Zange nicht an einen benachbarten gegensätzlichen Pol zu kommen

alles abgerupft sieht das dann so aus
Vorsicht: die abgerissenen Nickelstückchen am besten gleich auf Seite auf ein Häufchen legen und nicht wild über die Werkbank verteilt rumfliegen lassen, denn idR ist man den Akkupack immer am hin und her schieben, am Anheben und Absetzen, während man daran arbeitet. Und da passiert es sehr schnell, dass man das Akkupack auf einem abgerupften Nickelstückchen absetzt und damit hat man dann unter Garantie einen Kurzschluss, der sich festbackt. Falls das passiert kann man nichts mehr machen und spätestens jetzt hat man dann hoffentlich einen Sandeimer vorbereitet

,
man muss auf beiden Seiten des Akkupacks das Nickel entfernen, bevor es weiter geht. Dann die vier Schrauben im Zellhalter rausdrehen

der Bosch-Zellhalter sitzt so fest, dass man die beiden Hälften von Hand nicht auseinander bekommt. Darum nacheinander die vier Stellen, wo die Schrauben drin waren, mit dem kleinen Flachschraubenzieher einen Spalt aufhebeln

ggf. 2x rundherum an allen vier Stellen etwas aufhebeln bis der Spalt etwa so groß ist wie auf dem Bild hier.

Dann sollte man die beiden Hälften ganz locker von Hand auseinander bekommen

Tadaa - jetzt kann man die 40 Zellen gemütlich ernten

Achja, falls jemand mal einen Bosch Powerpack Rahmenakku von Grund auf neu zusammenbauen möchte habe ich hier mal noch Detailbilder von den Nickelstreifen samt Balanceranschlüssen gemacht um rekonstruieren zu können, wie die einzelnen Zellen verschaltet sind.
PS: alle Bosch Akkus (Classic, Powerpack Rahmenakku / Gepäckträgerakku, Powertube) sind 10s4p Systeme, d.h. 4 Akkuzellen parallel geschaltet und dann 10 dieser 4er Päckchen seriel = in Reihe, um auf effektiv 36V zu kommen.
Ausnahme: der Powertube 625 ist ein 10s5p und hat somit 50 Zellen insgesamt, jeweils 5 zu parallelen Päckchen geschaltet und davon dann 10 seriell.


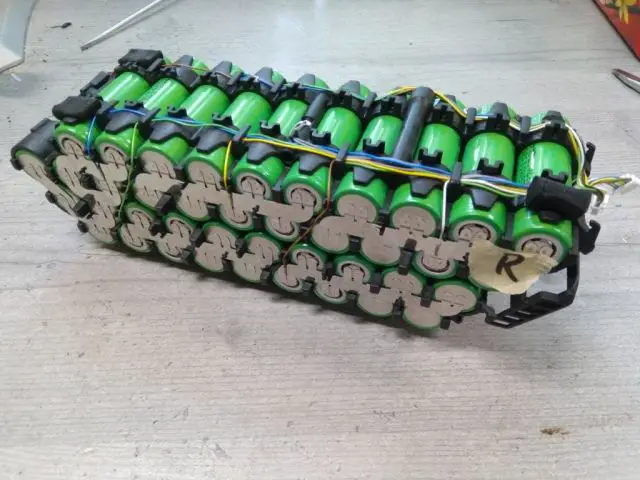

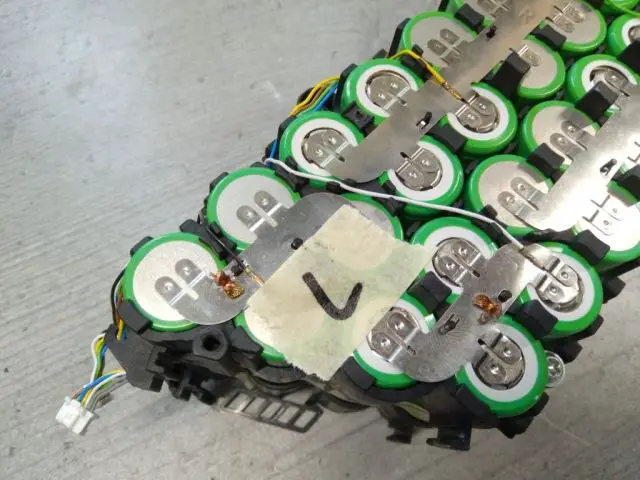





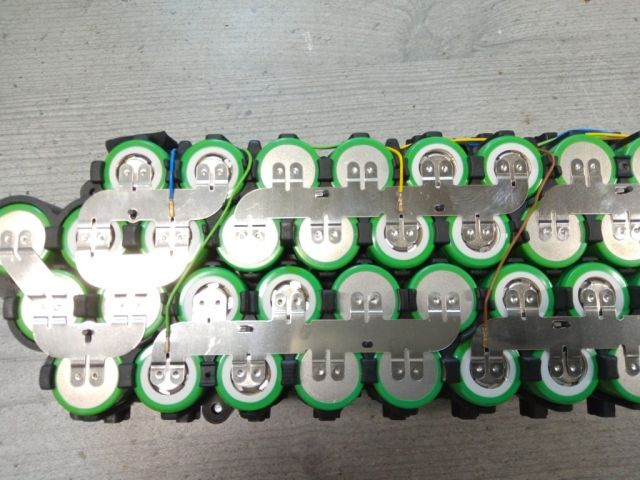
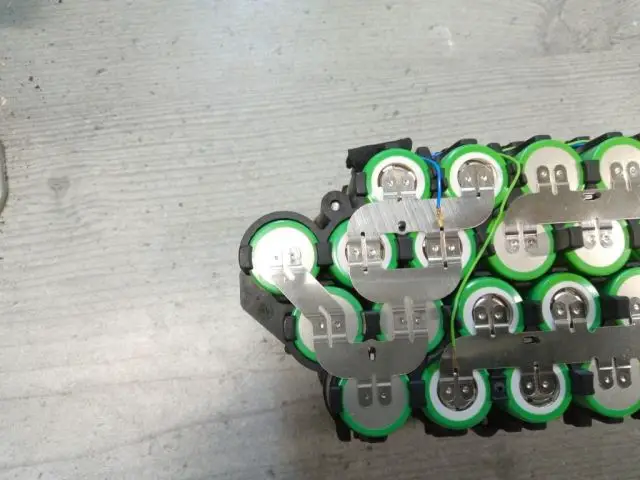

Inhaltsverzeichnis:
- 1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)
- 2 Idee + Plan
- 3 Akku-Arbeitsplatz
- 4 eBike Akku Komponenten
- 5 eBike Akku zerlegen
- 6 Laptop Akkus zerlegen
- 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte
- 8 neue Hülle für 18650
- 9 China-Akkutest
- 10 Werkzeuge + Messgeräte
- 11 Null-Watt Einspeisung
- 12 Modbus / RS485 Adapter
- 13 BMS + Balancer
- 14 aktiv Balancer BMS - JKBMS
- 15 Ladegeräte + Kapazitätstester
- 16 kpl. Akkupacks testen
- 17 Innenwiderstand Ri
- 18 Solar Laderegler
- 19 Wechselrichter, Inverter
- 20 Löten - Anleitung für Akkus
- 21 Schlüsselanhänger aus 18650
- 22 Sicherheitskonzept
- 23 Akkus Beschaffung - wie und wo?
- 24 WVC / SG / GMI / PVGS Mikroinverter
- 25 Schritt-für-Schritt zur 18650 Powerwall
- 26 ATS - Automatic Transfer Switch
- 27 Schottky Sperrdioden für Parallelschaltung
- 28 Balkonsolar & Balkonkraftwerk
- 29 Hybrid Wechselrichter einrichten
|
Du findest unsere Beiträge hilfreich und möchtest uns unterstützen?  Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten und zwar ganz ohne, dass es Dich etwas kostet (hier klicken) |
6 Laptop Akkus zerlegen

Anders als bei eBike-Akkus geht das Zerlegen von Laptop-Akkus sehr einfach.
Dort sind auch idR 18650 Zellen verbaut, egal beim welchem Hersteller, egal welches Modell.
Selten sind mal andere Zellen verbaut, hauptsächlich bei flachen Business-Notebooks.
Bei Youtube sieht man einige Varianten, wie man Laptopakkus mit Zange, Schraubstock, Drehen und Biegen auf bekommt.
Ich habe alle ausprobiert und mittlerweile sehe ich das ganz entspannt: bei Laptopakkus braucht man nicht zimperlich sein, da passiert idR nichts
Nach dem Knacken der Gehäuse am besten gleich die Zellen "putzen", also von Nickelstreifen und Kleberesten befreien.
Ist das passiert, können die auch ruhig mal auf einem Haufen liegen. Dann aber dabei bleiben, bis alles fertig ist. Auch, wenn die Frau zum Abendessen ruft!

für längere Lagerung aber bitte dann ordentlich in stabilen Boxen und mit (Papp-)Trenner zwischen den Polen, damit es zu keinem Kurzschluss kommen kann

Achtung:
1. der Trick ist hier, genau die Ecke des Gehäuses hart aufzuschlagen. Genau in der Ecke ist kein AKku, der beschädigt werden kann. NIEMALS mit der langen Seite aufschlagen, dadurch beschädigt man mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine Zelle und es kommt zu einem Kurzschluss.
2. sicher ist sicher: wie oben bei "Arbeitsplatz" beschrieben am besten immer einen Eimer Sand bereithalten, falls doch mal etwas passiert. Ich selbst haber mittlerweile rund 1.500 Laptopakkus auf diese Weise geknackt und zerlegt - ohne Kurzschluss
Laptop vs eBike Akkus
Da ich mittlerweile nun auch einige Akkupacks zerlegt und sortiert habe hier mal meine Erfahrung soweit:
eBike-Akkupacks
- zerlegt: rund 120 Akkupacks - Zellen vorsortiert: ~5.000 - Zellen auf Spannung getestet: ~3.000 - Zellkapazität getestet: ~1.000 - mech. Beschädigungen (Zellen verknickt, Rost, undicht): 100 Zellen. Um genau zu sein hatte ich bisher zwei Akkupacks (selber Hersteller) mit Wassereintritt und verrosteten Polen = 2% (von 5.000)
- tote Zellen (0,0V / interner Kurzschluss): 100 Stück = 3,3% (von 3.000)
- Zellkapazität rated: einige uralt-Akkupacks haben noch 2.200er Zellen verbaut, aber die habe ich alle bei eBay wieder verkauft. Der Großteil der Akkupacks hat 2.500mAh aufwärts verbaut, die guten haben zwischen 2.900 und 3.500mAh Zellen. Über die Hälfte meiner gesammelten Zellen sind Zellen mit 2.850 und 2.900mAh rated
- Zellkapazität tested: ca. 90% der getesteten Zellen liegen bei um 90% Rest-Kapazität. 5% sind richtig ausgelutscht (mehr als 25% Kapazitätsverluist = unbrauchbar), etwa 5% liegen um die 100% Restkapazität. Teilweise liegen auch noch welche über den Herstellerangaben wie hier die Panasonic NCR18650PF mit 2.900mAh rated


- Dauer zum Zerlegen: am Anfang habe ich bis zu 1 Stunde gebraucht, um ein Pack mit 40 - 50 Zellen zu zerlegen. Mittlerweile brauche ich selten länger als 15 Minuten hier ein langweiliges Video ohne Zeitraffer, einfach um mal den Zeitaufwand zu sehen. Wobei das hier eigentlich ein eher schlechtes Beispiel ist, denn dieses Akkupack ist richtig nervig blöd zum Zerlegen gewesen, die Nickelstreifen liesen sich richtig schlecht ablösen https://www.youtube.com/watch?v=TvI07ABUFpU
Laptop Akkus:
nachdem ich nun fast alle eBike-Akkus durch habe habe ich mich auch mal an Laptop-Akkus versucht. Immer, wenn ich am Wertstoffhof war (jedes Mal ein anderer in meiner Nähe), um Reste zerlegter AKkus zu entsorgen habe ich gleich nach Laptop-Akkus gefragt und konnte so rund 500 davon abstauben. - zerlegt: rund 200 Akkus - Zellen vorsortiert: ~1.500 - Zellen auf Spannung getestet: ~1.500 - Zellkapazität getestet: ~1.500

- mech. Beschädigungen (Zellen verknickt, Rost, undicht): 50 Zellen. = 3,3% (von 1.500)
- tote Zellen (0,0V / interner Kurzschluss): 150 Stück = 10% (von 1.500)

- Zellkapazität rated: 80% etwa liegen bei um 2.200mAh, der Rest darüber, keiner über 2.900mAh
- Zellkapazität tested: > 2.500mAh: 10% / 2.100 -2.500mAh = 21,2% / 2.000 - 2.100mAh = 7,5% / 1.500 - 2.000mAh = 23% / <1.500mAh = 25% / mech. besch. & tot: 13,3%



- Dauer zum Zerlegen: auch ohne Übung geht das recht schnell, im Schnitt etwa 1 Minute / Akku = im Schnitt 120 Zellen in 15 Minuten https://www.youtube.com/watch?v=MQ4rVUrbDSY Aufwand im Vergleich:
- Beschaffung: ist bei Laptop Akkus stressfreier. Wertstoffhöfe geben defekte Akkus bereitwilliger heraus als Fahrradhändler die eBike-Akkupacks.
Allerdings: idR bekommt man beim Wertstoffhof im Vergleich nur kleine Mengen. 30 Akkus = 240 Zellen sind Durchschnitt.
Bei Fahrradhändlern, die defekte Akkupacks gesammelt haben bekommt man öfters mal 10 - 20 Akkupacks auf einen Schlag = 500 - 1.000 Zellen
- Zerlegen: bei eBike-Akkus hat jeder Akku sein eigenes System und man braucht ein bisschen Eingewöhnungszeit und Übung, um an die Zellen ran zu kommen. Dazu kommt, dass die Nickelstreifen richtig doll geschweißt wurden, viel fester als bei Laptopakkus.
Das Entfernen braucht mehr Zeit und wenn man nicht aufpasst reißt man Löcher in die Zellböden (gerade bei Panasonic Zellen). Dadurch hat man auch gerne mal eine gewisse Hemmschwelle um mit dem Zerlegen an zu fangen wenn man einen neuen AKku hat, wo man noch nicht weiß, wie der auf geht und man aber weiß, dass man Minimum 50 Zellen zerlegen muss wenn man erstmal angefangen hat.
Bei Laptop-Akkus ann man auch zwischendurch mal eben ein, zwei Akkus aufknacken
- "Putzen": hat man bei eBike-Akkus die Zellen erstmal aus den Plastikhaltern befreit sind diese idR außenrum sauber und ohne Klebereste.
Bei meinen Laptop-Akkus sind über 50% der Zellen rundherum eingesaut mit verschiedenen Superklebern, Silikon, Klebepads etc.pp. Das ist richtig Aufwand, die zu säubern und nicht selten gehen dabei die Hüllen kaputt.
eBike-Akkus sind auch manchmal untereinander verklebt aber so selten, dass ich dazu übergegangen bin die verklebten Akkupacks bei eBay zu verkaufen, da mir der Aufwand zu hoch ist.
- Entsorgungsaufwand: bei Laptop-Akkus fällt durch die vielen Einzelverpackungen mehr Müll an als bei eBike-Akkupacks, zudem kamm man kaum etwas anderes als die Zellen wiederverwerten (privat).
Bei eBike-Akkus sind ab und an mal das BMS, die Plastik-Zellhalter oder das Gehäuse selbst noch brauchbar, oder so Kleinzeugs wie Schalter und Ladebuchse. Die Anzahal zu entsorgender Laptop-Zellen ist auch recht hoch.
Inhaltsverzeichnis:
- 1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)
- 2 Idee + Plan
- 3 Akku-Arbeitsplatz
- 4 eBike Akku Komponenten
- 5 eBike Akku zerlegen
- 6 Laptop Akkus zerlegen
- 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte
- 8 neue Hülle für 18650
- 9 China-Akkutest
- 10 Werkzeuge + Messgeräte
- 11 Null-Watt Einspeisung
- 12 Modbus / RS485 Adapter
- 13 BMS + Balancer
- 14 aktiv Balancer BMS - JKBMS
- 15 Ladegeräte + Kapazitätstester
- 16 kpl. Akkupacks testen
- 17 Innenwiderstand Ri
- 18 Solar Laderegler
- 19 Wechselrichter, Inverter
- 20 Löten - Anleitung für Akkus
- 21 Schlüsselanhänger aus 18650
- 22 Sicherheitskonzept
- 23 Akkus Beschaffung - wie und wo?
- 24 WVC / SG / GMI / PVGS Mikroinverter
- 25 Schritt-für-Schritt zur 18650 Powerwall
- 26 ATS - Automatic Transfer Switch
- 27 Schottky Sperrdioden für Parallelschaltung
- 28 Balkonsolar & Balkonkraftwerk
- 29 Hybrid Wechselrichter einrichten
7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte
Wie unter 3 Akku-Arbeitsplatz bereits angekündigt ging mir dieses Kabel- und Netzteilechaos der Ladegeräte auf den Keks.

Mittlerweile habe ich ein altes PC-Netzteil umgebaut und betreibe damit insgesamt 15 Ladegeräte - ohne Probleme.

Falls das jemand mal nachbauen möchte hier nun eine bebilderte Anleitung. Das ist ein normales ATX-Netzteil von Delta. Mit 300 Watt absolut nichts besonderes, für 1€ + 6€ Versand bei eBay erstanden. Andere Marken wie Enermax oder Seasonic sind auch zu empfehlen.

Wieso das alles? Nun, meine Akku-Ladegeräte benötigen 12V (die LiitoKala Lii500) und 5V (die XTar VC4 und XTar VC8). Das sind auch generell die gängigen zwei Spannungen von diversen anderen Kleingeräten mit Netzteil bzw. USB als Stromversorgung (USB hat 5V).
Und PC-Netzteile sind billig, für den Dauergebrauch konzipiert und liefern beide benötigten Spannungen. Zusätzlich auch noch 3,3V
Mein Netzteil ist ein Marken-Netzteil von Delta. Kein geläufiger Name sondern eher im OEM Markt anzutreffen, aber die sind spezialisiert auf den Bau von Spannungswandlern und Invertern aller Art, inkl. Server-Netzteile, Schweißgeräte, Photovoltaik-Wechselrichter und Industrieanwendungen.
D.h.: das Netzteil ist für den 24/7 Dauerbetrieb geeignet.
Wichtig: die Angaben zu 5V und 12V, zu finden auf dem Typenaufkleber.
Vorsicht bei noname und Pseudomarken wie LC-Power: die geben oft sehr hohe Systemleistungen an, wobei die einzelnen Stränge nie alle gleichzeitig voll belastet werden dürfen. So habe ich auch ein LC-Power mit 420 Watt, welches aber rund 1/3 niedrigere Ampèrezahlen auf der 5V und 12V Schiene leistet als das schwächere Delta mit nur 300W.

da ich den dicken Kabelbaum mit den vielen PC-Steckern so nicht verwenden kann muss ich die Stecker, so wie ich sie brauche neu anklemmen / anlöten.
Und um die überflüssligen Kabel los zu werden schneide ich sie nicht einfach außerhalb des Gehäuses ab, sondern im Innern. Dazu muss man das Gehäuse aufschrauben.
ACHTUNG LEBENSGEFAHR: war das Netzteil kurz vorher eingesteckt gewesen besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag, weil die großen Pufferelkos noch eine ganze Weile Strom gespeichert haben.
Aber ich hatte das Netzteil mehrere Tage ohne Nutzung rumliegen, dann ist der Strom aus den Elkos verpufft

zuerst den dicken ATX Mehrfachstecker ab, den brauche ich nicht
. 
das grüne Kabel ist wie ein zweiter Anschalter des Computer-Netzteiles. Wenn man am PC den Power-Knopf drückt dann schließt das Mainboard dieses grüne Kabel gegen Masse. Bedeutet: man muss entweder einen manuellen Schalter einbauen oder, so wie ich, permanent mit Masse (= beliebiges schwarzes Kabel) verbinden.
Dann geht das Netzteil an, sobald man den 230V Stecker einsteckt.
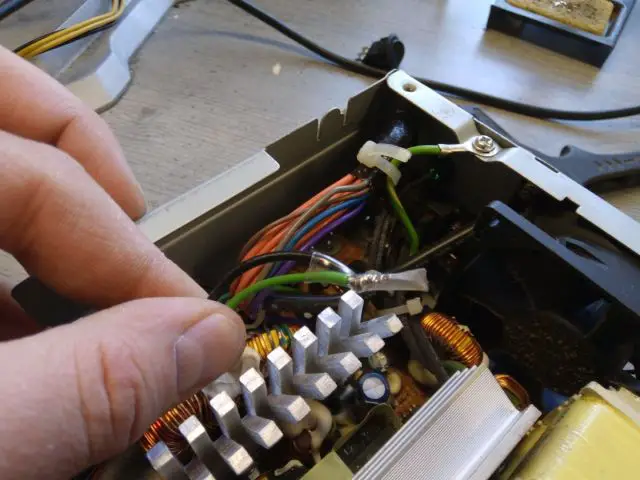
hier mal die komplette Belegung / Farbkodierung des ATX Netzteilsteckers.
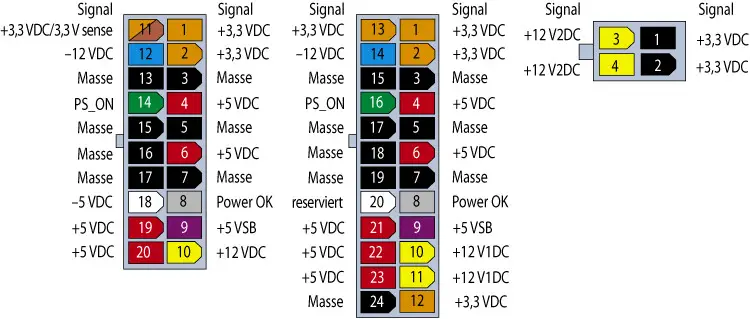
Ich habe alle Kabel so kurz es ging abgeschnitten (und die Enden abisoliert) mit Ausnahme von:
- PS_On
- Masse
- +5V
- +12V
da ich später mein Netzteil flexibel um mehr oder weniger Anschlüsse für verschiedene Ladegeräte erweitern möchte benutze ich Lüsterklemmen an den orig. Kabeln des Computernetzteils

dann löte ich USB-Buchsen an einzelne Litzen mit je ca. 25cm Länge. Später fasse ich immer 4 Buchsen zusammen und verbinde sie mittels Lüsterklemme mit einem Netzteil-Kabel

da die von mir gekauften Buchsen nur für sehr dünne Koaxialkabel vorgesehen sind muss ich den Schaft etwas aufbohren, damit mein zweiadriges Kabel durch passt

Hinweis: ich würde euch empfehlen, einen alten USB-Stecker mit ein wenig Kabel ab zu schneiden und zum Testen der neu angelöteten Buchsen zu verwenden.
Es empfiehlt sich eher nicht, direkt mit den Messspitzen des Multimeters in die USB-Buchse zu stechen, da ist so wenig Platz, dass ein Kurzschluss vorprogrammiert ist. Deswegen das abgeschnittene USB Kabel, da kann man bequem an den Litzen messen.
Ich hatte beim Löten 1x aus Versehen die Polung vertauscht, und bei einer Buchse ist ab Wert die Polung verkehrt, da hat offensichtlich beim Zusammenbau jemand gepfuscht. Ohne Testen wäre mir das nicht aufgefallen und vermutlich hätte ich dadurch gleich zwei teure Ladegeräte geschrottet

dann die 2,5mm Stecker an 12V für die LiitoKala Lii500 Ladegeräte

gibt es abgewinkelt und gerade

fertig sieht das bei mir nun so aus


ganz links das kleine 2er Nitecore i2 läuft eigenständig über 230V, ansonsten werden alle 15 Ladegeräte = 74 Ladeslots nun von einem einzigen Netzteil versorgt.
Ohne Probleme.
An warmen Tagen und wenn alle Slots frisch bestückt wurden und gleichzeitig laden schaltet der Lüfter des Netzteiles auf die zweite Geschwindigkeitsstufe und es kommt lauwarme Luft raus, wobei die Temperatur unter 30°C bleibt.

Fazit: Der Aufwand des Umbaus und die Geldinvestition haben sich (für mich) sehr gelohnt. Keine 15 Netzteile mehr, keine überhitzten China-USB-Ladegeräte mehr und ein weitaus sichereres Gefühl, da das ATX-Netzteil diverse Schutzschaltungen hat und Dauerbetrieb- und llastfest ist.
- Kosten: 7€ Netzteil + ca. 1€ je angelötetem Stecker = 30€ insgesamt
- Zeit: ~2h Kabel abisolieren und Stecker anlöten
Inhaltsverzeichnis:
- 1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)
- 2 Idee + Plan
- 3 Akku-Arbeitsplatz
- 4 eBike Akku Komponenten
- 5 eBike Akku zerlegen
- 6 Laptop Akkus zerlegen
- 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte
- 8 neue Hülle für 18650
- 9 China-Akkutest
- 10 Werkzeuge + Messgeräte
- 11 Null-Watt Einspeisung
- 12 Modbus / RS485 Adapter
- 13 BMS + Balancer
- 14 aktiv Balancer BMS - JKBMS
- 15 Ladegeräte + Kapazitätstester
- 16 kpl. Akkupacks testen
- 17 Innenwiderstand Ri
- 18 Solar Laderegler
- 19 Wechselrichter, Inverter
- 20 Löten - Anleitung für Akkus
- 21 Schlüsselanhänger aus 18650
- 22 Sicherheitskonzept
- 23 Akkus Beschaffung - wie und wo?
- 24 WVC / SG / GMI / PVGS Mikroinverter
- 25 Schritt-für-Schritt zur 18650 Powerwall
- 26 ATS - Automatic Transfer Switch
- 27 Schottky Sperrdioden für Parallelschaltung
- 28 Balkonsolar & Balkonkraftwerk
- 29 Hybrid Wechselrichter einrichten
8 neue Hülle für 18650
Gerade beim Zerlegen von Laptop-Akkus kommt es unweigerlich vor, dass die Hülle bzw. der Mantel der 18650 Akkuzellen beschädigt oder komplett zerfleddert wird,
aber auch bei eBike-Akkus, bei denen die Zellen mit Superkleber oder Silikon miteinander verklebt wurden.

Das kann ganz schön gefährlich werden, denn an der Oberseite sind Pluspol (= der kleine runde Kontakt) und Minuspol (= alles andere an der Zelle, d.h. Boden, Seiten, oberer Rand) sehr dicht beieinander.

Aus diesem Grund bietet es sich an, Akkuzellen mit defekter Hülle neu "ein zu kleiden".
Das geht recht einfach, denn die Hülle ist nichts weiter als ein Stück Schrumpfschlauch. Und die gibt es als 10, 50er oder 100er Packen bereits passend zugeschnitten extra für ebendiese 18650 Akkuzellen.
In vielen unterschiedlichen Farben und für etwa 2€ / 100 Stück, z.B. auf Aliexpress oder bei eBay -> 18650 Schrumpfschlauch
Dazu die passenden Kleberinge und als Halter, damit die Zellen nicht umkippen Minimagnete
Hier eine kleine Anleitung, wie man 18650 Zellen mit einer neuen Schrumpfschlauch-Hülle ausstattet.
Zuerst die alte Hülle vollständig ablösen. Den oberen Isolatorring aufheben, den brauchen wir noch.
Vorsicht beim lagern: am besten die "nackten" Akkuszellen ordentlich in Reih und Glied legen, damit der Pluspol nirgends drankommen kann. Zudem Unterseite an Unterseite oder, noch besser, mit Papp-Trennstreifen zwischen zwei Reihen.
Pass da echt auf, ohne Schutzhüllen sind die Akkus sehr empfindlich!

falls Du keine Isolatorringe mehr hast weil sie verloren oder kaputt sind musst Du zwingend neue kaufen. Am besten finde ich diese selbstklebenden. Gibt es ebenfalls auf Aliexpress oder eBay für etwa 1€ / 100 Stück. In der Suche dann "18650 Isolator" oder "18650 Isolation ring" eingeben. Tipp: auf Aliexpress ist Akkuzubehör aller Art in der Regel günstiger als auf eBay oder Amazon.
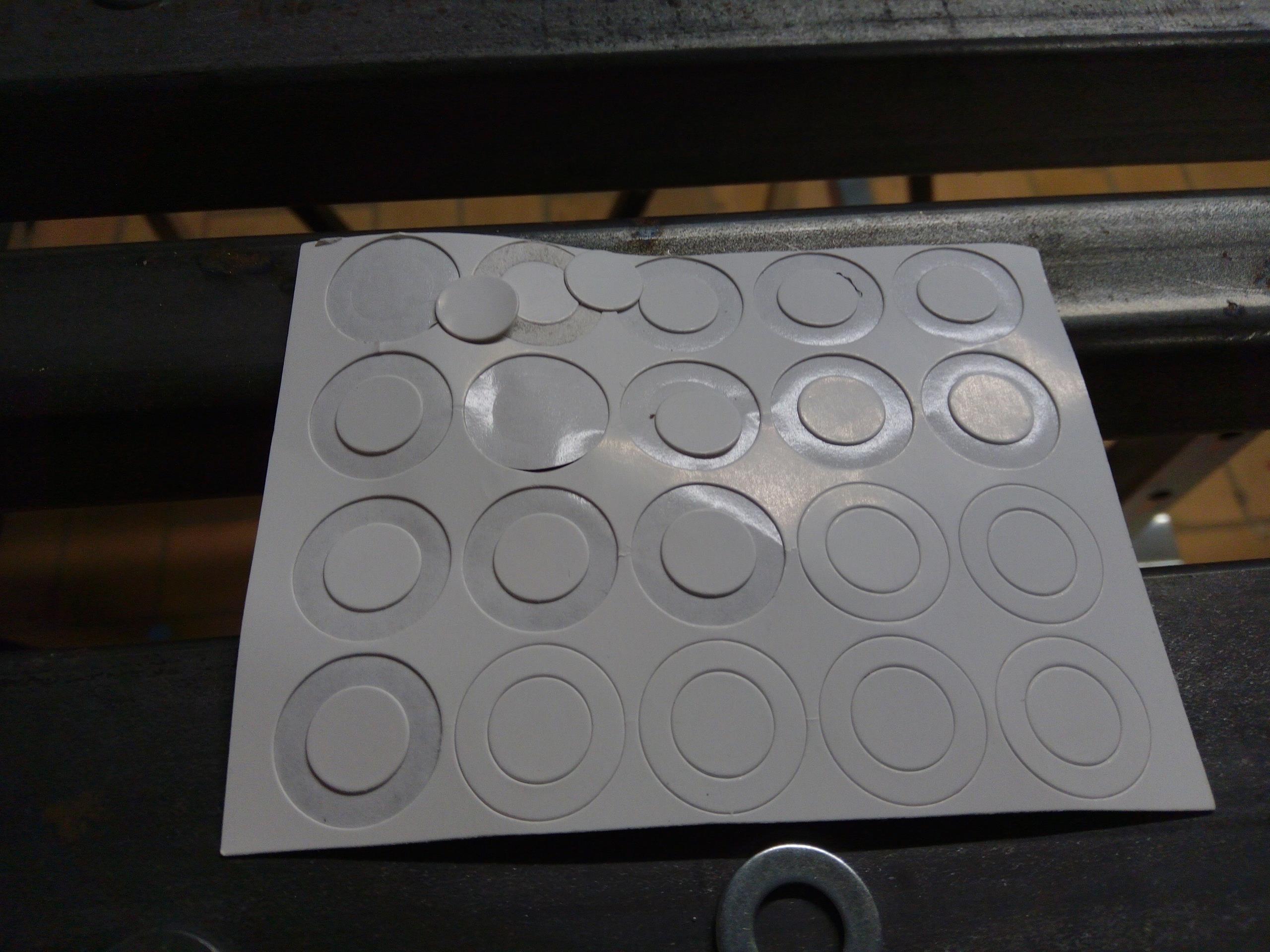
oben um den Pluspol herum aufkleben

die selbstklebenden haben den Vorteil, dass sie sich später beim Schrumpfen des Schrumpfschlauches nicht mehr verschieben oder gar ganz weghüpfen können

dann die Unterseite kontrollieren. Ich zumindest entferne die Nickelstreifen an der Unterseite in der Regel nur grob. Das ist normalerweise auch nicht schlimm, aber hier wird es gleich stören. Also soweit es irgendwie geht das Nickel abmachen. Was auch hilt, wenn man die letzten paar Krümel nicht ab bekommt: die Akkuzelle (mit Gefühl) ein, zwei Mal auf eine glatte Unterfläche aufklopfen, sodass die Nickelreste zumindest schön glatt werden, da wir einen ebenen Akkuboden brauchen. Wieso, das wird im übernächsten Schritt erklärt.

so vorbereitet nehmen wir eine neue Schrumpfschlauch-Hülle.
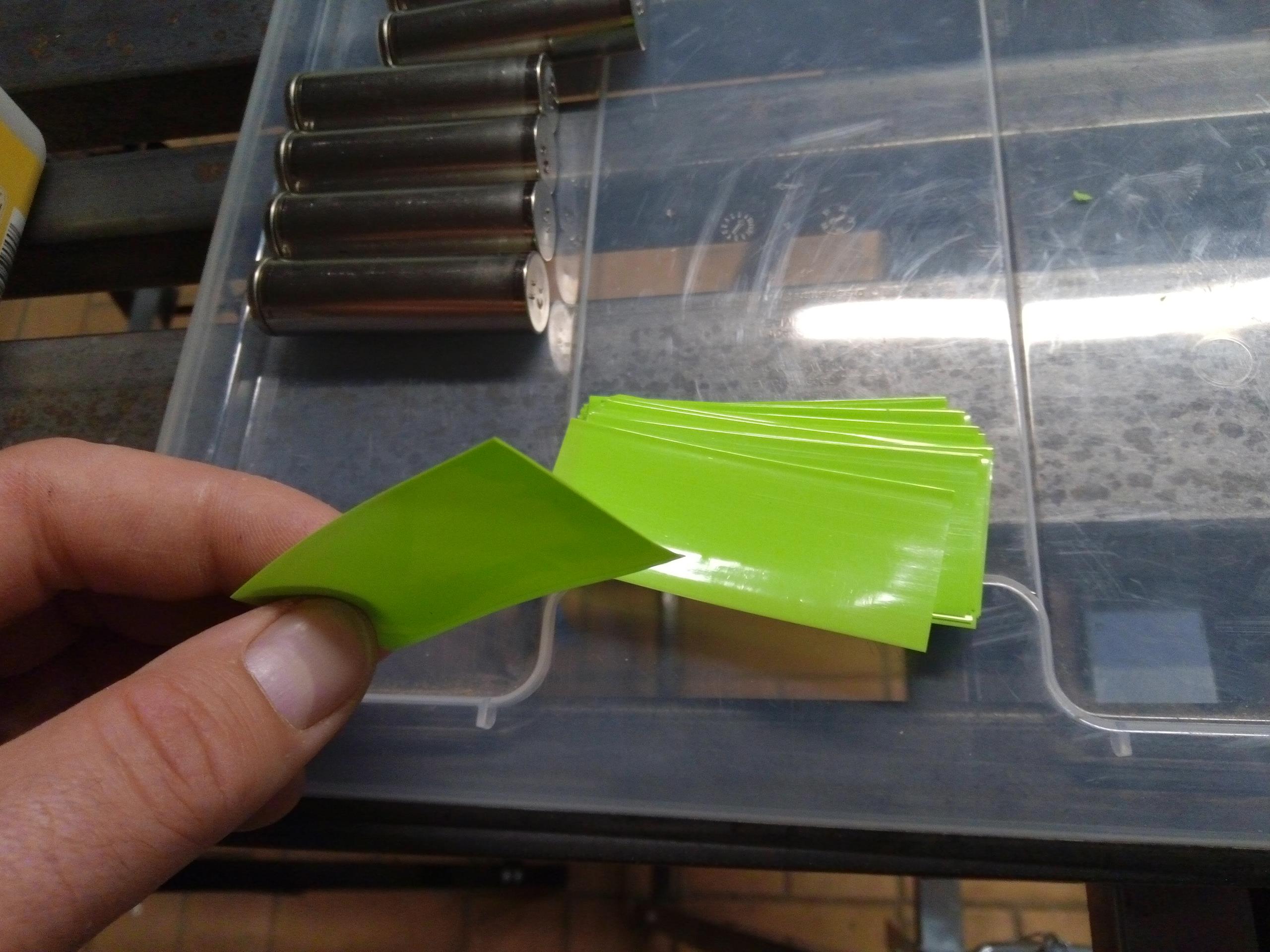
Zwischen den Fingern reiben, bis sich die beiden Hälften voneinander lösen und auffalten. Es reicht, wenn eines der beiden Ende etwa so weit aufsteht, wie auf dem Bild

Akku in die Hülle schieben. Welches Ende, ist egal

schieb sie soweit durch, bis die Hülle etwa bündig ist mit dem Akkuboden, lass die Hülle nicht darüber hinaus ragen, eher etwas weniger so wie auf dem Bild

dann brauchst Du Unterlegscheiben (z.B. für 6mm oder 8mm Schrauben) als Abstandshalter, sowie eine hitzefeste Unterlage.
Idealerweise ein Schweißertisch oder eine Tischplatte aus Stein oder mit Fliesen, soetwas in der Art.
Eine robuste Werkbank geht zur Not auch, wenn man nur eine handvoll Zellen neu einschrumpfen will.
Nachtrag: besser geht das anstatt mit U-Scheiben mit Mini-Magneten

stell die Zelle auf eine Unterlegscheibe und schiebe dabei die Hülle ganz runter bis auf die Unterlage, sodass sie nun etwas übersteht

wenn Du mehrere Zellen schrumpfen willst dann lasse etwa 5 - 10cm Abstand dazwischen

zum Schrumpfen des Schrumpfschlauches benötigst Du eine Heißluftpistole oder "Air Gun" mit etwa 2.000 Watt. Kostet neu bei eBay rund 15€

damit rundherum den Schrumpfschlauch aus etwa 20cm Entfernung kurz heiß machen. Und zwar so wie auf dem Bild:
- unterhalb der Oberseite anfangen und zuerst die lange Seite schrumpfen, dann die Oberseite
- weiter zum nächsten
- zum Schluss dann die Gegenüberliegende Seite schrumpfen
- dabei darauf achten, dass man die untere Kante immer gut erwischt, damit diese nicht überstehen bleibt
- die Oberseite niemals zuerst schrumpfen, da sonst der Schrumpfschlauch unschön bis über den Pluspol ragt

sollte dann so aussehen

der kleine Rand, den wir durch die Unterlegscheibe überstehen liesen hat sich nun um den Boden herum gelegtund verhindert ein Verrutschen der Hülle.
Wenn die Nickelreste nicht sauber entfernt wurden fällt die Akkuzelle um, sobald man den unteren Rand erhitzt, und wirft dann ggf. alle benachbarten Zellen wie Dominosteine mit um, deswegen darauf achten, dass der Zellenboden glatt ist.

das war's, jetzt ist die Zelle äußerlich wieder wie neu.
Tipp: Schwarz als Hüllenfarbe gibt es auch und sieht zwar cool aus, aber es erschwert doch ungemein eine Beschriftung im Nachhinein, also ggf. lieber eine andere Farbe benutzen

Inhaltsverzeichnis:
- 1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)
- 2 Idee + Plan
- 3 Akku-Arbeitsplatz
- 4 eBike Akku Komponenten
- 5 eBike Akku zerlegen
- 6 Laptop Akkus zerlegen
- 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte
- 8 neue Hülle für 18650
- 9 China-Akkutest
- 10 Werkzeuge + Messgeräte
- 11 Null-Watt Einspeisung
- 12 Modbus / RS485 Adapter
- 13 BMS + Balancer
- 14 aktiv Balancer BMS - JKBMS
- 15 Ladegeräte + Kapazitätstester
- 16 kpl. Akkupacks testen
- 17 Innenwiderstand Ri
- 18 Solar Laderegler
- 19 Wechselrichter, Inverter
- 20 Löten - Anleitung für Akkus
- 21 Schlüsselanhänger aus 18650
- 22 Sicherheitskonzept
- 23 Akkus Beschaffung - wie und wo?
- 24 WVC / SG / GMI / PVGS Mikroinverter
- 25 Schritt-für-Schritt zur 18650 Powerwall
- 26 ATS - Automatic Transfer Switch
- 27 Schottky Sperrdioden für Parallelschaltung
- 28 Balkonsolar & Balkonkraftwerk
- 29 Hybrid Wechselrichter einrichten
9 China-Akkutest
Wieso sich eigentlich die Mühe machen und gebrauchte Laptopakkus und eBike Akkupacks zu zerlegen, wenn es neue 18650 LiIon Akkus mit riesigen Kapazitäten um 9.900mAh für etwa 1€ pro Stück aus China gibt?
Bei Amazon, eBay und Aliexpress gibt es sie zuhauf und haben dann vielversprechende Namen wie Trustfire, Ultrafire, GTF, GTL, Skywolf, Dolidada, YCDC und wie sie alle heißen.

Nun, gegen diese Akkus aus China spricht ein einziger Hauptgrund: aktuell (2020) technisch möglich sind keine Kapazitäten über 3.500mAh.
Das geht einfach nicht. Die großen Markenhersteller wie LG, Samsung, Sanyo/Panasonic, Sony stecken allesamt an der Grenze von 3.500mAh fest. Schon seit mehreren Jahren.
D.h.: jeder Hersteller oder Verkäufer der behauptet, seine Zellen haben 9.900mAh versucht euch zu betrügen.
Nun könnte man meinen "OK, dann haben sie eben keine 9.900mAH aber selbst wenn es um die 3.000mAh sind ist es noch immer ein guter Preis."
Um der Sache auf den Grund zu gehen und da man im Internet kaum echte Infos über diese billigen 18650er Zellen aus China findet habe ich selbst 62 Chinaakkus (20 unterschiedliche Modelle von 10 Herstellern) bestellt und einen großen Test durchgeführt
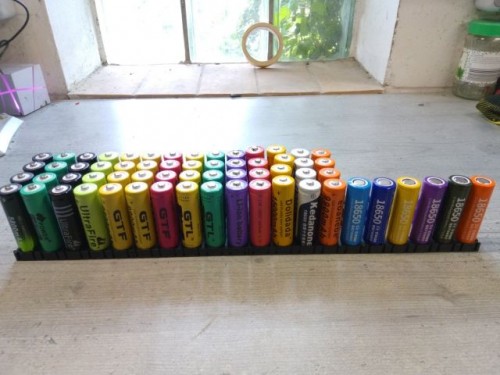
Hier geht es zum ausführlichen Test mitsamt Auswertung -> China-Akku 18650 Test - 509.600 mAh in 62 Zellen
Inhaltsverzeichnis:
- 1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)
- 2 Idee + Plan
- 3 Akku-Arbeitsplatz
- 4 eBike Akku Komponenten
- 5 eBike Akku zerlegen
- 6 Laptop Akkus zerlegen
- 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte
- 8 neue Hülle für 18650
- 9 China-Akkutest
- 10 Werkzeuge + Messgeräte
- 11 Null-Watt Einspeisung
- 12 Modbus / RS485 Adapter
- 13 BMS + Balancer
- 14 aktiv Balancer BMS - JKBMS
- 15 Ladegeräte + Kapazitätstester
- 16 kpl. Akkupacks testen
- 17 Innenwiderstand Ri
- 18 Solar Laderegler
- 19 Wechselrichter, Inverter
- 20 Löten - Anleitung für Akkus
- 21 Schlüsselanhänger aus 18650
- 22 Sicherheitskonzept
- 23 Akkus Beschaffung - wie und wo?
- 24 WVC / SG / GMI / PVGS Mikroinverter
- 25 Schritt-für-Schritt zur 18650 Powerwall
- 26 ATS - Automatic Transfer Switch
- 27 Schottky Sperrdioden für Parallelschaltung
- 28 Balkonsolar & Balkonkraftwerk
- 29 Hybrid Wechselrichter einrichten
10 Werkzeuge & Messgeräte
Hier findest Du alle Werkeuge und Messgeräte die Du benötigst, um einen Speicherakku / Powerwall aus gebrauchten Laptop- und eBikeakkus zu bauen,
vom Zerlegen über das Prüfen der Zellen bis hin zum Bau der Akkupacks ist hier alles dabei.
Keine Panik:
Auf den ersten Blick sieht das sehr viel aus, aber ich habe hier wirklich versucht alles auf zu listen und je nachdem welche Arbeitsschritte Du machst brauchst Du vielleicht auch gar nicht alles.
1.) Werkzeug
-> Schraubenzieher etc. zum Zerlegen der Akkus s. eBike Akkus zerlegen

-> Löschstation falls mal ein Akku durch geht s. eBike Akkus zerlegen

Löten:
Du benötigst
- Lötkolben groß + klein
- gutes Lötzinn
- Lötabzug
Achtung!!
LiIonen Akkus löten ist nicht ganz einfach und nicht ganz ungefährlich. Deswegen: bitte nicht einfach wild drauflos löten sondern diesen Abschnitt hier aufmerksam lesen.
Lithium Zellen sind hitzeempfindlich. Werden sie zu heiß, können sie anfangen zu brennen oder gar explodieren.
Dennoch kann man sie löten, wenn man weiß wie.
Die Devise lautet: kurz und heiß
Das bedeutet: der Lötprozess darf nur sehr kurz dauern, maximal 5 Sekunden. Hast Du bis dahin keine gescheite Verbindung dann weg vom Akku, abkühlen lassen, später nochmal probieren.
Besonders kritisch ist das Löten am Pluspol, da direkt darunter der dünne Isolatorring aus Kunststoff sitzt, der den Pluspol vom Gehäse der Zelle = Minus trennt. Wird der Pluspol durch zu langes löten zu heiß schmilzt dieser Isolierring und es entsteht ein Kurzschluss.
Damit das "kurz" klappt brauchst Du entsprechend viel Hitze / Power am Lötkolben. Ich erkläre Dir hier genau, wie und mit welchen Geräten das geht.
Von der Vorgehensweise löte ich die Akkupacks in drei Schritten zusammen.
1. Lötpunkt auf die Akkuzellen setzen, je einen auf den Plus und einen auf den Minuspol -> mit dem großen Lötkolben
2. Kupfer-Busbars auf das Akkupack legen und den Sicherungsdraht zunächst nur an den Akkuzellen anlöten -> kleiner Lötkolben / Lötstation
3. Sicherungsdraht an die Busbar anlöten -> großer Lötkolben

Sicherungsdraht 0,2mm = 5A Belastbarkeit auf eBay1 / eBay2 / eBay3

Lötkolben groß: zum Löten der dicken Kupferverbindungen (Busbars) und Kabelschuhe brauchst Du einen Lötkolben mit Power, da das Kupfer die Hitze sehr schnell ableitet und nicht richtig heiß wird, wenn der Lötkolben nicht stark genug ist.
Hier habe ich zunächst einen billigen 200W Lötkolben für um 22€ ausprobiert (gibt es auf Amazon / eBay unter zig Markennamen) aber die haben alle! eine sehr weiche Lötspitze aus Kupfer, die nach etwa 120 Lötpunkten weg geschmolzen ist.

Ersatzspitzen bekommt man faktisch nicht. Ich habe Ersatzlötspitzen bei 7 unterschiedlichen Händlern bestellt und nun 7 unterschiedliche Spitzen - von denen keine einzige passt.
Mittlerweile nutze ich einen Ersa 150S Lötkolben (erhältlich auf eBay und Amazon)). Der hat 150W und eine filigranere Dauerlötspitze, die sich nicht abnutzt.


Damit lässt sich viel genauer und auch schneller arbeiten, und die Lötspitze verbraucht sich nicht. Weniger Lötzinn braucht man auch.
Um einen Lötpunkt zu setzen dauert das so maximal 2 Sekunden.
Später dann um den SIcherungsdraht an die dicke Kupferbusbar zu löten dauert bei den ersten zwei Lötungen etwas länger, bis das Kupfer mal erwärmt ist, dann aber dauert das auch nur 2 - 3 Sekunden bis das Lötzinn auf der Busbar verläuft. Hier wirklich auf das Verlaufen achten sonst habt ihr hinterher sog. kalte Lötstellen. DIe halten nicht gescheit und können sich wieder lösen
Kleiner Lötkolben:
Hier hatte ich zunächst einen 40W Lötkolben von Ersa genommen. Das geht auch. So halbwegs, ist aber nicht optimal.
Mittlerweile habe ich eine billige Lötstation von eBay. Da gibt's einige ähnliche Modelle um 30€
Meine hat 35W und geht bis 480°C man sieht sie weiter oben beim Bild vom Ersa 150S Lötkolben (erhältlich auf eBay und Amazon) im Hintergrund.
Um den Sicherungsdraht am Pluspol an zu löten stelle ich sie auf 370°C ein, für den Minuspol (= massiver = leitet mehr Hitze ab) auf 400°C.
So dauert der Lötprozess maximal 2 Sekunden.
Lötzinn bzw. Lötdraht:
Spare nicht am Lötdraht. Vergiss Opas Vorkriegs-Lötzinn aus der Kramkiste und besorg Dir gescheiten Lötdraht, dann hast Du unglaublich weniger Stress und Ärger, bis es hält (es kommt hier ja extrem auf eine kurze Lötzeit an - das muss einfach flutschen) und die Verbindung ist hinterher auch sauber / stabil.
Ich benutze ausschließlich Fluitin SN60
Ist mit Blei und daher (seit diesem Jahr) in Deutschland nicht mehr frei verkäuflich. Aber das gibt halt einfach die besten Lötstellen - aber ich empfehle hier dringend einen Ventilator oder eine Lötabsaugung zu benutzen, s. weiter unten.
Das Fluitin gibt es auf eBay-Kleinanzeigen regelmäßig als 1KG Rolle für um 26€ zu finden. Das hat bei mir für 2.500 Zellen gereicht.
Lötabsaugung / Rauchabzug

Gibt es so wie hier auf dem Bild mit Schlauch auf eBay oder Aliexpress
Da mit der breiten Öffnung viel Rauch daneben geht habe ich mir mit Karton + Panzertape eine "Schnute" gebastelt, die genau so breit ist wie meine AKkupacks und so fast 100% wegsaugt

Eine vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Löten von18650 Zellen findet sich übrigens hier im Menü unter ->20 Anleitung - Löten für Akkus
Weitere Werkzeuge:
Feinmechanik-Seitenschneider
Ideal, um Kabellitzen an eBike-Akkus und Laptopakkus durch zu knippsen und um den Sicherungsdraht passend abzuschneiden. Kostet um 4 - 5€ auf eBay oder auf Aliexpress

Teppichmesser
Um Schrumpfschläuche von Akkupacks durch zu schneiden, Silikonreste, oder um dicke Batteriekabel ab zu isolieren.
Ist Geschmackssache, aber ich mag am liebsten die ganz einfachen mit fester Klinge, die sind am stabilsten

10er Ringschlüssel
Ich mache alle wichtigen Verschraubungen (Verbindung zwischen parallelen Akkupacks, BMS, Shunt etc.pp.) mit M6 Schrauben. Und passend dazu sind zwei gescheite 10er Schraubenschlüssel.
Bzw. nutze ich einen normalen Ring-Maulschlüssel und als zweites einen Ratschen-Ringschlüssel von Parkside
Ideal, wenn es mal eng zugeht oder so unzugänglich, dass man nicht so gut ständig nachsetzen kann.

Crimpzange groß/klein
Wenn Du vor hast eine Powerwall zu bauen wirst Du nicht drumherum kommen, mindestens eine gescheite Crimpzange zu kaufen.
Grund: in dem niedrigen Spannungsbereich fallen sehr hohe Ampèrezahlen / Ströme an und bei schlechten Kontakten und Verbindungen zwischen z.B. Kabel und BMS, BMS und Akku, Akku und Kabel etc. entstehen sehr schnell Temperaturen über 100°C und es kommt zum Brand. Daher sind im Hochstrombereich supergute Verbindungen extrem wichtig, und das bekommt man nicht hin, wenn man mit Hammer und Schraubenzieher auf Kabelschuhen drauflos dengelt, oder mit der Rohrzange irgendwie zusammenquetscht. Eine gute Verbindung ist hier lebenswichtig!
1.) für kleine Kabelschuhe, Aderendhülsen, Krokodilklemmen bis 4mm²

Solche Crimpzangen gibt es in der Regel für rund 25€ als Set mit einer Kiste Aderendhülsen sowie mehreren Austausch-Pressbacken für unterschiedliche Pressprofile. Gibt's auf eBay und Amazon
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
Wichtig hier: auf jeden Fall eine Zange nehmen mit Umlenkmechanik, das spart nicht nur Kraft wenn man viele Pressverbindungen machen muss, sondern ist auch ungleich fester als solche einfachen Presszangen, die wie eine Schere ohne Umlenkung konstruiert sind.
Von der Größe her reicht hier 0 - 4mm² Drahtdurchmesser zum Verpressen / Crimpen. Für alles andere braucht man eine große Crimpzange mit mehr Presskraft
2. für Ringkabelschuhe 6 - 50mm²
Das hier ist die günstigste Alternative um große Pressverbindungen richtig fest auszuführen
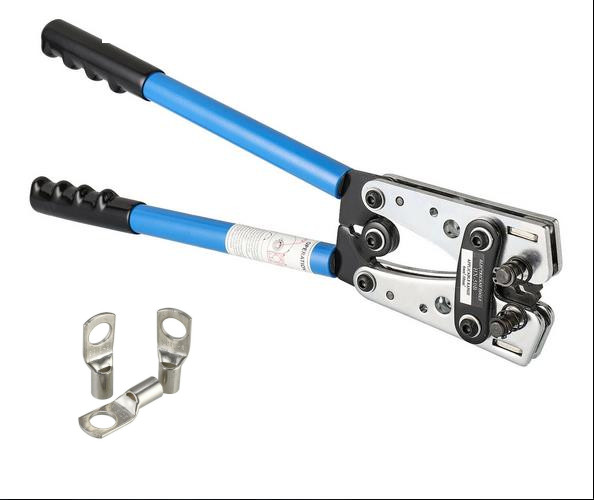
Da die Mechanik wie bei einem Bolzenschneider ausgeführt ist kann man hier enorm viel Pressdruck ausüben. Und genau das ist notwendig, um Ringkabelschuhe für 16mm² oder 32mm² so zu verpressen, dass später im Betrieb keine Hitze durch schlechten Kontakt entsteht.
Praktisch:
Der integrierte Presskopf ist drehbar und es können Kabelschuhe für Durchmesser zwischen 6 und 50mm² verpresst werden.
Tipp:
Gerade beim Bau von Busbars kommt es vor, dass wenn man wenige, dicke Einzeladern verdrillt und mit einem Ringkabelschuh versehen möchte, dass dieser nicht richtig sitzt da durch die wenigen dicken Adern zu viel Luft im Ringkabelschuh ist. Das passiert mir bei meinen typischen Busbars immer bei 3x 2,5mm² -> durch Verlegung in U-Form sind das am Ende des Ringkabelschuhes dann 6x 2,5mm² = 15mm² -> in einem Ringkabelschuh für 16mm² ist dann etwas Luft. Hier kann man bei dieser Presszange auch Zwischenschritte einstellen indem man die eine Presskopfhälfte auf 16mm² einstellt, die andere Hälfte auf die nächstkleinere Stufe also 10mm². Dadurch wird die Pressverbindung ultra-stabil
Diese Zange in der Bauform für 6 - 50mm kostet auf eBay rund 30€
PS: Ringkabelschuhe sind in Deutschland irgendwie sauteuer, und da man beim Bau einer Powerwall recht viele davon braucht lohnt es sich meist, über Aliexpress in China zu bestellen, erstrecht wenn man für unterschiedliche Durchmesser auch verschiedene Größen braucht läuft das schnell ins Geld.

Ich benutze mittlerweile im Grunde nur noch eine einzige Größe und bestelle daher Ringkabelschuhe im 100er Pack, und zwar für 16mm²
- 16mm² Kupferkabel ist geeignet für Ströme bis 60A (Voraussetzung ist, dass die Kabelstrecken kurz = max. 2m sind) und die benutze ich für Powerwalls bis 60 Zellen also 60p. In der Garage habe ich auch ein 100p-System mit 16mm² Kabel, aber das wird mit weniger als 60A belastet
- 32mm² ist geeignet für Ströme bis 120A also ideal für große Packs bis 120p. Wenn man die Busbar allerdings ebenfalls in U-Form ausführt (ich baue die dann in 4x 4mm² und durch die U-Form dann doppelt also 32mm² Gesamtdurchmesser) passen die am Ende nicht in einen 35mm² Ringkabelschuh. Deswegen benutze ich hier dann für jedes der beiden 4x4mm²-Ende einen separaten 16mm² Ringkabelschuh
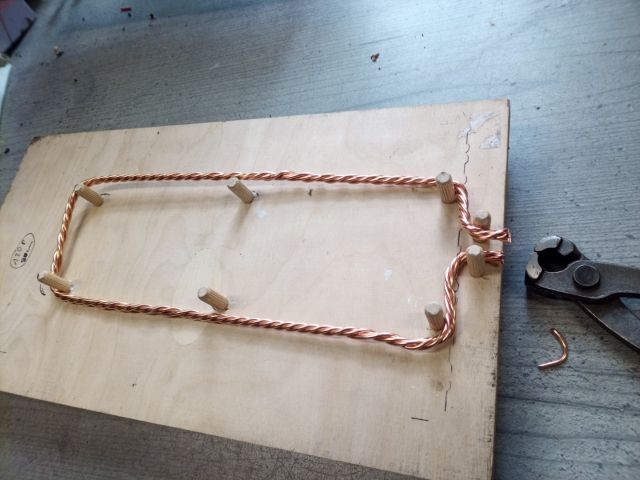
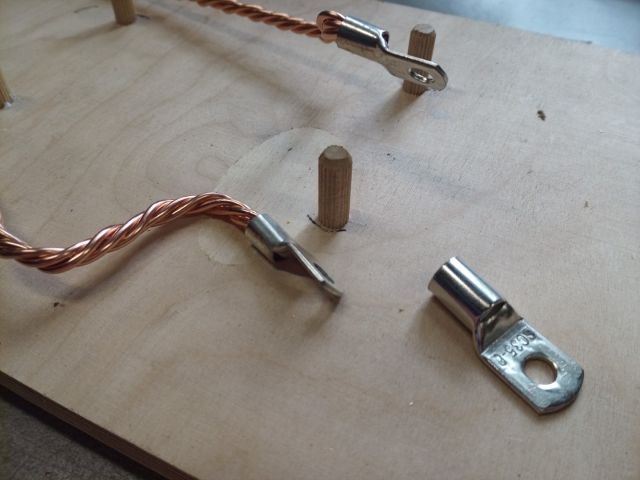
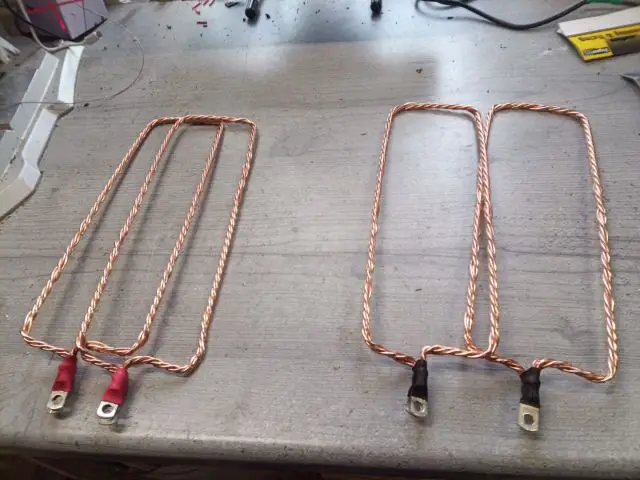
Siehe auch hier
- KW45 - 120p Akkupacks löten
- KW46 - 14s120p Solarakku1
- KW52 - DIY Tesla-Powerwall 16s100p
- KW53 - Aiways U5, DIY Tesla-Powerwall 16s100p
Die Bezeichnung hier ist "SC16-6" und steht für "16mm Kabeldurchmesser / Bohrloch für 6mm Schrauben).

Ich benutze für alle Verschraubungen M6 Schrauben. Es gibt auch Ringkabelschuhe mit 8mm und 10mm Löchern, dann entsprechend bei Aliexpress suchen nach "SC16-8" oder bei anderen Wunschgrößen entsprechend nach "SC35-10" o.ä.
Im 100er-Pack kosten die SC16-6 rund 14€ inkl. Versand, passen ideal für
- 3x 2,5mm² Busbars doppelt
- 4x4mm² Busbars einfach
- 16mm² Kupferkabel / Batteriekabel
- 7AWG Kabel der gängigen BMS (AWG = amerikanische Angabe für Kabeldurchmesser). Achtung: die 7AWG passen zwar gerade so in die 16mm² Ringkabelschuhe und man müsste meinen, dass das nach dem Pressen super sitzt, aber dadurch dass an den BMS in der Regel Kabel angelötet sind mit super-feinen Litzen sind die irgendwie schon fast rutschig / glitschig. Daher zwei Möglichkeiten: 1.) zusätzlich mit dem Ringkabelschuh verlöten, was zumindest mit meinem 150W Lötkolben nicht möglich ist da die Wärme zu schnell abgeführt wird. "Früher" mit meinem billigen Chinalötkolben mit 300W ging das. 2. auch hier verpressen mit einer Presskopfhälfte eingestellt auf 16mm und die andere auf 10mm
2.) Messequippement
Nach dem Zerlegen willst Du sicherlich prüfen, ob die gewonnenen Akkuzellen noch brauchbar sind und in welchem Zustand genau sie sich befinden.
Dazu benötigst Du ein paar Messgeräte.
1.) Kapazitätstester
Das, was man als wichtigstes wissen möchte ist ja, wieviel nutzbare Restkapazität haben die gebrauchten Akkuzellen denn noch. Dazu gibt es etwa eine handvoll Ladegeräte, die eine eingebaute Kapazitäts-Testfunktion besitzen

zum Thema Kapazitätstests findest Du einen eigenen Punkt im Menü -> 15 Ladegeräte & Kapazitätstester
2.) Standard-Messgeräte:

keine Panik, von all den Geräten auf dem Bild brauchst Du lediglich eines zwingend, und zwar das blau-schwarze "Vapcell YR-1030" (eBay und Amazon)
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
Neben der nutzbaren Kapazität gibt es noch zwei weitere Kennzahlen, die Dir den Zustand einer Li-Ionen Zelle offenbaren
- Spannung
- Innenwiderstand
Das Vapcell kann beides messen. Zwar kann das auch jedes einfache Multimeter (Bild r.o.) aber der Innenwiderstand von LiIo Zellen ist so gering, dass Multimeter diesen nicht messen können
Innenwiderstand: 70mOhm
Für die Verwendung in einer Solarakku-Powerwall wird als Grenzwert für den Innenwiderstand oftmals 70mOhm genommen.
Je niedriger desto besser, darüber ist es ein Zeichen, dass die Akkuzelle schon viel geleistet hat und sich ggf. selbst enladen wird oder beim laden / Entladen stark erhitzen wird. Das alles wollen wir nicht haben.
2,5 Volt
Bei der Spannung gilt: liegt diese bei einer LiIon Zelle unter 2,5V spricht man von Tiefenentladung. Ist eine Akkuzelle in Benutzung so sinkt ihre Spannung von anfänglichen 4,20 Volt langsam immer weiter. Üblicherweise wird bei 2,8V das gerät dann automatisch abgeschaltet um zu verhindern, dass die Akkuzelle noch weiter entladen wird und die Spannung noch weiter sinkt, denn Tiefenentladung kann die Zelle schädigen.
Je tiefer die Spannung, desto schlimmer der Schaden, und je länger die Zelle in einem tiefenentladenen Zustand liegt, desto schlimmer der Schaden. Das merkt man dann auch teilweise an einem steigenden internen Widerstand und ist oft bei Laptop Akkus zu beobachten, die schon länger rumliegen.
Es gibt Szenarien die aufzeigen, dass tiefenentladene Zellen irgendwann einen internen Kurzschluss entwickeln und sich entzünden können.
Ich habe hauptsächlich eBike Akkus in Benutzung, die den Weg aufgrund eines Defektes zu mir gefunden haben. In etwa 90% der Fällen war das BMS defekt und hat ein Abschalten des Akkus verhindert. D.h. der Fahrer ist so lange weiter gefahren, bis der Akku restlos leer war. Das Akkupack wurde somit 1x tiefentladen, die Restspannung liegt dann üblicherweise bei um 0,78V.
Ich lade diese Akkuzellen dann mit meinen XTar VC8 Ladegeräten per Reaktivierungsfunktion und danach zeigen die Akkuzellen allesamt! keine verschlechterten Werte. Der Innenwiderstand ist niedrig (meist um 35mOhm), die Kapazität liegt oftmals noch zwischen 90% und 100% der ursprünglichen Werksangaben.
Doch viele der DIY Leute sortieren Zellen, die unterhalb 2,5V liegen rigoros aus.
weitere Messgeräte auf dem Bild:
- ein ordentliches Multimeter ist immer gut, auch um mal einen Vergleichswert zum Vapcell YR-1030 zu haben (rund 20€)
- Infrarot-Thermometer: kostet um 15€ auf eBay und ist gut um zu prüfen, ob die Zelle während des Ladens / Entladens übermäßig heiß wird (über 60°C)
- Mini-Waage: hilft, um chinesische Fake-Zellen zu erkennen, die in der Regel entschieden leichter sind als Markenzellen (5€)
- Zangen-Ampèremeter: erst später interessant um zu prüfen, wieviel Strom durch ein fertiges Akkupack fließt. Dazu einfach die "Klammer" (Zange) um das Stromkabel schließen, die Messung erfolgt berührungslos. Achtung: die meisten günstigen Zangenamèremeter können bloss AC Wechselspannung messen, hier bietet sich das "UT 203" an (um 35€)
3.) Sonstige Messgeräte
3.1 Wärmebildkamera
um Heater-Zellen innerhalb eines Packs besser identifizieren zu können

Ich benutze dazu eine HT-102 (für um 140€ bei Aliexpress), diese wird per USB als Erweiterung an das Smartphone angesteckt.
Das ist eine gängige und sehr günstige Wärmebildkamera mit einer Infrarotbild-Auflösung von 32x32 Pixeln. Das Bild oben wird dann auf die normale Handyauflösung interpoliert, das machen wohl alle Geräte so.

Bei Wärmebildkameras macht die IR-Bildauflösung den Preis aus. Es gibt noch ganz billige für um 40€ mit einer Auflösung von 8x8 Pixeln, aber da erkennt man dann fast nichts mehr.
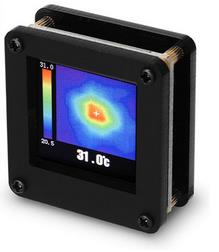
ebenfalls 32x32 Pixel hat dieses Modell für um 130€ auf Aliexpress, dann benötigt man kein separates Handy mehr, kann aber auch nicht mehr so bequem Screenshots machen und direkt weiterverwenden

Richtig gute Geräte gibt es von Flir, aber da ist man auch schnell bei 700€ aufwärts angelangt.
Falls ich mir mal eine bessere Wärmebildkamera zulegen werde dann wird es vermutlich die UniT RX-600
Die kostet zwar auch um 300€ aber bietet für den Preis eine wirklich gute Auflösung und Optionen, Filter, Auto-Temperaturbereichseinstellung und eine PC-Schnittstelle
Aber bis dahin ist meine "günstige" HT-102 ausreichend, um Unregelmäßigkeiten und Hitzeherde zu erkennen
3.2 elektronische Last / electronic Load / Dummy Load
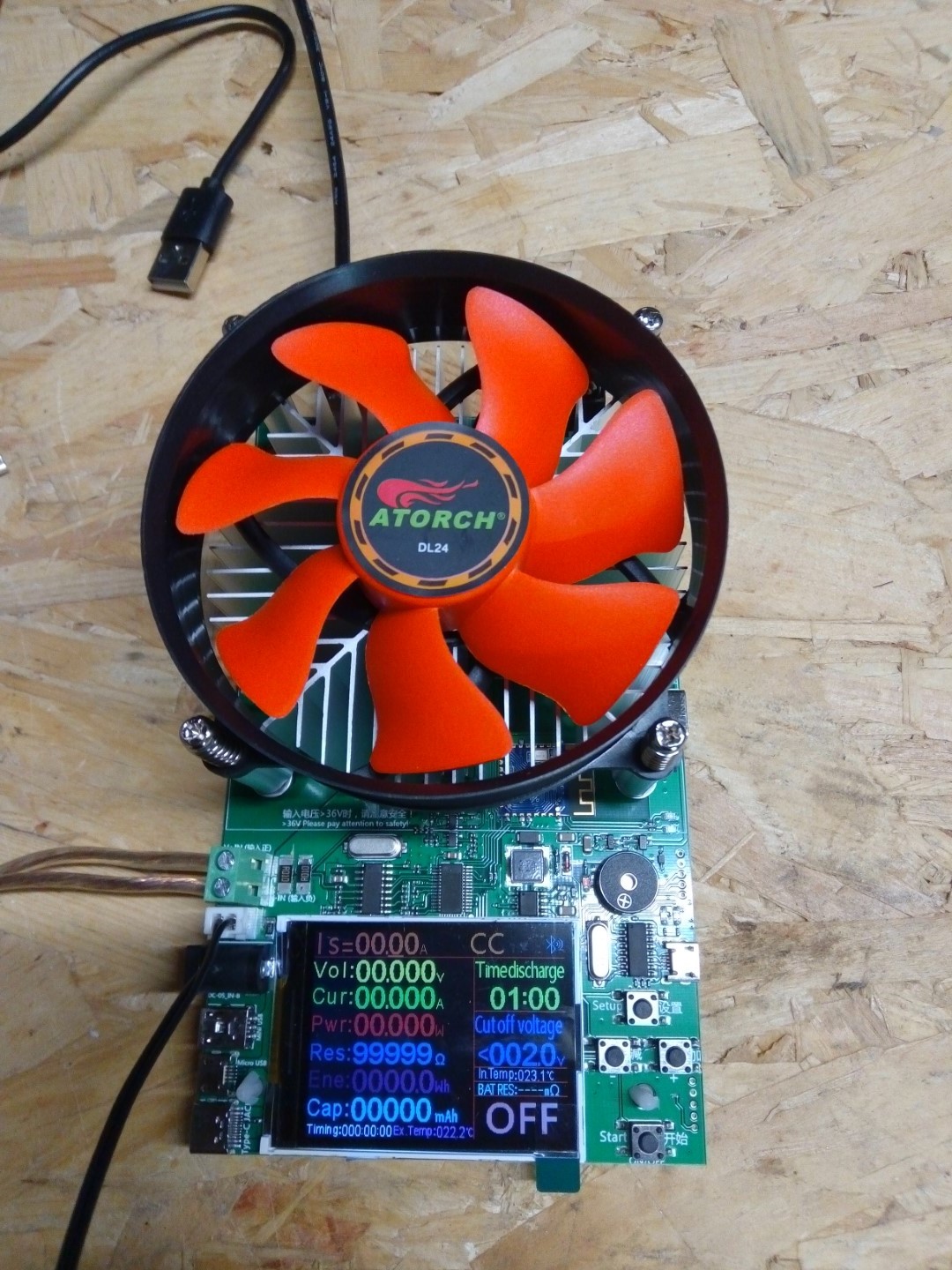
Mit Hilfe einer elektronischen Last kannst Du fertige Akkupacks in ihrer tatsächlichen Gesamtkapazität testen.
Zwar hat man vorher bereits alle Zellen einzeln auf Kapazität getestet und kann das nun einfach alles zusammen addieren, aber
- kann die Gesamtkapazität gerade bei großen Packs dann doch nochmal deutlich variieren
- normale Kapazitätstester lassen sich idR nicht einstellen im Spannungsbereich, in dem sie testen. Meist: 4,20V bis runter zu 2,80V oder gar 2,60V. Da wir unsere Powerwall aber eher in einem schonenderen Bereich zwischen 4,0V und 3,3V nutzen wollen sind auch die Einzelkapazitätswerte nicht aussagekräftig, man sporicht von "Bruttokapazität". Mit einer Elektronischen Last kann man dann den tatsächlichen Spannungsbereich einstellen und erhält dann ein korrektes Ergebnis (= Nettokapazität)
Zur elektronischen Last gibt es einen separaten Punkt im Menü -> 16 Elektronische Last
Inhaltsverzeichnis:
- 1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)
- 2 Idee + Plan
- 3 Akku-Arbeitsplatz
- 4 eBike Akku Komponenten
- 5 eBike Akku zerlegen
- 6 Laptop Akkus zerlegen
- 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte
- 8 neue Hülle für 18650
- 9 China-Akkutest
- 10 Werkzeuge + Messgeräte
- 11 Null-Watt Einspeisung
- 12 Modbus / RS485 Adapter
- 13 BMS + Balancer
- 14 aktiv Balancer BMS - JKBMS
- 15 Ladegeräte + Kapazitätstester
- 16 kpl. Akkupacks testen
- 17 Innenwiderstand Ri
- 18 Solar Laderegler
- 19 Wechselrichter, Inverter
- 20 Löten - Anleitung für Akkus
- 21 Schlüsselanhänger aus 18650
- 22 Sicherheitskonzept
- 23 Akkus Beschaffung - wie und wo?
- 24 WVC / SG / GMI / PVGS Mikroinverter
- 25 Schritt-für-Schritt zur 18650 Powerwall
- 26 ATS - Automatic Transfer Switch
- 27 Schottky Sperrdioden für Parallelschaltung
- 28 Balkonsolar & Balkonkraftwerk
- 29 Hybrid Wechselrichter einrichten
11 Null-Watt-Einspeisung
Unter 0-Watt-Einspeisung (oder auch Nulleinspeisung) versteht man, wenn der durch die Photovoltaikanlage produzierte Strom ausschließlich selbst verwendet und nicht ins Netz eingespeist wird.
Prinzipiell gibt es vier grundlegene Möglichkeiten für eine Photovoltaikanlage
- reiner Inselbetrieb
- Inselbetrieb mit Netzkopplung
- Netzparallelbetrieb
- netzparallele 0-Watt-Einspeisung
1. reiner Inselbetrieb
Man spricht hierbei auch von Off-Grid. Hier sind Wechselrichter und Hausnetz physisch voneinander getrennt.
Typisches Beispiel: ein paar PV-Module auf dem Gartenhausdach, der Wechselrichter versorgt nur die Gartengeräte, Teichpumpe etc.pp und hat keine Verbindung zum Haus.
Hierfür braucht man einen Solar-Laderegler sowie einen Wechselrichter. Es gibt auch Kombigeräte sowie welche, die mit unterschiedlichen Batteriespannungen (12V/24V/48V/96V) arbeiten.
Vorteile:
- preiswert
- einfach in der Umsetzung
- keine Abnahme durch Elektriker & Netzbetreiber notwendig
Nachteile:
- Kein Notstrom durch 230V Stromnetz. Wenn Sonne weg + Batterie leer = Feierabend
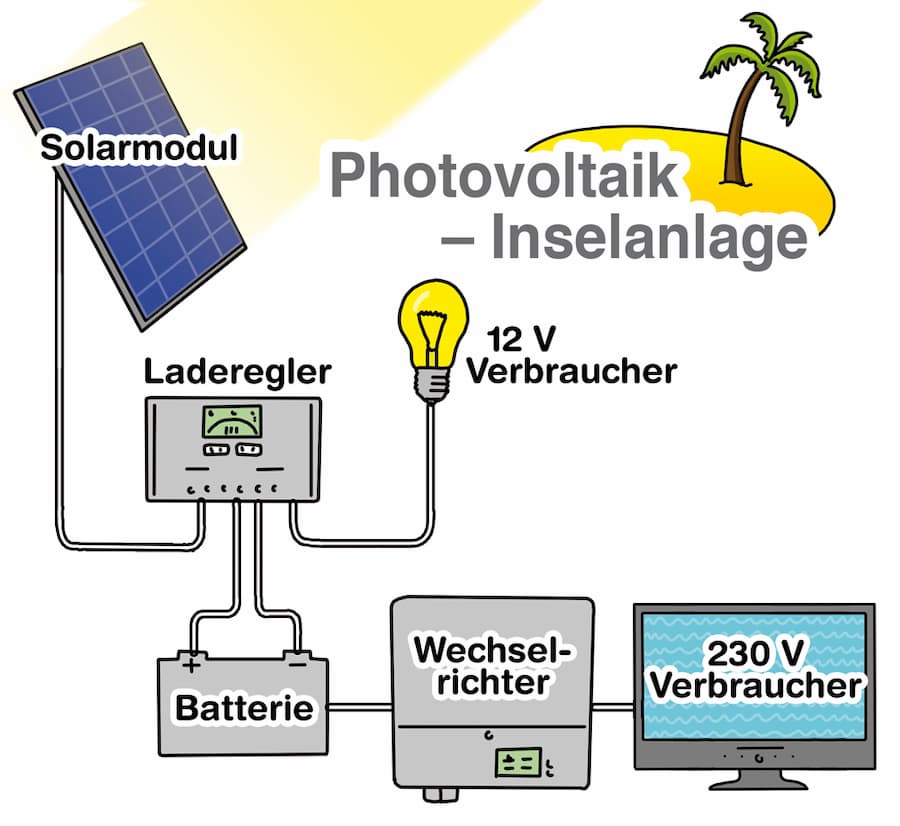
2. Inselbetrieb mit Netzkopplung
Ähnlich wie beim reinen Inselbetrieb, aber hier gibt es einen 230V Netzanschluss quasi als Notfalloption, wenn die PV-Module keinen Strom mehr liefern oder die Batterie leer ist. Der Wechselrichter schleift den Netzstrom dann durch zu den Verbrauchern, ist jedoch technisch nicht in der Lage, PV-Strom ins öffentliche Netz ein zu speisen.
Hierzu braucht es einen sog. Hybridwechselrichter, der diese Funktion unterstützt. Bei MPP Solar wäre das typischerweise die "PIP Serie" oder einer der baugleichen Modelle

Vorteile:
- nutzbar, um das kpl. Haus über eigenen Solarstrom laufen zu lassen
- wenn Sonne weg + Akku leer = Wechselrichter schaltet Netzstrom durch
- noch preiswert (um 600€ für ein 5KW Wechselrichter) z.B. auf eBay oder Aliexpress
Nachteile:
- falls das kpl. Haus über den WR angeschlossen wird ist die maximale Stromleistung begrenzt auf das, was der WR leisten kann (i.d.R. zwischen 3KW und 5KW) --> Backofen + Herd gleichzeitig geht nicht, bei Verbrauchern wie FÖn, Wasserkocher, Waschmaschine, Geschirrspüler etc. muss man immer schauen, was sonst noch gerade so im Haus angeschaltet ist
- wenn der WR mal kaputt geht ist das kpl. Haus ohne Strom da alles durch ihn hindurch geht --> manueller Umschalter ist zu empfehlen
- muss vom Elektriker + Netzbetreiber abgenommen werden, da es per Gesetz keine Inselanlage ist, wenn eine physische Verbindung zum Netz besteht, ganz gleich ob eingespeist werden kann oder nicht. Im Netz findet man einige Berichte von Menschen, die eine solche ANlage nicht anmelden - wohl auch, da es nach außen hin nicht zu erkennen ist da technisch kein Strom eingespeist werden kann. Durch den Energieversorger sichtbar ist lediglich, dass der Stromverbrauch sinkt
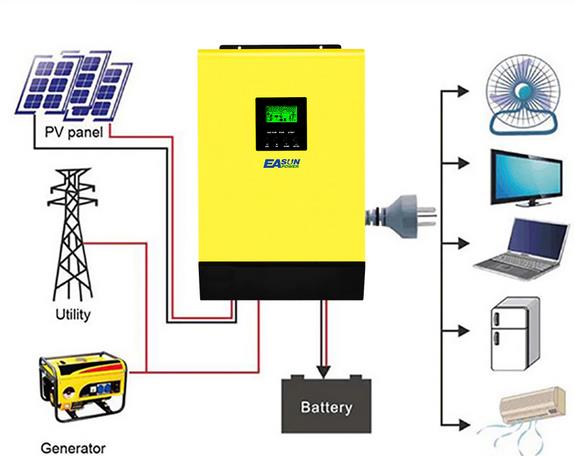
3.Netzparallelbetrieb
Beim netzparallelen Betrieb wird der Wechselrichter parallel zum Hausnetz angeschlossen

(Utility = Stromversorger)
Der WR wird zusätzlich am Zählerschrank / Sicherungskasten angeklemmt und kann hierbei erstmal eine Solarstrom-Überproduktion ins öffentliche Netz einspeisen.
D.h. die Haushaltsgeräte beziehen ihren Strom ganz wie bisher normal aus dem öffentlichen Netz und nichts muss umgeklemmt werden, ist weder Solarstrom noch Batteriestrom da ändert das nichts. Geht der WR kaputt - ändert das nichts.
Für Netzparallelbetrieb benötigt man spezielle WR, die das auch können, z.B.:
- Hybrid Wechselrichter MPI 10k mit 10000 Watt von MPP Solar Infinisolar
- Hybrid Wechselrichter MPI 5.5k mit 5500 Watt von MPP Solar Infinisolar
Vorteile:
- flexibelstes Modell da das Hausnetz unangetastet bleiben kann und WR + PV-Anlage zusätzlich / parallel angeklemmt werden
- keine Belastungsgrenze durch den WR
Nachteile:
- teuer (um 1.000€ für ein 3KW Modell)
- muss zwingend vom Elektriker + Netzbetreiber abgenommen werden. Kann man auch nicht "heimlich" laufen lassen da eine Stromeinspeisung ins öffentliche Netz zumindest bei einem Zweirichtungszähler direkt auffällt
Erfahrungsberichte und Bezugsquellen dieser Hybrid Wechselrichter der MPI Serie findest Du hier:
- Hybrid Wechselrichter MPI 10k mit 10000 Watt von MPP Solar Infinisolar
- Hybrid Wechselrichter MPI 5.5k mit 5500 Watt von MPP Solar Infinisolar
4. netzparallele 0-Watt-Einspeisung
Es gibt nun zwei Möglichkeiten, die Stromeinspeisung auf Null zu setzen.
- generell keine Einspeisung -> kann einfach im Wechselrichter so eingestellt werden, das ist ein einziges Häkchen bei den Optionen
- Einspeisung bei PV-Überschuss = Ja, aber Einspeisung im Akkubetrieb = Nein
Die zweite Option ist die interessantere.
Anschlussschema und Wechselrichtermodell sind identisch wie oben.
Nun möchte man natürlich nicht, dass nachts der "mühevoll" gespeicherte Batteriestrom wieder ins Netz zurück fließt, sondern man möchte ja nur, dass der Eigenverbrauch abgedeckt ist.
Damit der Wechselrichter nun weiß, wieviel Strom er aus den Akkus nehmen und ins Hausnetz einspeisen muss, damit der tatsächliche Verbrauch auf Null geht, benötigt man einen zus. Stromzähler (Energymeter) sowie eine Modbuskarte.
SDM630
Bei Verwendung eines MPP-Solar MPI (oder einem baugleichen Infinisolar der "E" Serie) braucht man dazu zwingend einen Eastron SDM630

Den gibt es in zwei Varianten
- SDM630 Modbus
- SDM630MCT
Bei der ersten Variante muss der Haupt-Stromanschluss des Hauses "durch" den SDM630. Das kann / sollte / muss von einem Elektriker durchgeführt werden.
Der SDM630 misst dann den kompletten Haushaltsstrom und meldet die Verbrauchsdaten dem Wechselrichter zurück.
Liefert z.B. die PV-Anlage gerade 1.000 Watt, im Haus liegt der Verbrauch bei 1.500 Watt dann ist das ein effektiver Verbrauch von 500 Watt.
Diesen Wert meldet der SDM630 dem WR zurück und dieser mischt dann 500W aus dem Akku hinzu, dass in der Summe Null entsteht
-> das ist genau die 0-Watt-Einspeisung
Bei der zweiten Variante, dem SDM630MCT müssen nicht die Hauptleitungen angeschlossen werden, sondern der Zähler wird irgendwo an einem freien Platz im Zählerkasten installiert und drei Klemmen werden an die Hauptleitungen geklippst

Der Eastron SDM630 wird in China produziert und es gibt sie auf eBay oder Aliexpress oder Amazon
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
Modbuskarte
Um den SDM630 mit dem Wechselrichter von MPP Solar verbinden zu können benötigt man eine Erweiterungskarte für den WR, die sog. "Modbus Karte"

die Karte kostet um 90€ und wird unten im Wechselrichter in einen extra Slot für Erweiterungskarten eingesetzt.
SDM630 & Modbuskarte einstellen
Die Kommunikationsschnittstelle zwischen SDM630 und Wechselrichte nennt sich Modbus.
Die ist einfach zu verkabeln aber teils etwas "zickig" und man braucht etwas Geduld, da sie quasi absolut nicht fehlertolerant ist - man muss alles exakt richtig machen sonst geht garnichts, es gibt kein "ein bisschen falsch".
Deswegen möchte ich hier eine kurze Schritt-für-Schritt-Anleitung beschreiben
1.) Modbuskarte einstellen
vor dem Einsetzen der Modbuskarte müssen das Dip-Switch-Terminal (die kleinen Minischalter) überprüft und genau so gesetzt werden, wie auf dem oberen Bild.

das untere Schema ist lediglich für die großen 3-Phasigen Wechselrichtermodelle ab 10kW geeignet, um alle drei Phasen einzeln zu Nullen.
2.) SDM630 einstellen
am SDM630 müssen im Menü noch ein paar Einstellungen vorgenommen werden um die Modbus-Kommunikation mit dem WR ab zu stimmen.
Kurzfassung: Passwort = 0000 / Modbus-ID = 1 / Baudrate = 19.200 (19.2k) / Parity = 0 / Stop-Bit = 1
Langfassung: in diesem Handbuch findest Du alle notwendigen Einstellungen zur Modbuskarte sowie ab Seite 4 auch die zum SDM630
{phocadownload view=file|id=19|target=b}
3.) Verkabelung
Für die Modbus-Datenverbindung brauchen wir zwei Adern.
Idealerweise nimmt man dazu ein Netzwerkkabel. CAT5 / CAT5E / CAT6 / CAT7 passt alles.
Kein "Patchkabel" das ist mit flexiblen litzen und nicht so gut geeignet, sondern "Verlegekabel" für in der Wand zu verlegen, das hat starre Litzen.
Netzwerkkabel ist deswegen ideal, da es perfekt geschirmt ist gegen Störneinflüsse und gerade bei längeren Kabelstrecken empfehlenswert.
Je höher die Zahl desto besser die Schirmung, CAT7 ist derzeit das beste Netzwerkkabel. Bei kurzen Entfernungen geht stattdessen auch einfacher "Klingeldraht".
Am Wechselrichter bzw. an der Modbuskarte brauchen wir einen "RJ45 Stecker", das ist ein Stecker wie bei normalen Netzwerkgeräten auch.
Ich nehme hierzu gerne diese "werkzeuglosen RJ45 Stecker" (Amazon / eBay)
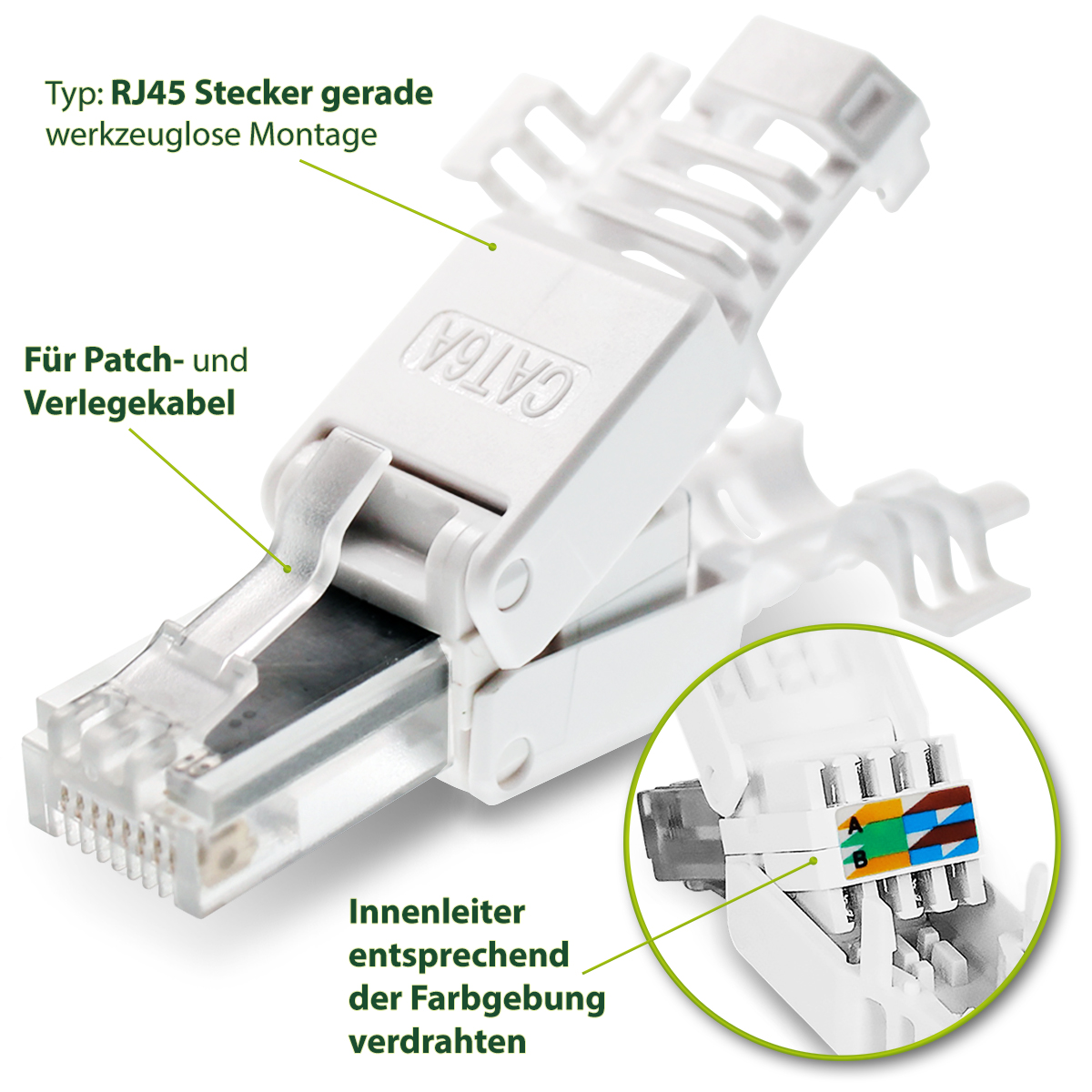
Hier kann man nun entweder alle 8 Adern des Netzwerkkabels einklippsen, oder nur alle bis auf zwei abschneiden und nur diese einklippsen.
Benötigt wird lediglich das blaue Adernpaar.
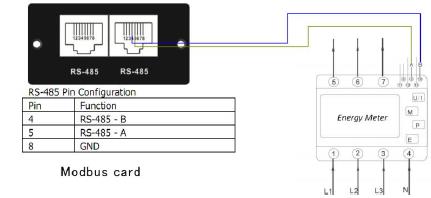
Das Anschlussschema bedeutet:
- am RJ45-Stecker das blaue Adernpaar der Farbmarkierung am Stecker entsprechend anklemmen
- am SDM630 nun das blaue Kabel an der Klemme "B" anschließen und Weiß an "A". Ohne Stecker, das wird nur verschraubt
Das war's, mehr braucht man nicht.
4.) Überprüfung
Da man leider am Wechselrichter weder im Display noch in der Steuerungssoftware einen Hinweis auf eine korrekte Verbindung erhält gibt es nur eine Möglichkeit zu erkennen, ob die Verbindung zwischen SDM630 und WR nun erfolgreich ist:
im Display des SDM630 erscheint dauerhaft (= nicht blinkend) ein Telefonhörer-Symbol
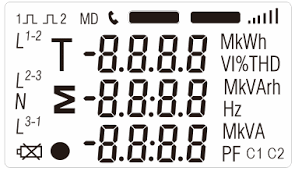
kein Symbol = keine Verbindung.
-> Kabelkontakte überprüfen, auf richtige Polung achten, Dip-Switchstellung an der Modbuskarte überprüfen
Ist nun alles korrekt eingestellt und angeschlossen sollte der WR direkt = ohne Neustart o.ä. reagieren und bei Bedarf Akkustrom zum Hausnetz beimischen, ohne dabei Akkustrom ins öffentliche Netz einzuspeisen.
PS: in der Software des WR (Solarpower) überprüfen, ob die Häkchen bei "darf vom Akku in Grid einspeisen" auch tatsächlich nicht gesetzt sind, sonst hebelt das die 0-Watt-Einspeisung aus; jedoch sollten die ab Werk bereits deaktiviert sein.
PPS: die jeweils aktuellste Wechselrichtersoftware für MPP-Solar und Infinisolar gibt es hier: https://www.mppsolar.com/v3/download/
-> runterscrollen bis zu "Monitoring Software"
Inhaltsverzeichnis:
- 1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)
- 2 Idee + Plan
- 3 Akku-Arbeitsplatz
- 4 eBike Akku Komponenten
- 5 eBike Akku zerlegen
- 6 Laptop Akkus zerlegen
- 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte
- 8 neue Hülle für 18650
- 9 China-Akkutest
- 10 Werkzeuge + Messgeräte
- 11 Null-Watt Einspeisung
- 12 Modbus / RS485 Adapter
- 13 BMS + Balancer
- 14 aktiv Balancer BMS - JKBMS
- 15 Ladegeräte + Kapazitätstester
- 16 kpl. Akkupacks testen
- 17 Innenwiderstand Ri
- 18 Solar Laderegler
- 19 Wechselrichter, Inverter
- 20 Löten - Anleitung für Akkus
- 21 Schlüsselanhänger aus 18650
- 22 Sicherheitskonzept
- 23 Akkus Beschaffung - wie und wo?
- 24 WVC / SG / GMI / PVGS Mikroinverter
- 25 Schritt-für-Schritt zur 18650 Powerwall
- 26 ATS - Automatic Transfer Switch
- 27 Schottky Sperrdioden für Parallelschaltung
- 28 Balkonsolar & Balkonkraftwerk
- 29 Hybrid Wechselrichter einrichten
12 Modbus / RS485 Adapter
Damit ein Wechselrichter wie beispielsweiseder SUN GTIL2 oder SoyoSource oder einer der MPI-Serie von MPP-Solar im Netzparallelbetrieb arbeiten und eine Null-Watt-Einspeisung umsetzen können muss eine Verbindung zwischen Wechselrichter und Stromsensor bestehen.
- Hybrid Wechselrichter MPI 10k mit 10000 Watt von MPP Solar Infinisolar
- Hybrid Wechselrichter MPI 5.5k mit 5500 Watt von MPP Solar Infinisolar
Manchmal kann oder möchte man keine zusätzlichen Kabelstrippen zwischen WR und Zählerschrank ziehen, hierfür gibt es die Möglichkeit das Modbus-Signal um zu wandeln. Ich habe drei Möglichkeiten ausprobiert und werde diese hier als Schritt-für-Schritt-Anleitung behandeln.
- Modbus over Ethernet (= normales, kabelgebundenes Netzwerk)
- Modbus over WiFi (= WLan)
- Modbus over 433MHz (= Funk)
In allen drei Fällen braucht man zwei identische Adapter. Einen am Wechselrichter, der das Modbussignal umwandelt in z.B. Ethernet und über Netzwerkkabel überträgt zum Stromzähler. Dort dann einen zweiten Adapter, der das Netzwerksignal wieder zurückwandelt zu Modbus und weiter zum SDM630.
Achtung:
Es gibt unterschiedliche Module und Hersteller, die Adapter für Modbus / RS485 bauen.
Wichtig hierbei ist, dass diese eine bidirektionale Kommunikation erlauben.
Das bedeutet: dass sie ein RS485-Signal umwandeln können in z.B. Ethernet, aber auch den anderen Weg also ein Ethernet-Signal umwandeln können in RS485.
Die günstigeren Adapter können das nämlich nicht, sie können idR immer nur einen Weg umwandeln und sind dazu da um z.B. ein Gerät mit Modbus per Ethernet am PC auszulesen, nicht aber um zwei Mosbus-Geräte miteinander zu verbinden. Hier also dringend aufpassen und im Zweifel genau die Beschreibung durchlesen oder den Hersteller anschreiben, ob das Gerät bidirektionale Kommunikation unterstützt oder nicht.
Inhaltsverzeichnis:
- 12.1 Modbus over Ethernet
- 12.2 Modbus over WiFi
- 12.3 Modbus & Solarpower Software für MPI Wechselrichter
- 12.4 Modbus over 433MHz
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
12.1 Modbus over Ethernet
Mit dieser Methode kann man z.B. einen SDM630 Energy Meter und einen MPP Solar / Infinisolar Hybrid Wechselrichter anstatt über ein Modbuskabel zu verbinden,
mittels zweier Modbus-zu-Ethernet Adapter über ein (bestehendes) Netzwerk verbinden.
Es gibt verschiedene Modbus -> Ethernet-Adapter, ich benutze diesen hier: USR-TCP323-304

Erhältlich: bei z.B. Aliexpress oder eBay oder Amazon
Alternative für die Din-Hutschiene im Sicherungskasten: von Protoss die gibt's in 4 Varianten:
- Protoss-PE11-M ist RS485 zu Ethernet,Power eingang 9V zu 48VDC
- Protoss-PE11-H ist RS485 zu Ethernet,Power eingang 100V to240VAC
- Protoss-PW11-M ist RS485 zu Wifi,Power eingang 9V zu 48VDC
- Protoss-PW11-H ist RS485 zu Wifi,Power eingang 100V to240VAC

Fast identisch zum USR-TCP323-304 ist noch der USR-TCP232-302 der anstatt der drei Schraubterminals für Einzel-Adern einen RS232 COM Steckeranschluss besitzt.
Zum Adapter mit COm Schnittstelle dann mehr unter dem Kapitel 12.3 Modbus & Solarpower Software für MPI Wechselrichter

Alle USR Adapter arbeiten auf dieselbe Weise
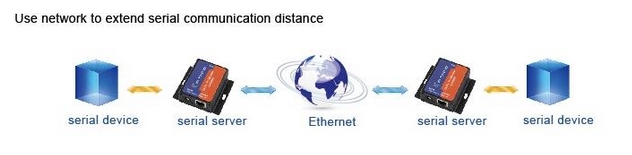
Downloads
Um einen Wechselrichter mit einem SDM630 per Ethernet Netzwerk zu verbinden benötigt man zwei dieser Adapter.
- das komplette Handbuch zum USR-TCP232-304 gibt es hier {phocadownload view=file|id=51|target=b}
- eine ausführliche Anleitung zur Verbindung wie wir sie benötigen hier {phocadownload view=file|id=50|target=b}
Hinweis: die unten im nächsten Kapitel aufgeführte Schritt-für-Schritt-Anleitung ist etwas einfacher
mehrere RS485 / Modbus Geräte ins Netzwerk einbinden
Will man nun mehrere Modbus / RS485 Geräte über ein Netzwerkkabel laufen lassen geht das auch, dazu gibt es auch Geräte mit zwei RS485 Ports und sogar mit 4 Ports wie den HF5142 der wahlweise mit 4x RS232 / COM Port Steckverbindungen oder mit 4x RS485 Schraubterminals oder gemischt arbeitet und dann alles über ein einziges Netzwerkkabel schickt.

Bezugsquelle: HF5142B mit 4x RS232 Ports
Da ich selbst aktuell nur den eingangs vorgestellten USR-TCP323-304 Adapter im Einsatz habe um den Wechselrichter von Infinisolar / MPP Solar mit dem SDM630 Modbuszähler zu verbinden möchte ich hier nun genau das vorstellen:
12.1.1 USR-TCP323-304 einrichten
Vor der Verwendung müssen beide Adapter so eingestellt werden, dass sie sich im Netzwerk gegenseitig "finden" und miteinander kommunizieren können.
Da die Adapter keine Knöpfe haben geht das alles über PC, ohne zusätzliche App, über den Browser (Firefox, Chrome, egal was).
Dazu brauchst Du einen (Windows) PC mit Netzwerkanschluss und ein Netzwerkkabel.
1. verbinde PC und USR Adapter mittels Netzwerkkabel, der USR muss zudem mit dem Stromnetzteil verbunden sein
2. öffne den Browser, gib in die Adresszeile folgendes ein: 192.168.0.7
3. nun sollten Benutzername und Passwort abgefragt werden: das ist beide Male admin
4. dann sollte sich die Benutzeroberfläche des USR öffnen. Das Startbild ist immer die Status-Übersicht, hier kann man nichts einstellen
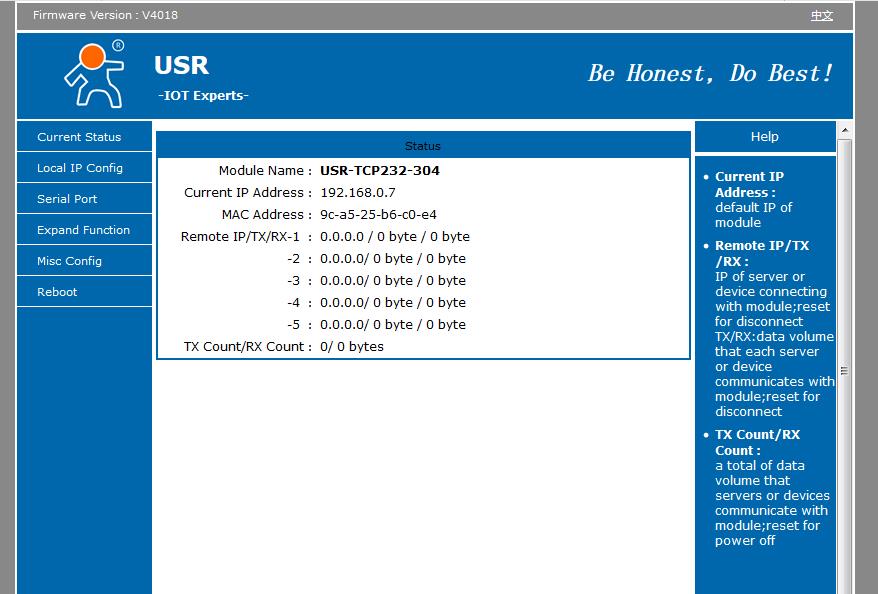
5. der zweite Punkt im Menü links "Local IP Config".
Hier müssen nun die Daten eingegeben werden, die zum eigenen Netzwerk passend sind.
- IP type: "Static IP" belassen
- Static IP: hier nun eine eindeutige IP-Adresse für den USR eingeben. Die ersten drei Blöcke sind der Adressbereich und der muss zum eigenen Netzwerk passen, die letzte Ziffer ist dann die eindeutige IP des Adapters und nach Belieben frei wählbar, die "7" dient hier nur als Beispiel. Hinweis: Windows IP herausfinden
- Submask: ist in der Regel immer 255.255.255.0
- Gateway: hier kommt die IP-Adresse des eigenen Routers rein, in der Regel ist das 192.168.1.1 Hinweis: Router IP herausfinden
- DNS Server: ebenfalls die IP-Adresse des Routers eintragen
Das war nun die Einstellung, damit der USR Adapter sich mit dem Netzwerk verbinden kann. Auf Save klicken -> der Adapter muss dann neu starten
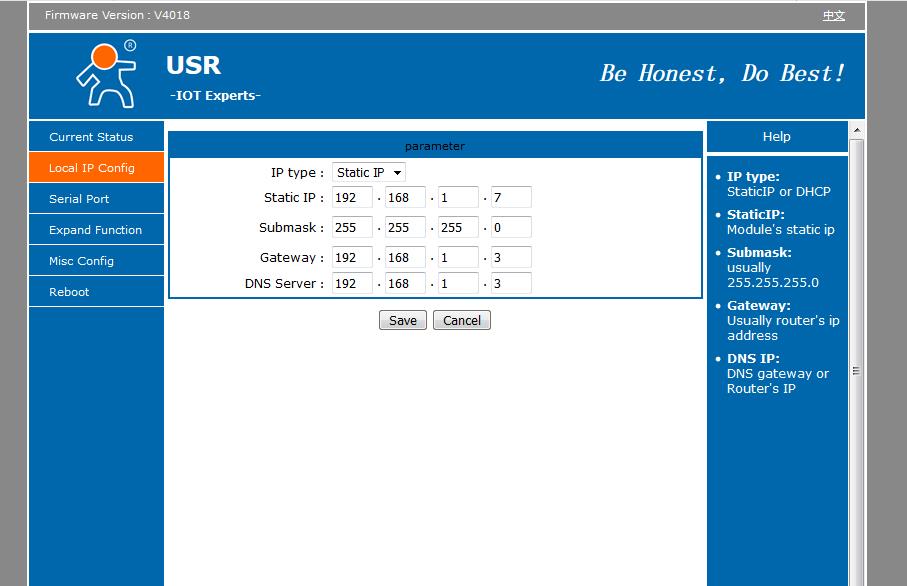
6. Menüpunkt "Serial Port".
Hier wird nun eingestellt, dass die zwei Adapter korrekt miteinander kummunizieren.
Auf dem Screenshot ist die Standardeinstellung zu sehen, die nützt uns so garnichts

die Werte wie folgt eintragen:
- Baud Rate: 19200
- Data Size: 8
- Parity: None
- Stop Bits: 1
- Local Port Number: 1100 (ist im Grunde aber frei wählbar)
- Remote Port Number: 1200 (ist ebenfalls frei wählbar)
- Work Mode: UDP Client (für beide Adapter muss "Client" aktiviert sein, kein "Server" benötigt")
- Remote Server Adresse: [eigener Netzwerk-Adressbereich] [IP des zweiten USR-Adapters, den Du gleich einstellen wirst] -> Erklärung weiter unten
- die unten gesetzten Häkchen bleiben so, wie sie sind
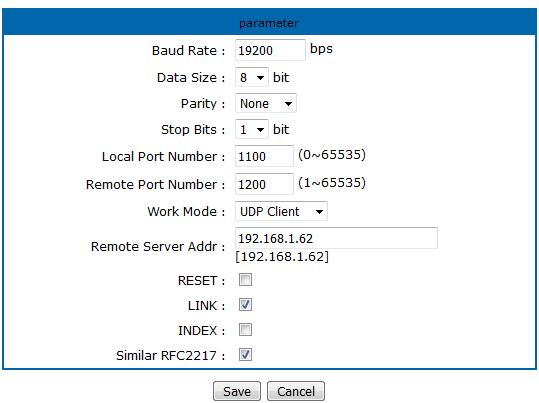
Erklärung:
- Adapter1 benötigt eine IP-Adresse sowie einen Port
- Adapter2 benötigt benötigt ebenfalls IP-Adresse sowie Port, wobei sich beides von Adapter1 unterscheiden muss
- Adapter1 muss IP und Port von Adapter2 kennen um mit ihm kommunizieren zu können, und umgekehrt auch
- "Local" bedeutet "eigene*r" und "Remote" bedeutet etwa soviel wie "der andere".
Beispiel:
- Adapter1 bekommt die IP 192.168.1.61 sowie den local Port 1100
- Adapter2 bekommt die IP 192.168.1.62 sowie den local Port 1200
- in Adapter1 muss als Remote Port eingetragen werden die 1200 und als Remote Server Addr die 192.168.1.62
- in Adapter2 muss als Remote Port eingetragen werden die 1100 und als Remote Server Addr die 192.168.1.61
Nachdem also die Werte in Adapter1 fertig eingestellt wurden diese am besten noch irgendwo notieren, dann auf "Save" klicken und den Adapter neu starten lassen.
7. Adapter vom Netzwerkkabel entfernen (der ist nun fertig eingerichtet) und das selbe Spiel Schritt 1 bis 4 mit dem zweiten USR Adapter machen.
Bei Schritt 5 dann eben die IP vergeben, die Du im Adapter 1 als "Remote Server Addr" eingegeben hast (in unserem Beispiel also die 192.168.1.62) und bei den "Serial Port" Parametern entsprechend IP und Portnummer des Adapter1 eintragen
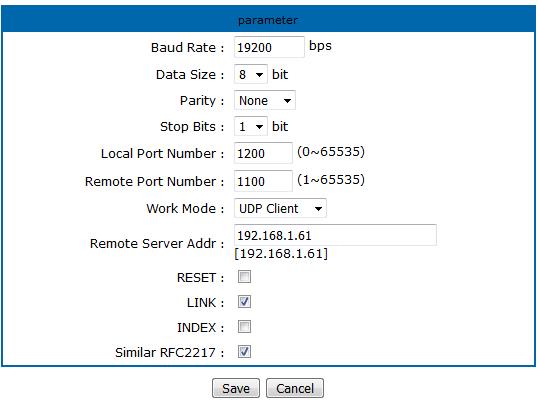
Save -> Neustart -> fertig
Wenn alles korrekt eingestellt ist kannst Du fortan die beiden USR Adapter per Browser aufrufen durch Eingabe der neuen IP Adresse, sie müssen dazu auch nicht mehr direkt an den PC angeschlossen werden und das funktioniert auch über WLan sowie vom Smnartphone aus.
Kann:
kein Muss und tut auch nichts zur Funktion, aber zur Übersicht: es ist sinnvoll, beide Adapter eindeutig zu benennen.
Unter "Misc Confid" kann man den Namen des Adaptersändern und ggf. auch das Passwort
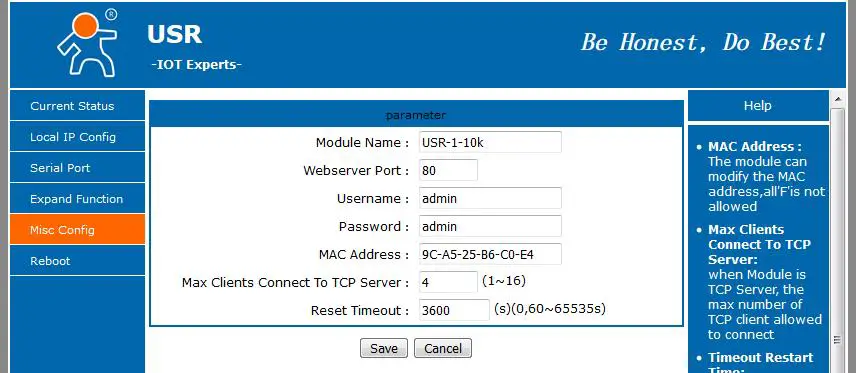
Als Namensgebung benutze ich beispielsweise "USR-1-10k" was für Adapter1 steht, der am Wechselrichter hängt ("MPP Solar MPI 10k", ich habe zwei Wechselrichter, deswegen die 10k Unterscheidung)
sowie "USR-2-10k-SDM" was für Adapter2 steht, der zum MPI 10k gehört und am SDM hängt.
Das kann man dann auch so im Router einstellen, z.B. hier in der FritzBox

Inhaltsverzeichnis:
- 12.1 Modbus over Ethernet
- 12.2 Modbus over WiFi
- 12.3 Modbus & Solarpower Software für MPI Wechselrichter
- 12.4 Modbus over 433MHz
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
12.1.2 USR-TCP323-304 & SDM630 verkabeln
Wir haben nun zwei fertig eingerichtete USR Adapter. Welcher der beiden nun an den Wechselrichter kommt und welcher an den SDM630 ist egal.
- am WR: wie im Abschnitt 11 beschrieben brauchen wir ein Stück (Netzwerk-)Kabel mit RJ45 Stecker, dieses kommt in die Modbuskarte
- am anderen Kabelende nun das blaue Kabel am USR Adapter in die "B" Anschlussklemme, das weiße Kabel an die "A" Anschlussklemme
- dann ein Netzwerkkabel vom USR zum Router oder Switch
- am SDM630: ein Stück (Netzwerk-)Kabel zum Verbinden von USR Adapter und SDM630 wird benötigt. "A" am Adapter kommt auf "A" am SDM630 und "B" entsprechend auf "B"
- auch diesen USR-Adapter mittels Netzwerkkabel verbinden mit Router oder Switch
- Netzteil an beiden USRs einstecken -> fertig
Kontrolle:
Es gibt nun zwei Möglichkeiten um zu prüfen, ob die Verbindung zwischen Wechselrichter und SM630 erfolgreich ist
1. wie im Abschnitt 11 auch bereits beschrieben:
im Display des SDM630 erscheint dauerhaft (= nicht blinkend) ein Telefonhörer-Symbol
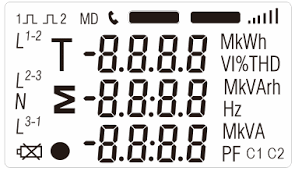
kein Symbol = keine Verbindung.
-> Kabelkontakte überprüfen, auf richtige Polung achten, Dip-Switchstellung an der Modbuskarte überprüfen
SDM630 einrichten für Nulleinspeisung: s. Kapitel 11 Null-Watt Einspeisung
2. die Benutzeroberfläche einer der beiden USRs aufrufen, mittels Browser und EIngabe der IP-Adresse.
Hier sollte auf der Startseite beim Status zu sehen sein, ob beide Adapter miteinander kommunizieren.
In der 4. Zeile bei "Remote IP/TX/RX-1" müssen Zahlen vor beiden "byte" stehen. Das eine steht für "gesendete Daten" das andere für "empfangene Daten"
Das gleiche gilt für die letzte Zeile bei "TX Count/RX Count"
Ist hier jeweils nur ein Feld ausgefüllt und bei dem anderen steht eine "0" dann sendet dieser Adapter zwar munter Daten ins Netzwerk, diese kommen aber nicht an, denn sonst würde der andere Adapter antworten.
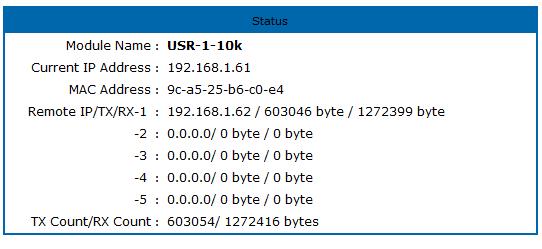
-> Kabelkontakte überprüfen, auf richtige Polung achten, Einstellungen weiter oben zu IP und Port-Nummern nochmal kontrollieren
Inhaltsverzeichnis:
- 12.1 Modbus over Ethernet
- 12.2 Modbus over WiFi
- 12.3 Modbus & Solarpower Software für MPI Wechselrichter
- 12.4 Modbus over 433MHz
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
12.2 Modbus over WiFi
Um zwei Geräte mit Modbus / RS485 über WLan zu verbinden brauchst Du
- ein vorhandenes, bestehendes WLan-Netz
- zwei WLan-Adapter wie z.B. den USR-WIFI232-604 (der USR-WIFI232-610 hat zusätzlich zu WLan auch noch Ethernet, der USR-WIFI232-600 ist der Nachfolger)
- Bezugsquelle: USR-W610 mit WLan

per Wifi gibt es auch Adapter mit zwei RS485 Eingängen (HF2221) und sogar mit 8 RS485 Eingängen, den HF6208
Bezugsquelle: HF6208 mit 8x RS485 zu WiFi

Auch hier sind Benutzeroberfläche und Einrichtung ähnlich wie oben bereits beschrieben.
Zu beachten
ist hier, dass zur Nutzung dieser WLan Adapter keine 1:1 Verbindung aufgebaut werden kann sondern immer ein bestehendes WLan-Netz (idR über einen WLan Router) bestehen muss und sich dann beide Adapter, also der Sender am Zähler und der Empfänger am Wechselrichter, mit diesem WLan-Netz verbinden müssen.
Kein Empfang zum Router = keine Verbindung zwischen Zähler und Wechselrichter
Inhaltsverzeichnis:
- 12.1 Modbus over Ethernet
- 12.2 Modbus over WiFi
- 12.3 Modbus & Solarpower Software für MPI Wechselrichter
- 12.4 Modbus over 433MHz
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
12.3 Modbus & Solarpower Software für MPI Wechselrichter
Dies ist eine Anleitung, um per Netzwerk & Solarpower-Software einen Zugriff auf die Hybrid Wechselrichter der MPI Serie (Infinisolar, MPP Solar, EASun, FSP) zu erhalten und diese so fernsteuern zu können.
Anmerkung: einige Modelle ab 2021 können zwar mit einem WLan Dongle ausgerüstet werden, doch man kann dann nur per Android App darauf zugreifen und hat damit keinen Zugriff auf alle Funktionen und Einstellmöglichkeiten des Wechselrichters.

WLan Dongle für Hybrid Inverter: EASun / Aliexpress / eBay / eBay-Suche / Amazon-Suche
Mittels der hier gezeigten Methode können alle Funktionen genutzt werden.
12.3.1 Das wird benötigt:
1.) einen USR-TCP232-302 auf Aliexpress / Aliexpress-Suche / eBay-Suche / Amazon-Suche

2.) ein Stück D-Sub Nullmodel Kabel beidseitig mit Stecker auf eBay / eBay-Suche / Amazon-Suche
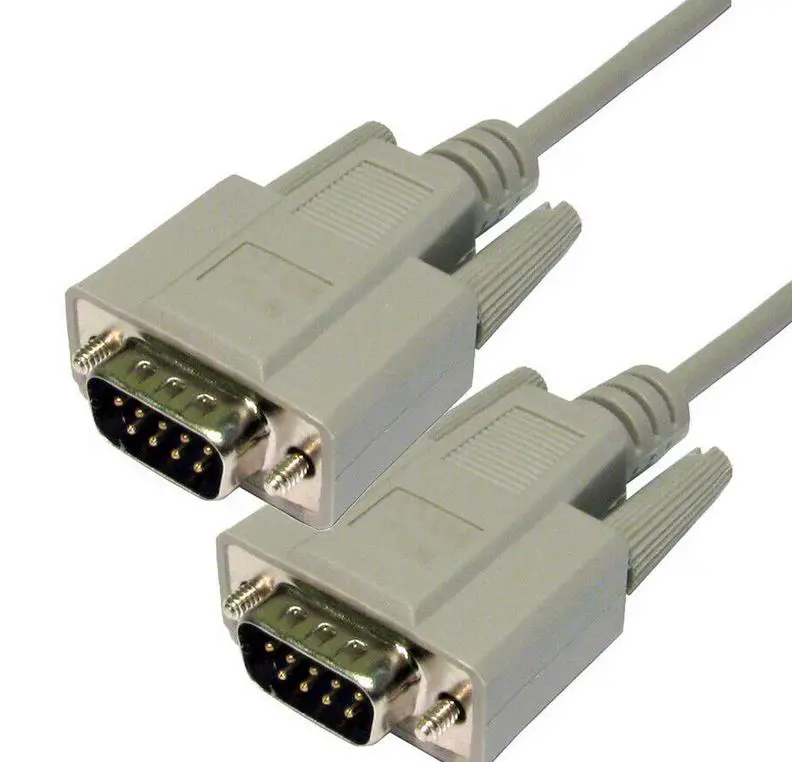
3.) ein bestehendes Netzwerk.
Idealerweise hat man einen kleinen Switch am Wechselrichter sowie einen weiteren Switch am SDM 630 Energy Meter, damit man die o.g. Adapter ebenso einstecken kann wie auch die USR-TCP323-304 falls man die Verbindung zum SDM630 ebenfalls über Ethernet realisieren möchte. Je nach Lage das Wechselrichters kann es auch SInn machen, dort noch einen WLan Accesspoint einzustecken um die allgemeine WLan-Signalstärke zu verbessern
Mini Ethernet Switch auf Aliexpress-Suche / eBay-Suche / Amazon-Suche

4.) Solarpower Software (NICHT Watchpower, die ist für die Offgrid Modelle) zur Steuerung des Wechselrichters
zum Downloaden unter: MPPSolar.com -> Downloads -> Monitoring Software -> SOLARPOWER (HYBRID)
5.) VCOM Software (Virtual Com) um am Windows PC einen virtuellen COM-Port zu erstellen.
Während der Installation nicht irritieren lassen von eventuellen Warnungen durch die Windows Sicherheitssoftware
Download direkt beim Hersteller der USR Modbus Adapter
6.) Wechselrichter der MPI Serie
z.B. MPI 5.5k oder den MPI 10k
Wenn wir das alles haben kann es losgehen
12.3.2 Einrichtung USR-TCP232-302:
Zunächst müssen wir den USR-TCP232-302 so einstellen, dass er das RS232 Signal des Wechselrichters übersetzt in Ethernet (Netzwerk). Das geht zum Großteil wie auch beim, weiter oben gezeigten, USRTCP302-304 Adapter, weswegen einige Screenshots auch identisch sind.
Da die Adapter keine Knöpfe haben geht die Einrichtung über PC, ohne zusätzliche App, über den Browser (Firefox, Chrome, egal was).
Dazu brauchst Du einen (Windows) PC mit Netzwerkanschluss und ein Netzwerkkabel.
1. verbinde PC und USR Adapter mittels Netzwerkkabel, der USR muss zudem mit dem Stromnetzteil verbunden sein
2. öffne den Browser, gib in die Adresszeile folgendes ein: 192.168.0.7
3. nun sollten Benutzername und Passwort abgefragt werden: das ist beide Male admin
4. dann sollte sich die Benutzeroberfläche des USR öffnen. Das Startbild ist immer die Status-Übersicht, hier kann man nichts einstellen
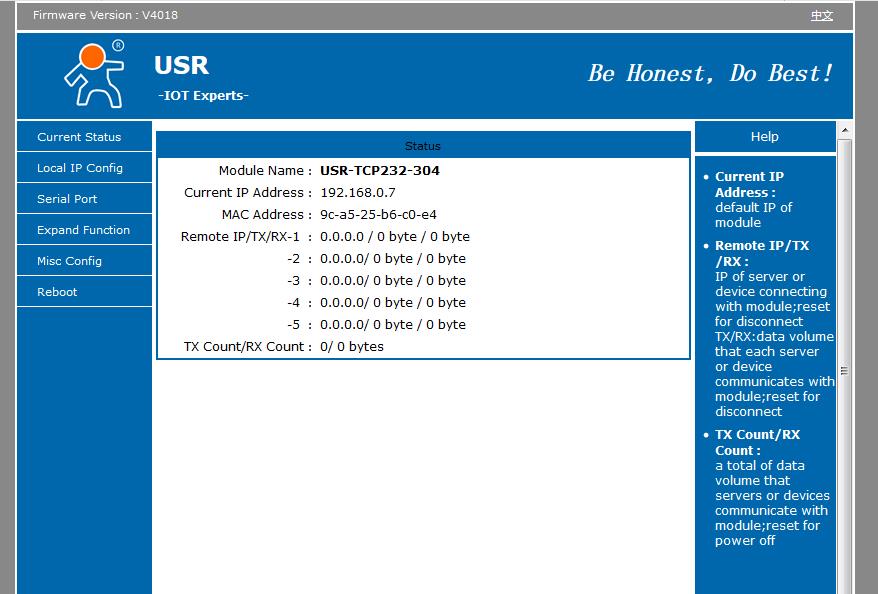
5. der zweite Punkt im Menü links "Local IP Config".
Hier müssen nun die Daten eingegeben werden, die zum eigenen Netzwerk passend sind.
- IP type: "Static IP" belassen
- Static IP: hier nun eine eindeutige IP-Adresse für den USR eingeben. Die ersten drei Blöcke sind der Adressbereich und der muss zum eigenen Netzwerk passen, die letzte Ziffer ist dann die eindeutige IP des Adapters und nach Belieben frei wählbar, die "7" dient hier nur als Beispiel. Hinweis: Windows IP herausfinden
- Submask: ist in der Regel immer 255.255.255.0
- Gateway: hier kommt die IP-Adresse des eigenen Routers rein, in der Regel ist das 192.168.1.1 Hinweis: Router IP herausfinden
- DNS Server: ebenfalls die IP-Adresse des Routers eintragen
Das war nun die Einstellung, damit der USR Adapter sich mit dem Netzwerk verbinden kann. Auf Save klicken -> der Adapter muss dann neu starten
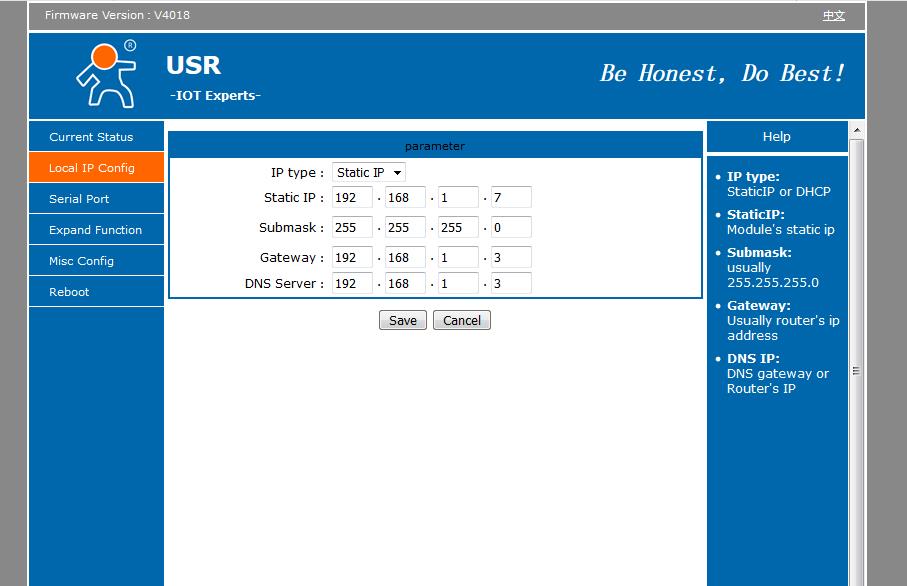
6. Menüpunkt "Serial Port".
Hier wird nun eingestellt, dass Adapter und Wechselrichter korrekt miteinander kummuniziert.
Auf dem Screenshot ist die Standardeinstellung zu sehen, die nützt uns so garnichts

wir stellen am USR-TCP232-302 alles wie folgt ein:
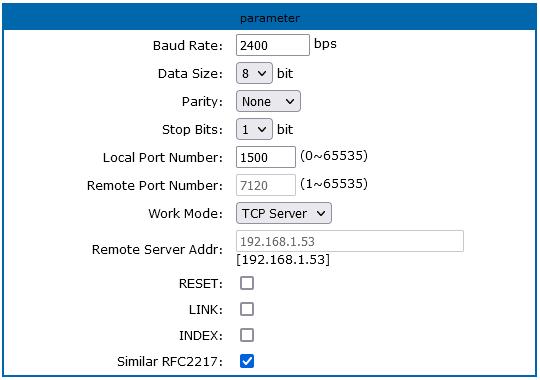
die Werte nochmal einzeln:
- Baud Rate: 2400
- Data Size: 8
- Parity: None
- Stop Bits: 1
- Local Port Number: 1500 (ist frei wählbar)
- Remote Port Number: wird später automatisch vergeben durch die VCom Software, hier also nichts verändern
- Work Mode: TCP Server
- Remote Server Adresse: wird später automatisch vergeben durch die VCom Software, hier also nichts verändern
- die unten gesetzten Häkchen setzen so wie auf dem Screenshot
Save -> Neustart -> fertig
Wenn alles korrekt eingestellt ist kannst Du fortan den Adapter per Browser aufrufen durch Eingabe der neuen IP Adresse, er muss dazu auch nicht mehr direkt an den PC angeschlossen werden und das funktioniert auch über WLan sowie vom Smnartphone aus.
7. Name vergeben
kein Muss und tut auch nichts zur Funktion, aber zur Übersicht: es ist sinnvoll, alle Adapter eindeutig zu benennen.
Unter "Misc Config" kann man den Namen des Adapters ändern und ggf. auch das Passwort
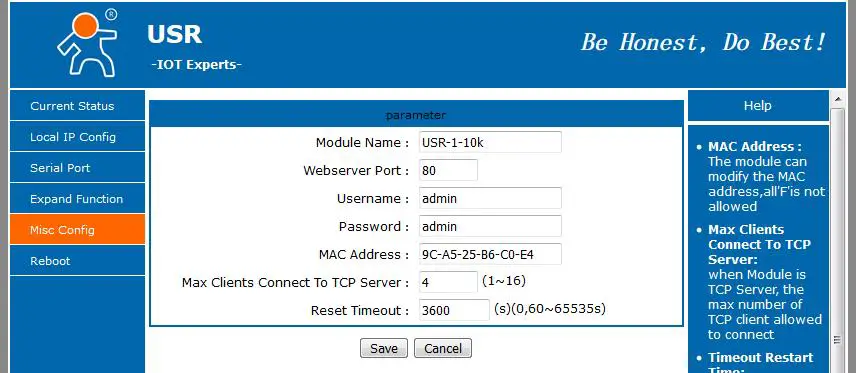
Als Namensgebung benutze ich beispielsweise "USR-1-10k" was für Adapter1 steht, der am Wechselrichter hängt ("MPP Solar MPI 10k", ich habe zwei Wechselrichter, deswegen die 10k Unterscheidung)
Das kann man dann auch so im Router einstellen, z.B. hier in der FritzBox

Nun den Adapter am Wechselrichter installieren, mit dem Nullmodem Sub-D Kabel im Wechselrichter einstecken und ein Ethernetkabel in den Switch des bestehenden Netzwerks, dann ist dieser Schritt schonmal erledigt
8. VCom Software einrichten
Damit wir den Wechselrichter per Computer mit Hilfe der Solarpower-Software nun steuern können müssen wir am PC noch einen virtuellen COM-Port einrichten, damit die Solarpower-Software eine Verbindung herstellen kann.
Das geht am besten mit der VCom Software die ebenfalls vom Hersteller des Modbus Adapters kommt.
Während der Installation nicht irritieren lassen von eventuellen Warnungen durch die Windows Sicherheitssoftware
Download direkt beim Hersteller der USR Modbus Adapter

ein Klick auf "Smart VCOM" startet die Suche nach vorhandenen Modbus Geräten im Netzwerk. Bei mir sind das mehrere, deswegen ist die Liste entsprechend groß. Wenn Du nur einen USR Adapter in Betrieb hast wird hier auch nur dieser eine Adapter auftauchen. Dort dann entsprechend ein Häckchen davor setzen und auf "Finish" klicken.
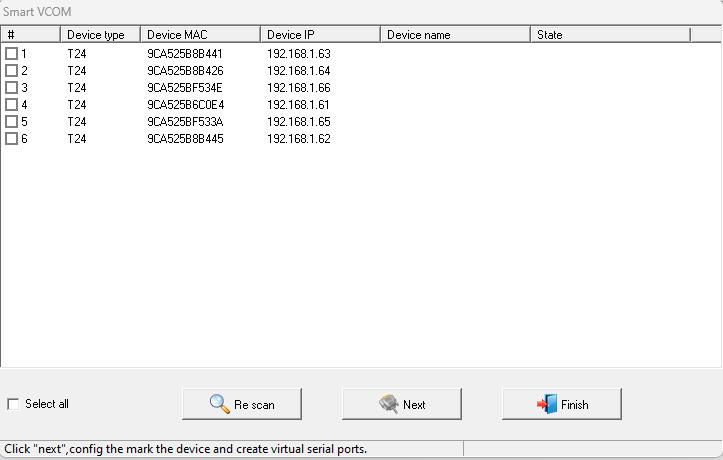
hat das geklappt dann kommt diese Bestätigungsmeldung
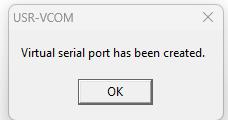
zumindest bei mir auf Windows 10 64 Bit klappt das jedes zweite Mal nicht und ich erhalte diese Fehlermeldung:
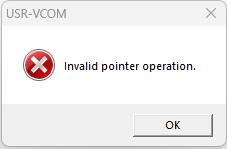
Damit hängt sich die komplette VCom Software auf und es hilft nur ein Beenden mittels Taskmanager. Danach die Software neu starten, "Smart VCOM" und den Adapter erneut hinzufügen, beim zweiten Versuch klappt es dann eigentlich immer.
wenn das Hinzufügen geklappt hat dann sollte der Adapter nun auch in der VCom Software auf der Übersichtsseite auftauchen und so aussehen.
Bei "Parameter" dürfte noch nichts stehen, beim "COM State" noch "Not in Use". "COm Received" und "NET received" sollten auch noch bei 0 stehen. Das bedeutet, dass der virtuelle COM-Port am PC nun erfolgreich eingerichtet wurde, aber noch nicht in Benutzung ist.
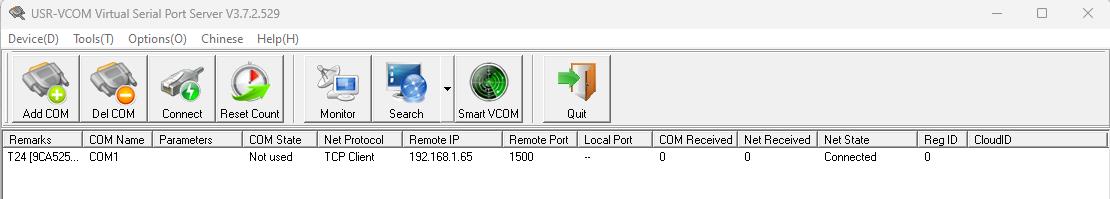
nun starten wir die Solarpower-Software.
Diese wird nun automatisch den COM Port erkennen und eine Verbindung zum Wechselrichter aufbauen. Die Datenübertragung dauert eine Weile und solange die Verbindung noch nicht besteht sieht man rechts oben auch nur den eigenen Computernamen und ansonsten werden auch noch keine Werte angezeigt. Dann einfach ca. 1 Minute Geduld haben, dann kommen nach und nach die übertragenen Werte rein.

wenn die Verbindung steht und die Werte des Wechselrichters übermittelt wurden sieht das dann so aus (links im Feld sind in meinem Beispiel nun COM1 sowie auch COM2 gelistet, das liegt daran dass ich einen MPI 5.5k und auch einen MPI 10k benutze, wenn Du nur einen Wechselrichter hast dann wird dort auch nur Com1 auftauchen)
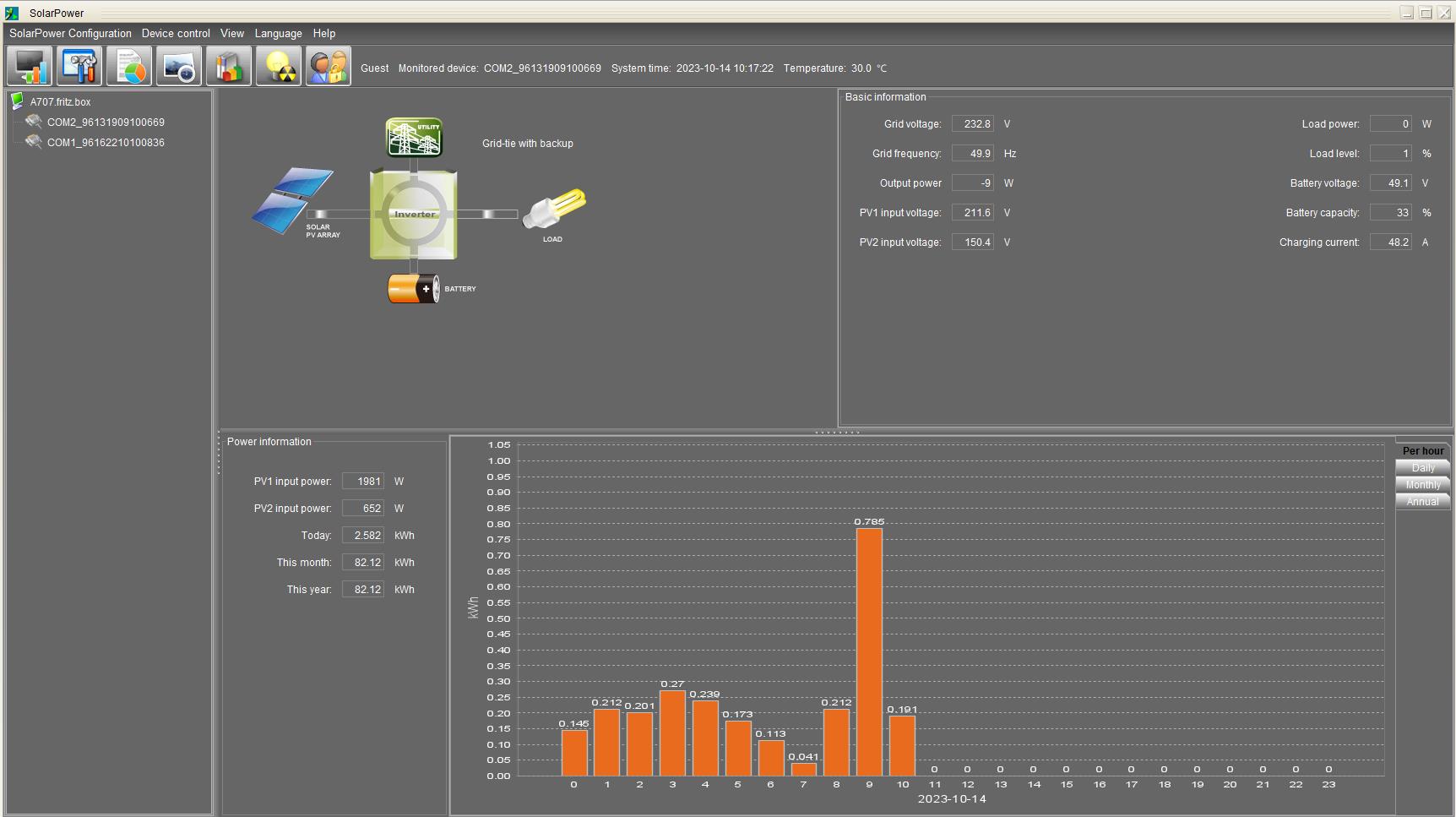
gleichzeitig sieht man in der VCOm Software dann auch, dass der Modbus Adapter nun am Arbeiten ist
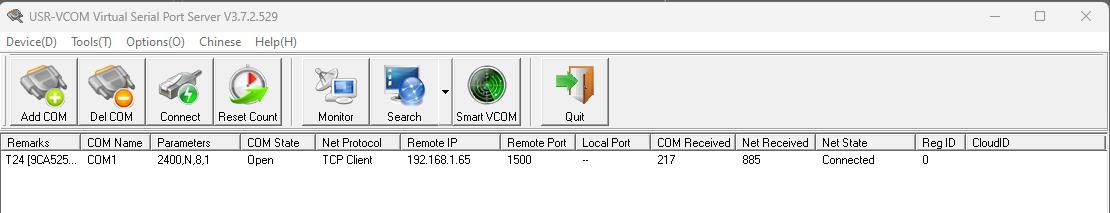
Tipp:
da der virtuelle COM Port nur dann aktiv ist, wenn auch die VCOm Software aktiv ist klappt die Verbindung mit Solarpower auch nur, wenn gleichzeitig die VCOM Software läuft.
Daher empfiehlt es sich unter "Options" den Haken zu setzen bei "Autorun" und bei "Keep Alive" den Haken bei "TCP Server ON" sodass der COM-Port bestehen bleibt.
Das war's, nun kannst Du Deinen Wechselrichter über Netzwerk mittels Solarpower-Software 1:1 und komplett steuern und einstellen.
Inhaltsverzeichnis:
- 12.1 Modbus over Ethernet
- 12.2 Modbus over WiFi
- 12.3 Modbus & Solarpower Software für MPI Wechselrichter
- 12.4 Modbus over 433MHz
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
12.4 Modbus over 433MHz
Dort, wo es kein bestehendes WLan-Netz gibt oder der Empfang nicht ausreicht bietet es sich an, zwei Modbus-Adapter einzusetzen, die mittels Funk direkt miteinander kommuniziert.
Hierzu nutze ich erfolgreich den SV612 von NiceRF (mittlerweile gibt es den baugleichen V613)

Das Set wie oben auf dem Bild mit
- Antennen (gibt es auch "nackt")
- USB-Adapter zum Programmieren der Funkmodule

Bezugsquellen:
- NiceRF v611 (100mW, ohne Gehäuse)
- NiceRF v613 (100mW, mit Gehäuse)
- NiceRF v651 (500mW, ohne Gehäuse)
technische Details zum NiceRF SV613
- 433/470/868/915 MHz (frei einstellbar 240-930 MHZ)
- per Software frei konfigurierbar
- 40 Kanäle wählbar
- Eingangssignale: TTL / RS232 / RS485
- Bi-directional & Halb duplex
- Empfindlichkeit: -121 dBm
- Max Sendeleistung: 100 mW /+ 20dB
- Arbeits Spannung: 3,3 ~ 7,0 V
- Arbeits Temperatur: -40 ~ + 85 °C
Funk Adapter einstellen
Den USB-Adapter kann man mittels Jumper umstecken entweder auf Programmiermodus oder Sende-/ Empfangsmodus

Zum Einstellen benötigen wir den Programmiermodus, also Jumper aufgesteckt lassen und ab damit an den PC (weiter unten gibt es als Download den USB-Treiber samt dazugehöriger Software).
Um einen Infinisolar / MPP Solar Wechselrichter mittels Modbuskarte mit einem SDM630 Zähler zu verbinden dann in der Software die selben Daten eingeben, wie oben bereits beschrieben, also
- Baud Rate: 19200
- Data Size: 8
- Parity: None
- Stop Bits: 1
In meinem Anwendungsfall habe ich allerdings einen anderen Wechselrichter mit diesem Funk-Adapter in Benutzung und zwar den Soyo Source 1.200W Grid tie inverter with limiter von hier -> 19 Wechselrichter, Inverter

Der Wechselrichter hat eine Strom-Messklemme als Limiter.
Diese Messklemme wird zum Glück nicht direkt an den Soyo Source Wechselrichter angesteckt sondern an die kleine, weiße Limiter-Box.
Die Box zeigt dann auf dem Display nochmal separat den gemessenen Verbrauch an und ist dann mittels ca. 1m langem Verbindungskabel an den Wechselrichter angeschlossen.
Diese Verbindung zwischen Limiter-Box und Wechselrichter ist eine RS485 / Modbus Verbindung, sodass wir genau hier ansetzen können und einen der o.g. Adapter verwenden können.
Bei der PV-Anlage im Gartenhaus von Heidi -> Heidi-PV
habe ich den Soyo Source 1200W Wechselrichter samt SV613 Funkmodul eingebaut, um die 60m Entfernung + 2 gemauerte Wände zwischen Gartenhaus und Zählerkasten im Keller zu überbrücken, s. auch hier:
und auch als Video eine Vorstellung der Anlage samt Anschluss und Funktionsprinziep
Downloads
- Seite des Herstellers inkl. Downloadlinks (teilweise wird ein Passwort verlangt, dieses ist nicerf )
- falls die Seite mal offline sein sollte hier als Downloadpaket der Windows USB-Treiber, Handbuch und Software zum Programmieren {phocadownload view=file|id=32|target=b}
Programmierung
Keine Angst, Du brauchst keinerlei Programmierkenntnisse, um die Funkmodule einzustellen sondern lediglich
- den USB-Treiber samt Software aus dem Downloadlink weiter oben
- USB-Adapter für den PC
- die nachfolgende Mini-Anleitung
los geht's:
- Treiber installieren
- USB-Adapter mit dem ersten SV612 Modul verbinden (welches ist egal, beide werden exakt gleich eingestellt)
- überprüfen, ob der Jumper auf dem USB-Adapter auch so eingesteckt ist, dass er sich im "Programmiermodus" befindet (s. Bild weiter oben)
- USB-Adapter in den PC stecken
- beiliegende Software aufrufen
- rechts oben nacheinander die unterschiednlcieh COM-Ports ausprobieren (meist Nr. 1 oder 3) und auf "Open" klicken -> kurz warten -> wenn ganz unten links dann "Device found" steht dann ist es der richtige COM-Port und es besteht nun eine Verbindung zum SV612 Funkadapter
- die "NET Parameters" auf Standard belassen
- bei "Serial Parameters" genau das einstellen wie auf dem Bild, also Baud Rate = 4800 / Data bit = 8 / Stop = 1 / Parity = None
- "RF Parameters" ebenfalls einstellen wie auf dem Bild wobei bei "Power" die "7" gleichbedeutend ist mit 100% Sendeleistung und diese wenn möglich soweit reduziert werden sollte, so dass die Verbindung eben gerade so noch stabil funktioniert. Erklärung dazu wieso s. Punkt weiter unten
- speichern mit "SET" und fertig
- das Ganze dann mit dem zweiten Funk-Modul wiederholen
Einstellungen beim Funk-Modul V612 (V613 weiter unten)

Einstellungen beim Funk-Modul V613
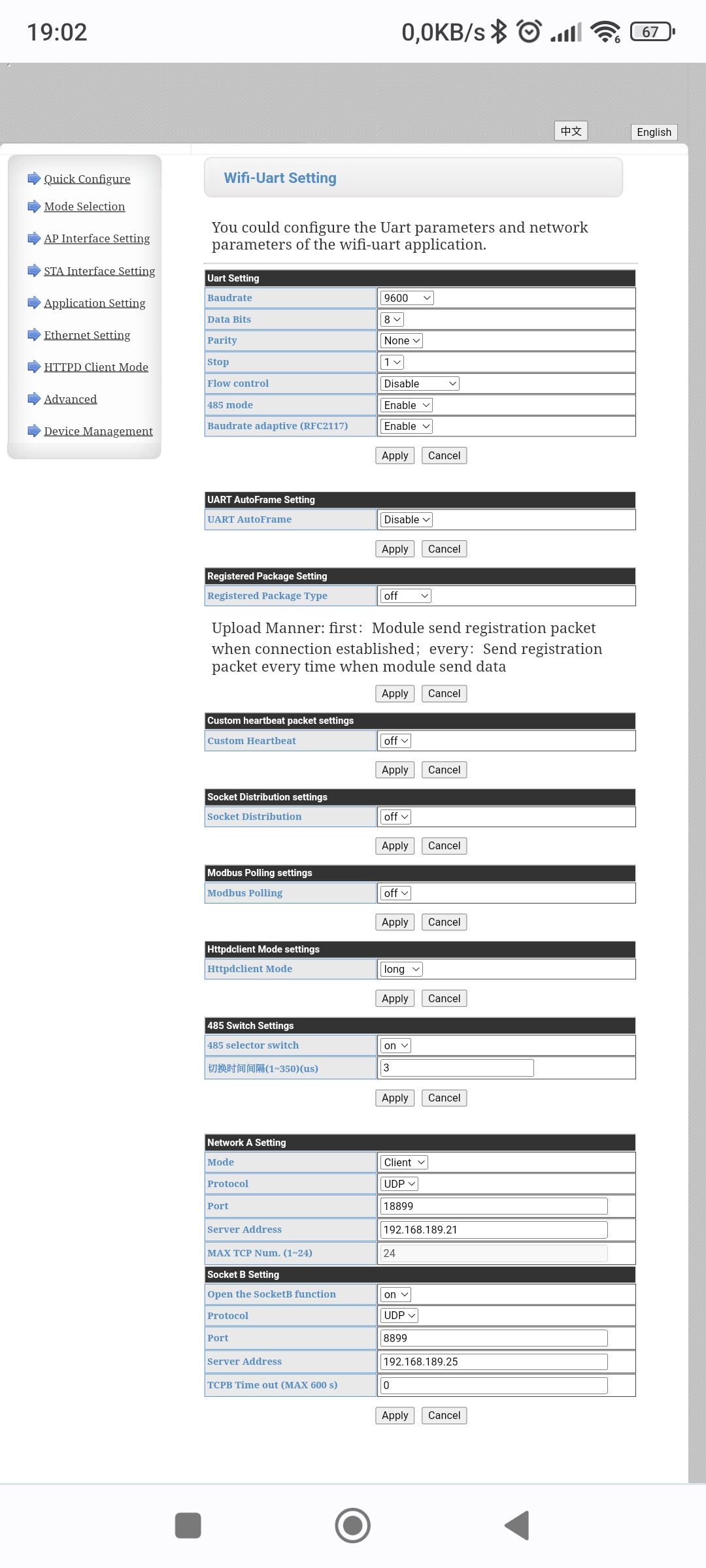
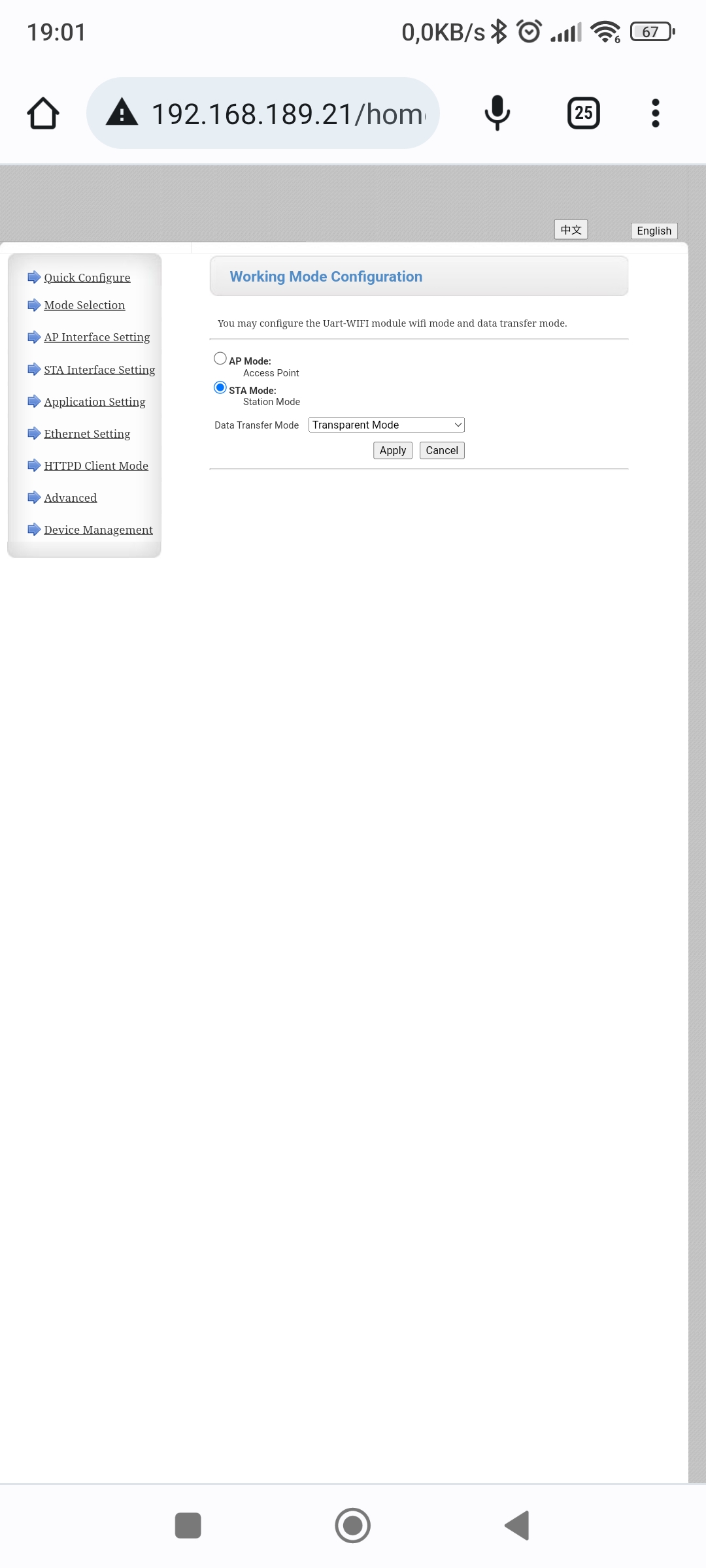
Anschluss
Die SV612 Adapter haben im Set beigefügt auch zwei Stecker mit Kabel. DIe Belegung ist recht eindeutig auf den Adaptern aufgedruckt, hier nochmal als Übersicht:
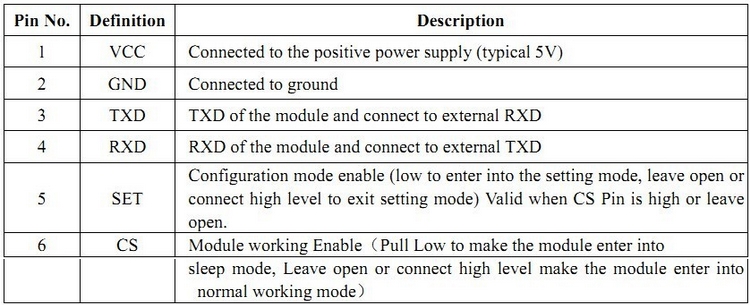
das bedeutet:
1 = Stromversorgung des Adapters Pluspol (3,3 - 7,0V) -> ich habe hierzu ein altes Steckdosennetzteil mit 5V genommen, es geht auch jedes Handynetzteil / USB-Netzteil
2 = Stromversorgung des Adapters Minus
3 = TXD (= Modbus / RS485 Kommunikation)
4 = RXD (= Modbus / RS485 Kommunikation)
5 + 6 = benötigen wir nicht, wird benutzt um den Adapter zu programmieren. Das machen wir mittels beigefügtem USB-Adapter
Zum Anschluss der beiden Funkmodule eines davon an die Limiter-Box anschließen, und zwar an das Schraubterminal rechts unten.

Achtung:
Das die neue Limiter-Box wie im Bild oben hat den RS485 Anschluss rechts unten, die alte Box links unten. Beide sind aber gut erkennbar gekennzeichnet
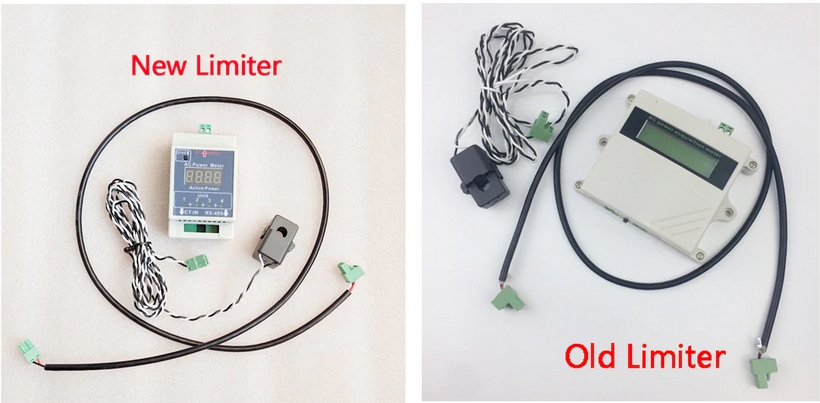
Das zweite Funkmodul entsprechend am Wechselrichter an das Terminal rechts unten anstecken.

Verbindungskontrolle
Modbus / RS485 ist bisweilen etwas zickig, was Plus und Minus angeht.
Zwar sind alle Leitungsanschlüsse mit + und - gekennzeichnet, trotzdem kann es vorkommen, dass etwas nicht passt.
Bei den SV612 Funkmodulen kann man leicht erkennen, ob sie richtig verkabelt sind.
- ist das Sendemodul = an der Limiter-Box korrekt angeschlossen dann blinkt die Kontroll-LED am Funkmodul im Sekundentakt Rot, das bedeutet, es werden Daten vom RS485-Anschluss empfangen und per Funk gesendet. Blinkt diese LED nicht dann einfach mal das Kabel zur Limiter-Box verpolen
- das Empfangsmodul = am Wechselrichter hat eine Verbindung zum Sendemodul aufgebaut, wenn die Kontroll-LED im Sekundentakt blau blinkt, d.h. es werden Daten empfangen. Wenn die LED nicht blinkt ist entweder die Entfernung zu weit oder das Sendemodul sendet nichts
- die Daten kommen korrekt am Wechselrichter an, wenn man auf dem Display dieselbe Watt-ANzeige sieht wie auf dem kleinen Display der Limiterbox. Beide Werte sollten sich im Sekundentakt aktualisieren

Sendeleistung
Was noch erwähnt werden muss ist, dass das SV612 Funkmodul mit einer Sendeleistung von 100mW arbeitet, was über dem üblicherweise in Deutschland erlaubten Wert liegt.
Die erlaubte Sendeleistung bei Kurzwellengeräten also auch 433 MHz und 868 MHz liegt bei 10mW ->Typische Sendeausgangsleistungen @ Wikipedia
Deshalb bitte die Sendeleistung nicht einfach auf Maximum belassen sondern soweit nach unten korrigieren, dass eine Verbindung gerade noch funktioniert
Falls die 100mW noch immer nicht ausreichen sollten, z.B. bei sehr langen Distanzen über Felder gibt es auch noch ein ähnliches Funkmodul mit 500mW, das
NiceRF SV651

Das 2er Set kostet um 42€ inkl. Versand und gibt es z.B. hier -> NiceRF 2 teile/los 433MHz RS232 Interface wireless transceiver modul kit SV652 mit antennen und usb brücke bord
Aber Bitte: wirklich nur benutzen, wenn das SV612 nicht ausreichen sollte. Bei mir reicht das "kleine" schon locker aus für 60m Luftlinie + 2 gemauerte Wände.
Und zusätzlich kann man hier auch noch immer stärkere Antennen verwenden.
Standardmäßig sind nur zwei popelige 3dBi Antennen verbaut, diese kann man auch noch ersetzen gegen welche mit 6dBi, 12dBi oder sogar 18dBi und so die Empfangsleistung um ein Vielfaches verbessern, ohne die Sendeleistung zu erhöhen.
Hier z.B. ein 2er Set mit 12dBi Verstärkung für um 7€

Inhaltsverzeichnis:
- 12.1 Modbus over Ethernet
- 12.2 Modbus over WiFi
- 12.3 Modbus & Solarpower Software für MPI Wechselrichter
- 12.4 Modbus over 433MHz
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
Inhaltsverzeichnis:
- 1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)
- 2 Idee + Plan
- 3 Akku-Arbeitsplatz
- 4 eBike Akku Komponenten
- 5 eBike Akku zerlegen
- 6 Laptop Akkus zerlegen
- 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte
- 8 neue Hülle für 18650
- 9 China-Akkutest
- 10 Werkzeuge + Messgeräte
- 11 Null-Watt Einspeisung
- 12 Modbus / RS485 Adapter
- 13 BMS + Balancer
- 14 aktiv Balancer BMS - JKBMS
- 15 Ladegeräte + Kapazitätstester
- 16 kpl. Akkupacks testen
- 17 Innenwiderstand Ri
- 18 Solar Laderegler
- 19 Wechselrichter, Inverter
- 20 Löten - Anleitung für Akkus
- 21 Schlüsselanhänger aus 18650
- 22 Sicherheitskonzept
- 23 Akkus Beschaffung - wie und wo?
- 24 WVC / SG / GMI / PVGS Mikroinverter
- 25 Schritt-für-Schritt zur 18650 Powerwall
- 26 ATS - Automatic Transfer Switch
- 27 Schottky Sperrdioden für Parallelschaltung
- 28 Balkonsolar & Balkonkraftwerk
- 29 Hybrid Wechselrichter einrichten
13 BMS & Balancer
1.) BMS
BMS steht für "Battery Management System"
Immer dann, wenn man LiIon Zellen in Reihe schaltet ist ein BMS Pflicht. Punkt. Bitte höre nicht auf die Dummköpfe, die etwas anderes behaupten und meinen, das könne man sich sparen. Tu es nicht!
Wenn Du kein Geld hast für ein BMS dann fang erst garnicht damit an, an LiIon Zellen rum zu basteln, das ist richtig gefährlich und kann in einem Hausbrand enden!
Das BMS hat verschiedene Aufgaben, manche Modelle haben mehr Funktionen als andere.
Die wichtigsten Funktionen eines BMS sind:
- Überspannungsschutz des gesamten Akkupacks (= durch fehlerhaftes Laden)
- Unterspannungsschutz des gesamten Akkupacks (= Schutz vor Tiefenentladung)
- Überlastungsschutz
- Überhitzungsschutz
- Einzelzellüberwachung: Über- sowie Unterspannungsschutz (= durch Spannungsdrifting oder fehlerhafte Zellen)
- einige BMS haben ein LCD Diyplay zum Anzeigen der Werte, manche auch eine Bluetoothverbindung + App
Wichtige Auswahlkriterien:
- Dauerbelastbarkeit in Ampère
- Maximalbelastbarkeit
- für wieviele Zellen in Reihe ist das BMS geeignet? idR ist ein BMS immer nur genau passend für z.B. 7S (= 7 Zellen in Reihe / 24V) und kann nicht für ein z.B. 10S (36V) System benutzt werden. Auch andersherum ist ein BMS für 10S idR nicht für 7S verwendbar. Es gibt Ausnahmen, da kann man größere BMS auch für kleinere Systeme benutzen, aber das ist nicht die Regel und steht dann expliziet in der Herstellerbeschreibung mit dabei
Vor dem Kauf musst Du Dir folgende Fragen stellen:
- für wieviel "S" brauchst Du ein BMS?
- wieviel Ampère wirst Du dauerhaft aus der Powerwall entnehmen?
- Display / App oder nicht?
Schonmal vorweg: BMSe sind so ein typisches elektronisches Bauteil, das es fast ausschließlich über Aliexpress gibt.
Klar findet man auch welche bei Amazon, eBay oder Banggood, aber erstens nur einen Bruchteil der Modellauswahl und zweitens zu absolut überteuerten Preisen.
Also wenn Du Dir einen Gefallen tun willst: leg Dir einen Account bei Aliexspress an und gewöhne Dich dort ein. Ist im Grunde ähnlich wie eBay nur in China, mit rein chinesischen Händlern.
Die meisten der für einen DIY 18650 Powerwall / Solarakku benötigten Teile gibt es (nur) auf Aliexpress, es lohnt sich also, sich dort umzuschauen.
Typisch für Aliexpress: einen Artikel findet man bei mindestens 20 Händlern, idR zu ähnlichen Preisen. Und: die Händler kommen und gehen, neue kommen dazu. Zudem sind alle Preise auf Aliexpress auch mehr oder minder tagespreise. Was heute ein Spitzenpreis ist kann morgen schon überteuert sein und woanders viel günstiger.
Es lohnt sich also nicht, wenn ich hier Links direkt zur Artikelbeschreibung eines Händlers schreibe, denn höchstwahrscheinlich gibt es in 6 Monaten den Artikel bei ebendiesem Händler nicht mehr oder er ist dort mittlerweile sehr teuer.
Stattdessen geht man bei Aliexpress wie folgt vor:
- immer wieder die Suche benutzen
- Artikel-Titel so gut es geht in die Suche eingeben
- am Artikelbild orientieren
- Händler mit den besten Konditionen auswählen und bestellen
Die gängigsten BMS-Modelle
1. günstig und schlicht

das ist ein typisches Standard-BMS, markenlos. Gibt es so oder in ganz ähnlicher Optik (manchmal ohne Metallplatte obenauf) von 3S bis 14S
- um 15€
- meist ist bei um 35A Schluss
- kein Display / App
- Spannungswerte nicht einstellbar
- manche machen Werbung mit einem integrierten Balancer, wobei der Balancingstrom hier bei mickrigen 15 - 60mA liegt
- brauchbar für kleinere Projekte wie Camping-Akku, Lautsprecherbox, eBike-Akku, aber nicht für eine Powerwall. ALlenfalls noch für eine kleine Balkonkraftwerk-Anlage
- bei Aliexpress zu finden über die Suche-Schlagwörter "BMS 10S" oder 13S oder wie auch immer gewünscht
2. stark und teuer
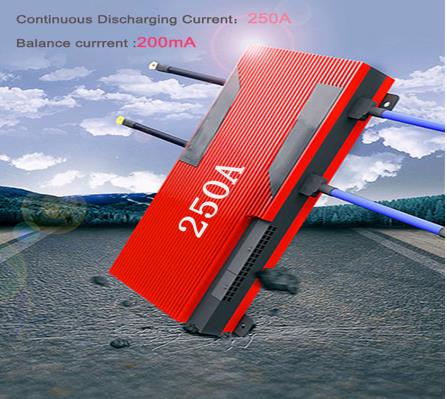

das sind zwei Modelle von "Daly"
- hoch belastbar, teilweise mit 300A Dauerstrom
- für Dauerbetrieb in einer Powerwall geeignet
- Balancingstrom bis zu 200mA (immer noch sehr wenig aber für einen Campingakku sollte das ausreichend sein)
- nicht mehr ganz billig, um 100€ oder mehr
- Ali Suchworte: "Daly BMS" oder "BMS 13s" und dann scrollen
3. mit Konnektivität

Das ist das recht verbreitete "ANT BMS"
- gibt es "nackt" oder optional mit LCD Display oder App oder beides
- Spannungs- und ABschaltwerte einstellbar = sehr flexibel in der Nutzung
- in vielen unterschiedlichen Versionen (Stromstärke und Anzahl der "S") verfügbar
- Preis liegt bei um 60 - 90€ je nach Variante
- Alisuche: "Smart BMS"
4. DIY BMS v2.0 von Andreas Schmitz
- modular und wireless
- zum Selbstbauen
- mit Arduino / Wemos D1 Mini
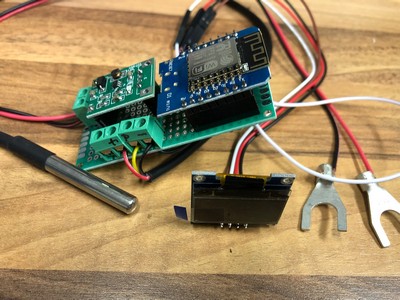
Bildquelle: DWL @ Balkonsolar-Forum
Vorstellungsvideo:
-> zum Thread im Balkonsolar-Forum
5. DIY BMS von Stuart Pittaway
- zum Selbstbauen
- mit Arduino
- vorbestückte Platinensätze bestellbar
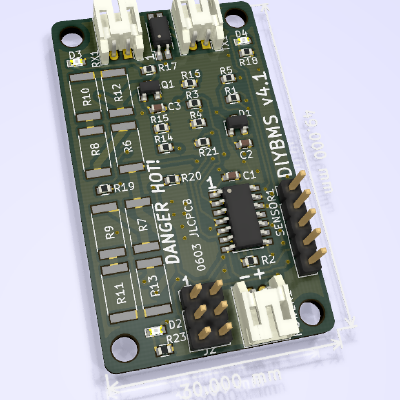
Vorstellungsvideo:
2.) Balancer
Anders als ein BMS ist ein Balancer optional und nicht zwingend erforderlich.
Je größer der Speicher ist, desto mehr halte ich einen Balancer für sinnvoll, und gerade bei der Verwendung von gebrauchten Akkuzellen.

Funktionsweise eines Balancers
Verbindet man Akkuzellen mit unterschiedlichen Spannungen parallel, so gleichen sich diese aus, sie balancieren sich elektrisch. Von ganz alleine, da braucht man nichts zutun.
Anders sieht es aus bei einer Reihenschaltung. Hat man nun mehrere Zellen in Reihe, also seriell geschaltet, können sich unterschiedliche Spannungen nicht ausgleichen.
Das kann in zwei Situationen problematisch werden.
1. beim Laden
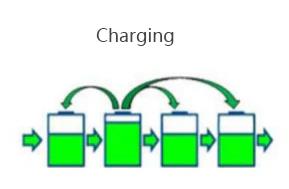
Gehen wir von einem 10S1P System aus, also 10 Zellen in Reihe geschaltet, bei der eine Zelle 0,5V höher liegt als alle anderen.
Bei 36,5V Gesamtspannung liegt die Zell-Einzelzellspannung bei gesunden 3,6V, nur bei der einen liegt sie schon bei 4,1V - was noch unproblematisch ist.
Doch beim Laden steigt die Spannung weiter. Bei 40,5V Gesamtspannung liegt die EInzelspannung bei 4,0V und bei der einen schon bei 4,5V - was viel zu hoch ist, diese Zelle wird bereits überladen und erhitzt sich sehr stark.
Das Laden eines 10S Systems wird idR erst bei 42V beendet, also bei 4,20V Einzelspannung. Doch unsere Zelle hat dann bereits knappe 4,7V und ist somit äußerst gefährlich überladen. Übrigens um genau einen solchen Fall zu schützen sollte man dringlichst ein BMS benutzen, welches alle einzelnen Zellen überwacht und nicht erst bei 42V Gesamtspannung abschaltet, sondern auch dann, sobald eine beliebige Zelle die 4,20V Einzelspannung erreicht hat. Was zur Folge hat, dass alle anderen Zellen nicht weiter als bis 3,7V geladen werden - wir verschenken also enorm viel Kapazität.
2. beim Entladen
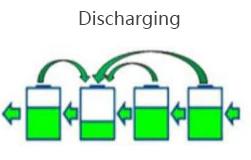
Ähnlich ist es, wenn eine Zelle z.B. 0,5V weniger hat als der Rest. Beim Entladen des AKkupacks kommt diese eine Zelle schneller in den Bereich der Tiefenentladung als die anderen. Das BMS sollte dann bei einem Wert um 2,8V (manchmal auch 2,6V) abschalten, um ein schädliches Tiefentladen der Zelle zu verhindern. Und auch hier verschenken wir enorm viel Kapazität, da die anderen Zellen dann noch immer halb voll sind.
Um das nun zu verhindern kommt ein Balancer ins Spiel: Ein Balancer hat die Aufgabe, ungleiche Spannung aufzuheben.
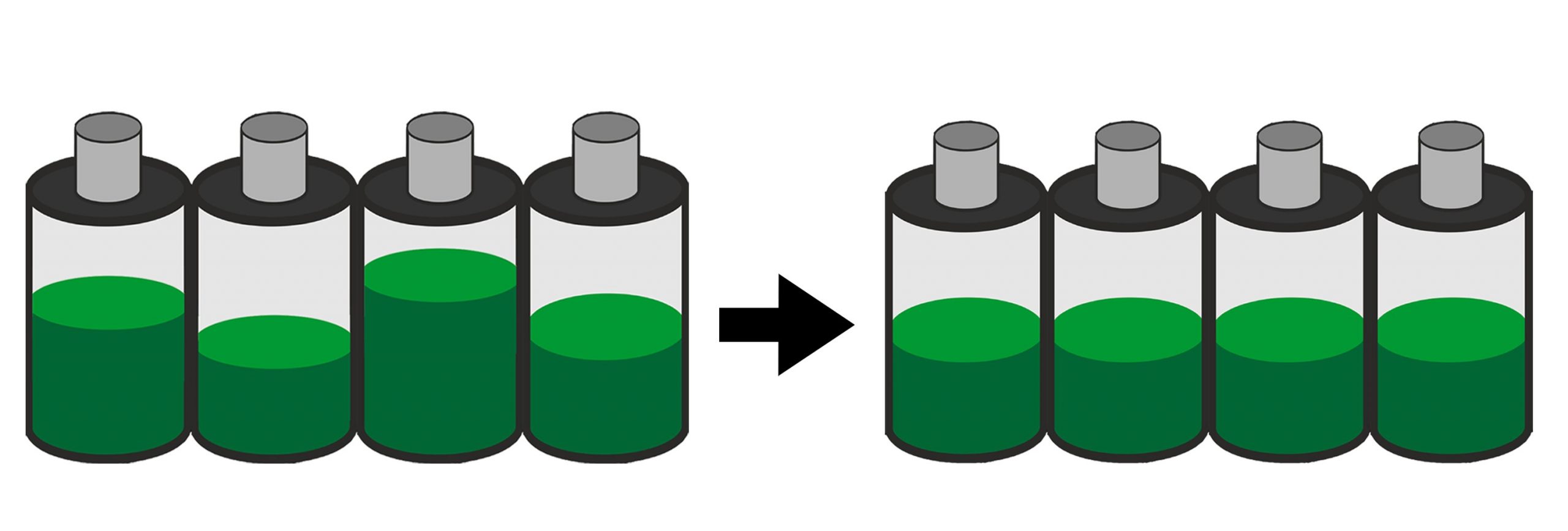
Es gibt zwei Arten Balancern: aktiv und passiv
1. passive Balancer
Ein passiver Balancer arbeitet nur beim Laden. Genauer: nur bei Vollladung. Mittels eines Widerstandes (oder mehrerer) "verbrennt" er die Energie der Akkuzellen, die als erstes die 4,20V erreichen, bis alle Zellen wieder gleichauf sind.
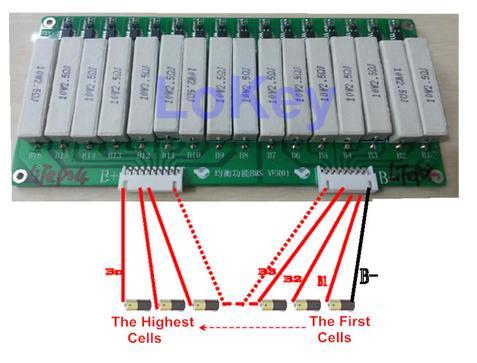
Batrium ist als BMS auch mit einer passiven Balancerfunktion ausgestattet (um 800€)
2. aktive Balancer
Aktive Balancer transferieren Strom von der Zelle mit der höchsten Ladung hin zur Zelle mit der niedrigsten Ladung.
Hier gut zu sehen: von der starken Zelle Nr. 8 (blau hinterlegt) wird Strom übertragen in die schwache Zelle Nr. 13 (rot)
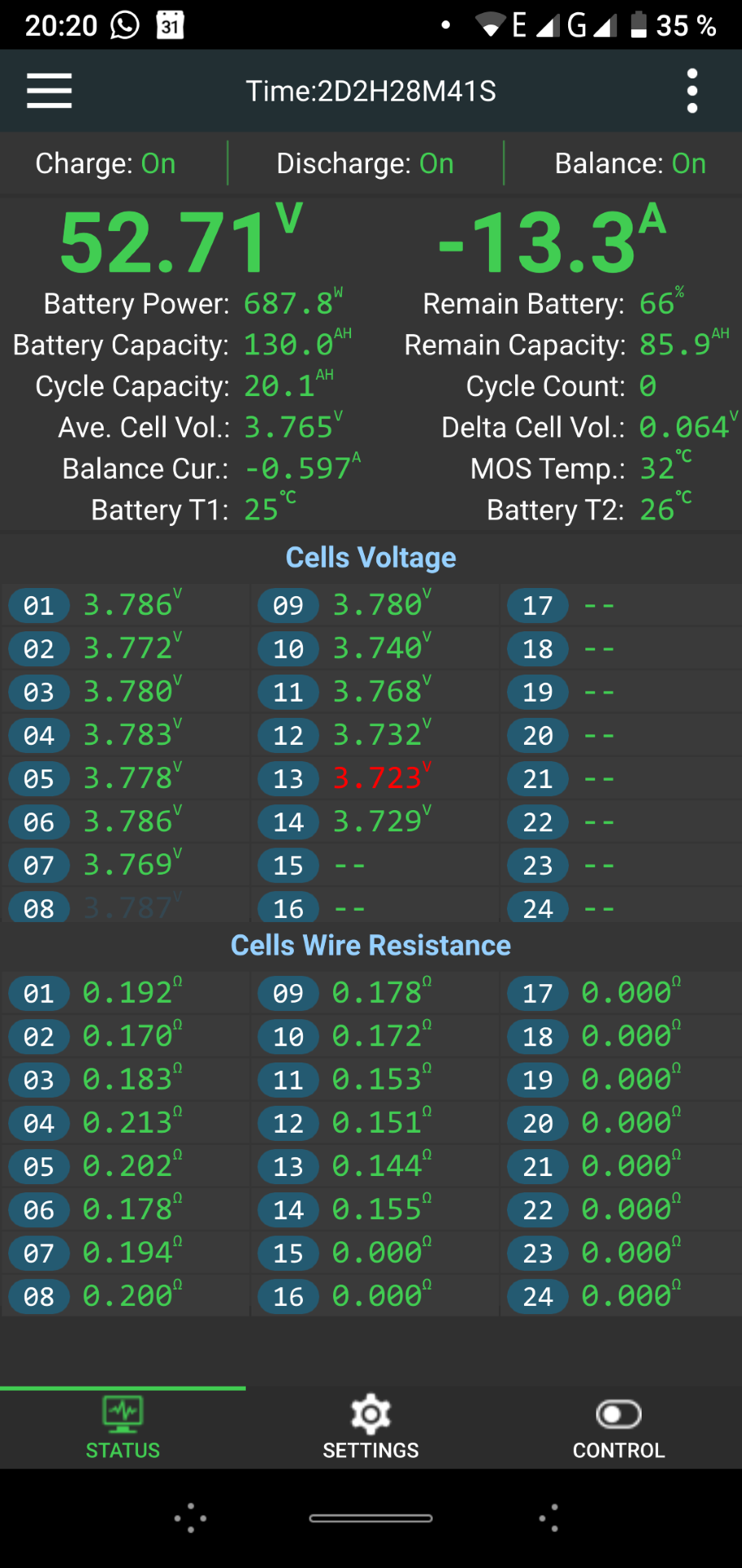
Die gängigsten Balancer Modelle
Da ich selbst nur aktive Balancer nutze verweise ich auch nur auf solche.
1. günstig
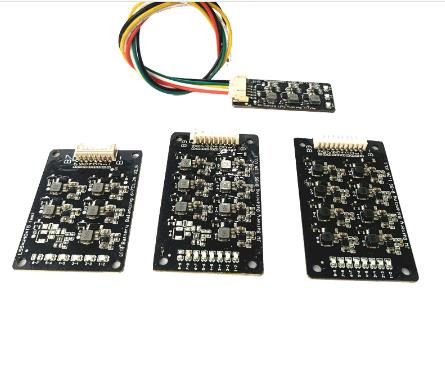
- funktionieren und tun, was sie sollen
- um 1 - 1,5A Balancingstrom = brauchbar auch für Powerwall
- um 25€ für 14S
- kein Monitoring -> fehlerhafte Zellen werden so "verschleiert"
- keine Einstellmöglichkeiten der Werte
- Ali-Suche: "Aktiv Balancer 1,2A"
2. mittel-teuer

- in sehr vielen Varianten verfügbar
- bis zu 5A Balancingstrom = sehr viel
- kostet um 45€ als 1S Variante
- kein Monitoring -> fehlerhafte Zellen werden so "verschleiert"
- keine Einstellmöglichkeiten der Werte
- Ali-Suche: "Aktiv Balancer 5A"
3. skalierbar

- ein Gerät = für 1S, d.h. man benötigt proSerienschaltung einen Balancer. Diese kann man unendlich aneinander koppeln
- etwa 20 - 40€ pro Gerät, bei 14S entsprechend mind. 280€
- kein Monitoring -> fehlerhafte Zellen werden so "verschleiert"
- keine Einstellmöglichkeiten der Werte
- Ali-Suche "aktiv Balancer QNBBM"
4. teuer mit Monitoring

- in verschiedenen Varianten verfügbar mit 1A / 2A / 5A / 10A Balancingstrom
- sehr flexibel bis 24S (alle Versionen können von 2S bis 24S eingesetzt werden)
- Monitoring per APP -> fehlerhafte Zellen werden erkannt
- viele EInstellmöglichkeiten aller Werte
- um 130€ für die 2A Variante
5. 4A mit Monitoring

- App / Monitoring basiert auf dem teuren JKBMS von oben
- 4A Balancingstrom ist schon ordentlich viel
- auf Aliexpress
6. 10A ohne Monitoring

- sehr preiswert
- sehr stark (1,2A je 0,1V Zellspannungsdifferenz)
- balanciert die Zellen gleichzeitig
- auf Aliexpress
Es gibt noch eine Sonderform:
7. BMS mit integriertem aktiven Balancer und App-Monitoring
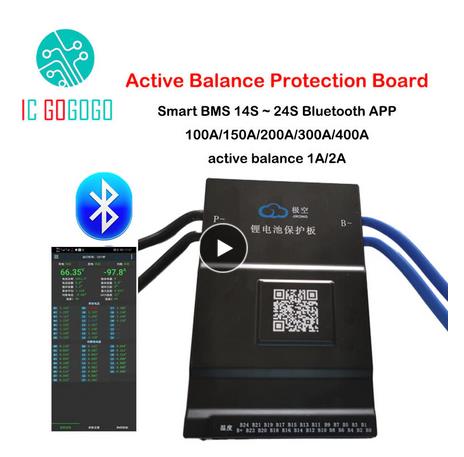
Da ich diese vom Funktionsumfang, Preis/Leistung und in der Handhabung (beide Geräte in einer Benutzeroberfläche) sehr gut einstufe nutze ich dieses Gerät selbst auch in mehreren Varianten und möchte dazu im separaten nächsten Punkt näher darauf eingehen.
Inhaltsverzeichnis:
- 1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)
- 2 Idee + Plan
- 3 Akku-Arbeitsplatz
- 4 eBike Akku Komponenten
- 5 eBike Akku zerlegen
- 6 Laptop Akkus zerlegen
- 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte
- 8 neue Hülle für 18650
- 9 China-Akkutest
- 10 Werkzeuge + Messgeräte
- 11 Null-Watt Einspeisung
- 12 Modbus / RS485 Adapter
- 13 BMS + Balancer
- 14 aktiv Balancer BMS - JKBMS
- 15 Ladegeräte + Kapazitätstester
- 16 kpl. Akkupacks testen
- 17 Innenwiderstand Ri
- 18 Solar Laderegler
- 19 Wechselrichter, Inverter
- 20 Löten - Anleitung für Akkus
- 21 Schlüsselanhänger aus 18650
- 22 Sicherheitskonzept
- 23 Akkus Beschaffung - wie und wo?
- 24 WVC / SG / GMI / PVGS Mikroinverter
- 25 Schritt-für-Schritt zur 18650 Powerwall
- 26 ATS - Automatic Transfer Switch
- 27 Schottky Sperrdioden für Parallelschaltung
- 28 Balkonsolar & Balkonkraftwerk
- 29 Hybrid Wechselrichter einrichten
14 JKBMS von Jikong
das JKBMS ist ein aktiv Balancer BMS = Kombigerät mit BMS und aktivem Balancer in einem

Wie immer gilt auch hier: ich möchte keine Werbung dafür machen, es gibt keine Affiliate Links, keine Ads, keine Werbebanner, keine Reflinks - ich bekomme weder Geld noch Material dafür und habe rein garnichts davon.
Ich möchte lediglich meine Erfahrung mit anderen Menschen teilen.
Gekauft habe ich die Geräte bei Aliexpress über D.YU.K.B store = Dykbhuang Store mit denen ich übrigens aktuell in einem Dispute bin
Der Verkäufer verweigert bisher einen Umtausch / Rückerstattung. Ich werde berichten, ob es besser ist bei diesen Shop nicht zu bestellen, oder ob es doch noch Service gibt. Ansonsten werde ich einen besseren Shop nennen.
Nachtrag: ist leider nicht gut ausgegangen, deswegen hier die -> Warnung vor Verkäufer D.YU.K.B Dykbhuang Store auf Aliexpress
01 Einstieg
Ich selbst nutze mehrere davon

- alte Version in kantigem Gehäuse mit 0,6A Balancingstrom = wieder verkauft da mir das zu wenig war für meine erste Powerwall
- alte Version mit 2A Balancingstrom und 150A/300A -> läuft aktuell an meinem 4,3KWh 18650 Testakku in 14s60p Konfiguraton
- die aktuelle Version mit 2A Balancingstrom und 150A/300A (Bild oben) läuft an meiner zweiten 18650 PW mit 6,8KWh in 14s60p Konfiguraton sowie an der großen mit 2x 14s120P
- die ganz neue abgespeckte Version mit 0,6A Balancingstrom / 60A/120A (um 55€) läuft an der kleinen 3KWh in 14s40p sowie geplant auch für die nächste 14S60P Powerwall mit um 4KWh
Pro:
- laufen sehr gut, BMS-Part funktioniert einwandfrei und zuverlässig, der Balancer arbeitet auch sauber.
- Verarbeitung ist auch topp, robustes Metallgehäuse, kein Plastikfirlefanz
- Bluetooth-App mit umfangreichen Einstellmöglichkeiten für alle möglichen Spannungs- und Stromstärkewerte, Abschaltungs-Grenzwerte und Balancing-Optionen
- sehr individuell auf die eigenen Gegebenheiten anpassbar
- nutzbar von 14S bis 24S
- für LiIon, LiFePo4, LTO
- Kabelquerschnitte sind ordentlich dimensioniert
Kon:
- Handbuch ist eine Katastrophe, beim offiziellen Downloadlink fehlt die Hälfte im Handbuch, speziell die Passwörter und die BMS-Funktionalität. Weiter unten findest Du ein erweitertes Handbuch sowie Zusatzinfos und Passwörter.
- die APP ist bissel verbuggt. Es kommen regelmäßig neue Versionen raus und seit der 2.9.xx läuft alles schon um einiges besser, aber trotzdem werden manche Zahlenwerte bei der Eingabe nicht akzeptiert, da muss man dann mehrmals probieren
02 Versionen & Varianten
es gibt mehrere Versionen des aktiv BMS, rein vom Äußeren gibt es drei
Nr. 1 - die alte, kantige Version mit Ausschnitten im Deckel

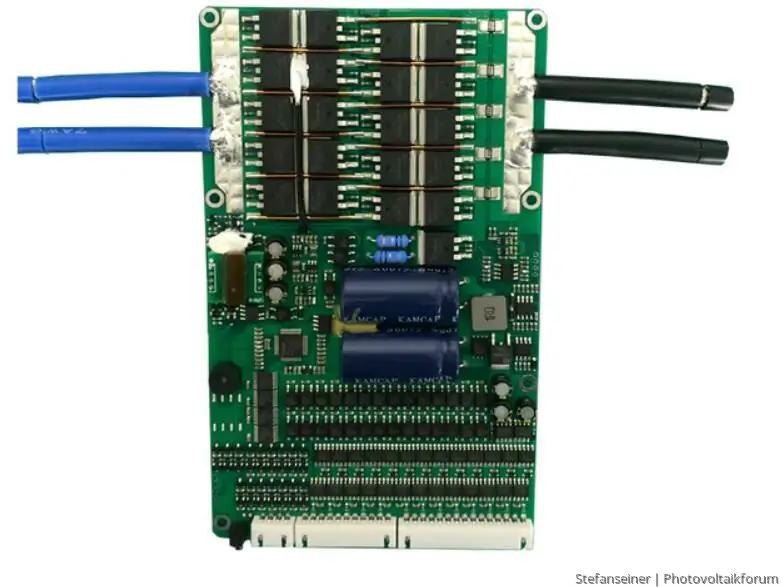
Nr. 2 - die aktuelle Version
Der interne Aufbau ist offensichtlich 1:1 derselbe, lediglich das Gehäuse ist besser. Keine Ausschnitte und abgerundete Ecken, dickeres Metall, QR-Code (der nicht funktioniert) aufgedruckt

Maße
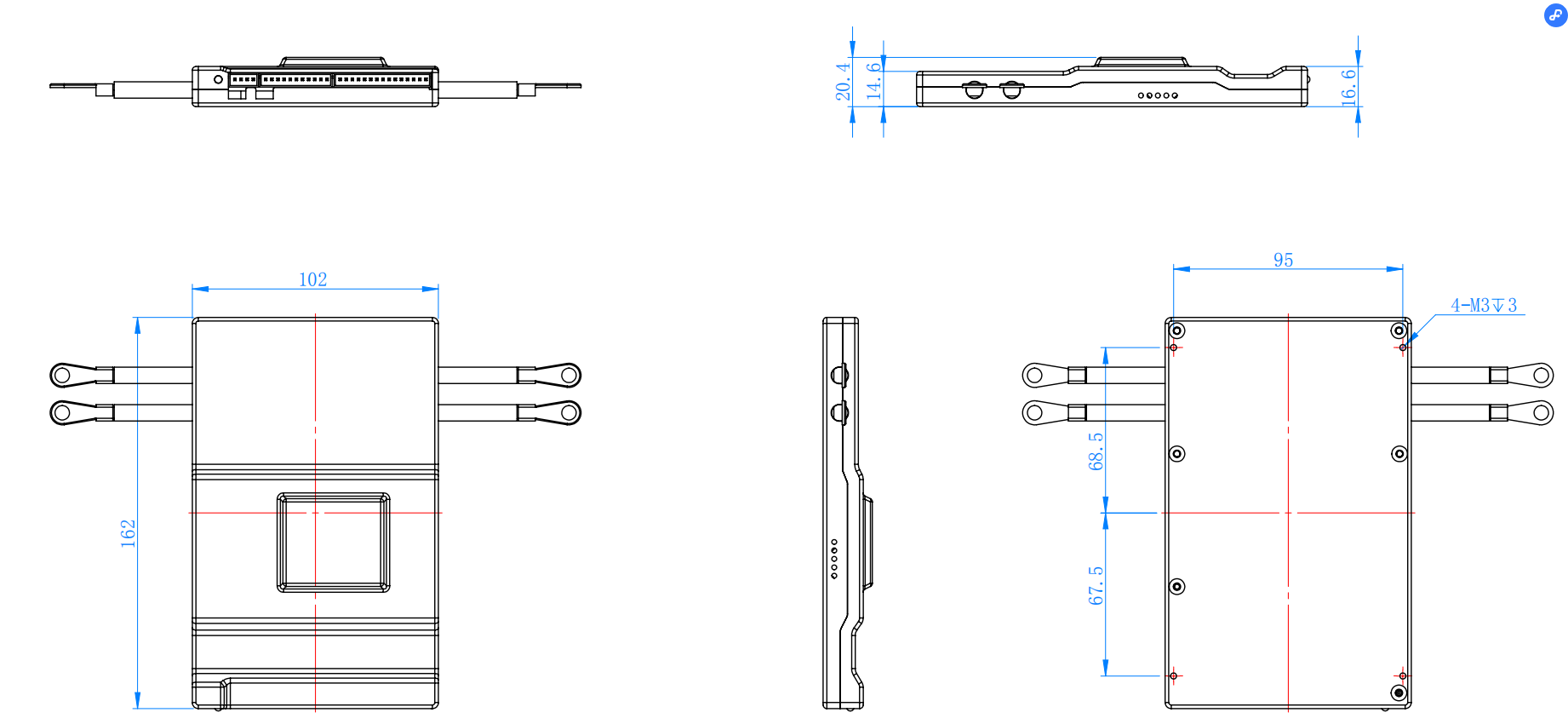
Bild mit Maßen in Originalgröße zum Download: klick
zudem haben alle Varianten der aktuellen Version auch einen Canbus- sowie einen RS485 Anschluss mit an Bord. Bei der alten Version war beides optional / aufpreispflichtig.
Mit beiden kann man Daten des JKBMS abgreifen und verarbeiten, zusätzlich zur Bluetooth App.
Achtung: dazu braucht man noch ein separates Zwischenstück für um 7€. Zum Thema RS485 / Canbus ganz am Ende mehr als separates Kapitel

Nr. 3 - die "abgespeckte" Version
- "nur" noch nutzbar für 13S bis 17S
- 0,6A Balancingstrom, 60A/120A Belastbarkeit
- Anschluss, Funktionalität und Bluetooth-App sind identisch mit den großen Versionen

der interne Aufbau ähnelt stark den großen, ist nur leistungsmäßig reduziert

gibt es mit Canbus sowie RS485 Erweiterung wobei nur eine nutzbar ist. Die großen Varianten können beides gleichzeitig, diese kann nur je eine

Varianten
von der alten sowie der aktuellen Version gibt es jeweils folgende Varianten:
- BD6A20S-10P -> 0,6A Balancingstrom, bis 20S, 100A Dauerbelastbarkeit / 200A max.
- BD6A24S-10P -> 0,6A Balancingstrom, bis 24S, 100A Dauerbelastbarkeit / 200A max.
- B1A24S-15P -> 1A Balancingstrom, bis 24S, 150A Dauerbelastbarkeit / 300A max.
- B2A24S-15P -> 2A Balancingstrom, bis 24S, 150A Dauerbelastbarkeit / 300A max.
- B2A24S-20P -> 2A Balancingstrom, bis 24S, 150A Dauerbelastbarkeit / 350A max.
die abgespeckte Version gibt es nur als
- BD6A17S-6P -> 0,6A Balancingstrom, 13S bis 17S, 60A Dauerbelastbarkeit / 120A max.
Preistreiber bei allen Varianten ist der Balancingstrom. Und genau das ist auch die interessante Kernkomponente, denn der BMS-Teil ist in seiner Funktionalität überall gleich und als Powerwall sind idR auch keine ultrahohen-Ströme gefragt. Bei 1A je Zelle sind das in einem 14s60p System maximal 60A die fließen (sollten), also würde hier schon das kleinste Modell ausreichen.
Aber:
0,6A Balancingstrom sind sehr knapp bemessen. Bei meinem ersten Testakku in 14s60p mit "nicht ganz so guten" Laptopakkus und 4,3KWh hat es das 0,6A Modell nicht geschafft, die Zellen zu balancieren.
1A sind jetzt auch nicht so viel mehr,
also empfehle ich das 2A Modell mit 150A
Das Sparpotential zur kleineren 1A Version lohnt nicht, und die größte Version mit 350A max. dürfte für unsere Powerwall überflüssig sein.
Höchstens die abgespeckte Version dürfte noch interessant sein für kleinere Powerwalls oder solche, die nicht stark beansprucht werden oder wo die Zellen bereits sehr gut abgestimmt und in sich balanciert sind, oder bei der Verwendung von neuen Zellen.
Also mein Tipp:
- bei gebrauchten Zellen und einer Größe ab 3,5KWh -> B2A24S-15P
- bei neuen Zellen oder einer Größe unter3,5KWh -> BD6A17S-6P
Bezugsquellen
Erhältlich: bei z.B. Aliexpress oder Amazon oder eBay
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
Übersicht aller Varianten mit technischen Daten
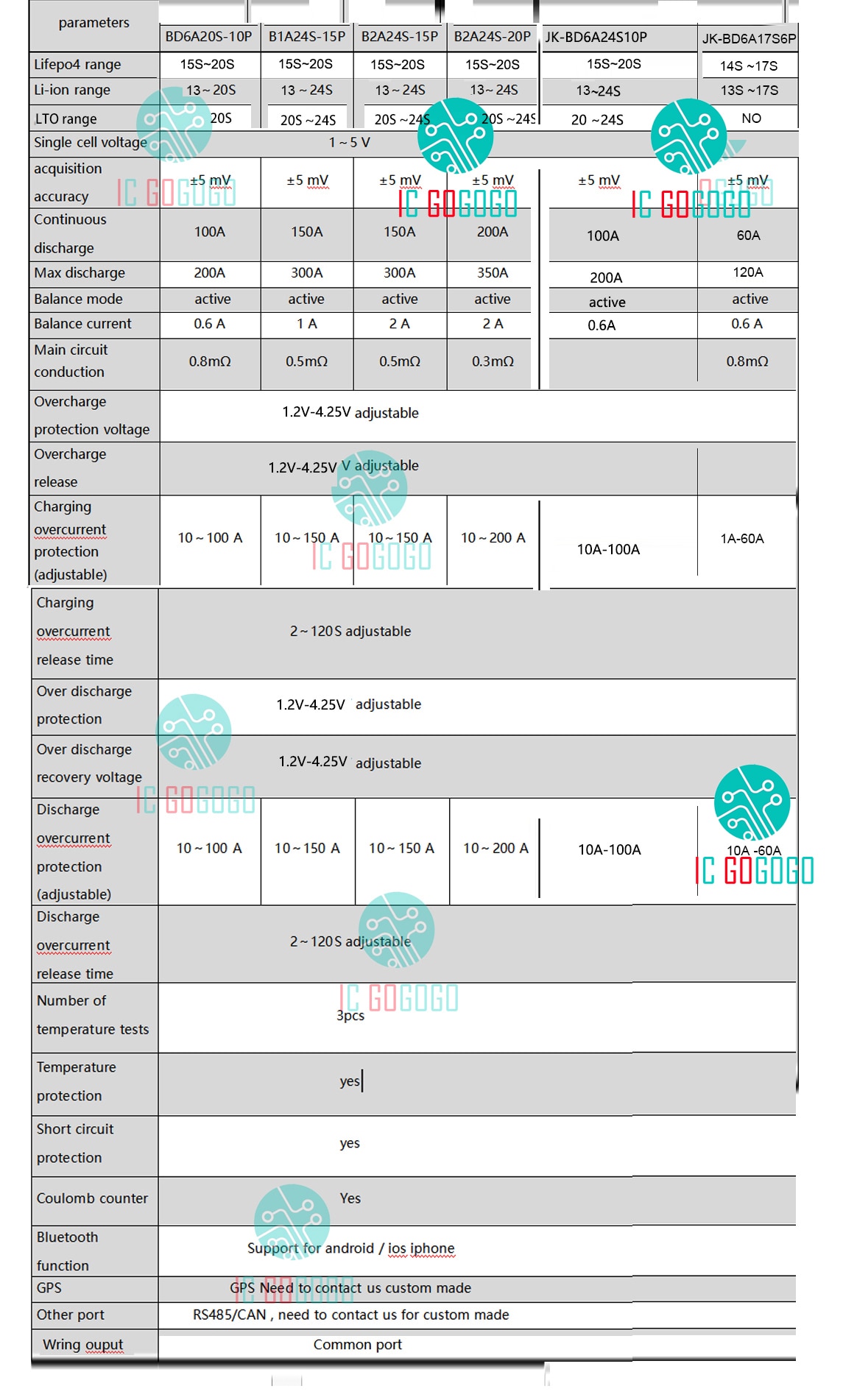
Übersicht als Großbild hier -> klick
03 Bluetooth App
Die neueren Geräte kommen alle mit einem QR-Code auf dem Deckel, der zum Download der App führen sollte. Zumindest bei meinen Geräten wurde die Seite nie gefunden und über den Google Playstore findet man die App auch nicht.
Hier der offizielle Downloadlink zur App und zum (unvollständigen) Handbuch -> https://active.clewm.net/BApbC0
Im Abschnitt 5 findest Du nochmal ergänzende Infos zu den Punkten, die im Handbuch fehlen
Die App sieht dann so aus:
Das ist der "Status" mit Echtzeitanzeige aller wichtigen Werte.
Hier sieht man auch schön, dass der Balancer aktiv ist und von der stärksten Zelle (Nr. 14) in die schwächste (Nr. 3) Strom lädt.
Links oben sieht man unter "Balance Current", dass mit knappen 2A transferiert wird. "Delta Cell Voltage" zeigt die größte Spannungsdifferent zwischen den Zellen an
Ganz rechts oben die "0.0A" bedeuten, dass gerade weder geladen noch Strom entnommen wird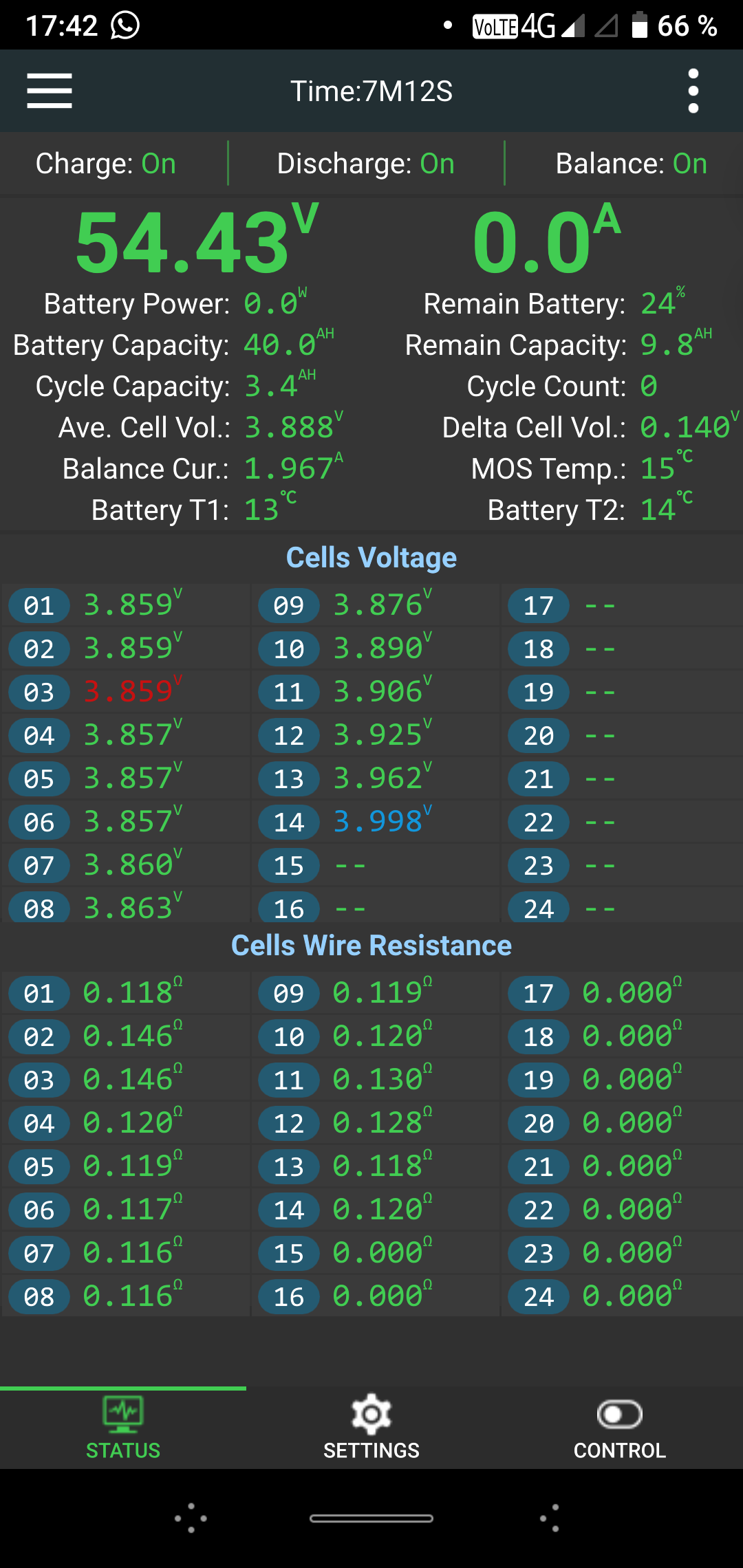
der "Settings" Bereich zum Einstellen aller Werte.
Hier kann man vor allem einstellen, bei welcher Unter- oder Überspannung das BMS als Schutzfunktion den Akku trennen soll

hier sind in erster Linie die maximalen Stromstärken einstellbar, bei denen das BMS ebenfalls zum Schutz den Akku abschaltet

Temperaturschutzfunktion für Übertemperatur des Akkus sowie auch des BMS sowie Ladeschutzfunktion bei Untertemperatur

Im Menüpunkt "Control" kann man dann nur noch manuel folgende Punkte aktivieren oder deaktivieren
- Charge
- Discharge
- Balance
Man kann also beispielsweise ein Laden zulassen, aber gleichzeitig ein Entladen verhindern, oder die Balancing-Funktionalität deaktivieren
Hier als Video, wie man das JKBMS einstellt:
04 Anschließen & verkabeln
Die allermeisten BMS werden im Grunde gleich angeschlossen, so auch dieses.
Hier beispielhaft der Anschlussplan für eine 14S Konfiguration
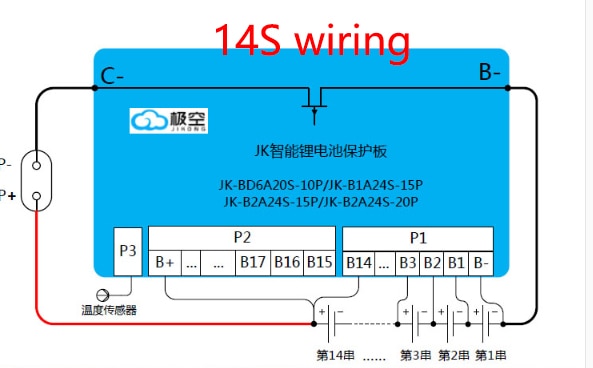
- P3 ist der Stecker für die externen Temperatursensoren
- C- ist falsch, am BMS ist die Beschriftung "P-" und kommt an "Power -" also an das Ladegerät / den Wechselrichter
Anstatt die dünnen Käbelchen alle fest mit den Akkupacks zu verlöten benutze ich Krokodilklemmen (Aliexpress / eBay)

so kann man die Akkupacks später leichter wieder ausbauen z.B. zu Wartungszwecken
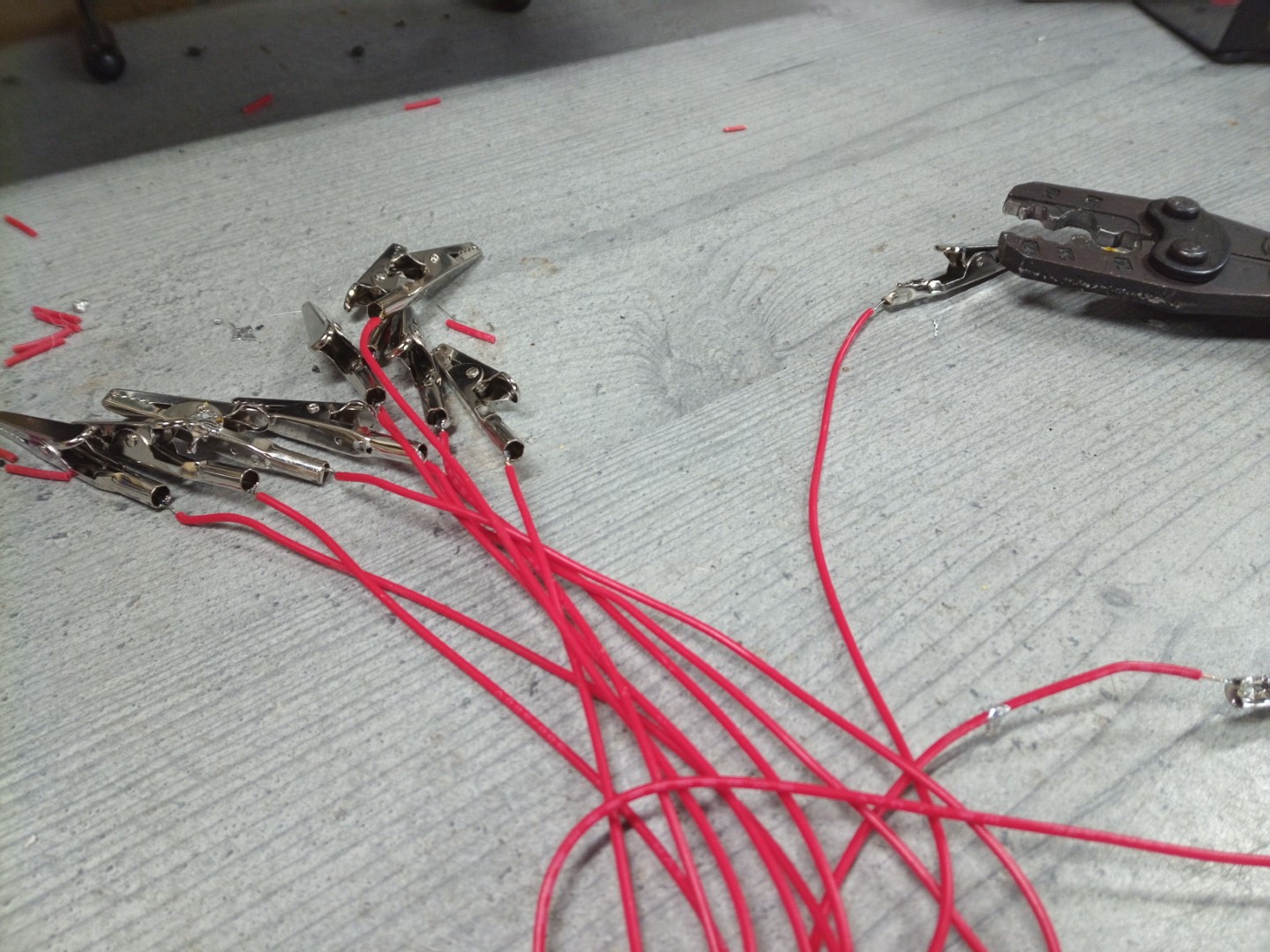
auf allen Verkaufsbildern immer zu sehen, aber in Wirklichkeit nicht montiert: Ringkabelschuhe an den Hauptkabeln, die muss man noch selbst kaufen und anbringen. Idealerweise Crimpen + Löten

optional: da das BMS bei mir flach aufliegt habe ich Muttern als Abstandshalter an die Unterseite geklebt, damit etwas Luft zur Kühlung zirkulieren kann

jetzt kommt eine Besonderheit, die im orig. Handbuch nicht erwähnt wird: um das BMS zu starten braucht man einen kurzen 5V Impuls zwischen B- und P- (bzw. C-)

ich nehme dazu zwei Akkuzellen in Reihe, das sind dann 7,4V und das funktioniert auch prima, dazu ein Miniaturtaster, der beim Drücken kurz Spannung auf B- und P- gibt und somit das BMS einschaltet

optional: bei der Verkabelung des BMS habe ich noch einen kleinen 12V Festspannungsregler / Step-Down / Buck Converter mit verbaut.

Für Kleinkram wie Lüfter, Lüftersteuerung, externe Spannungsanzeige. Wer sowas nicht braucht kann den Festspannungsregler weglassen. Aber bitte keinen Strom direkt von den Akkupacks abgreifen, das belastet die Packs ungleichmäßig + im Falle einer leeren Batterie, wenn das BMS den Wechselrichter abschaltet, werden bei einem direkten Stromabgriff an den Packs diese gnadenlos leergesaugt und tiefenentladen -> schon ausprobiert 😕
Also wenn Du eine zusätzliche Spannung für irgendwas benötigst dann immer nur über die beiden Haupt-Pole hinter dem BMS und entsprechend mit Spannungswandlern arbeiten
sieht dann bei mir so aus
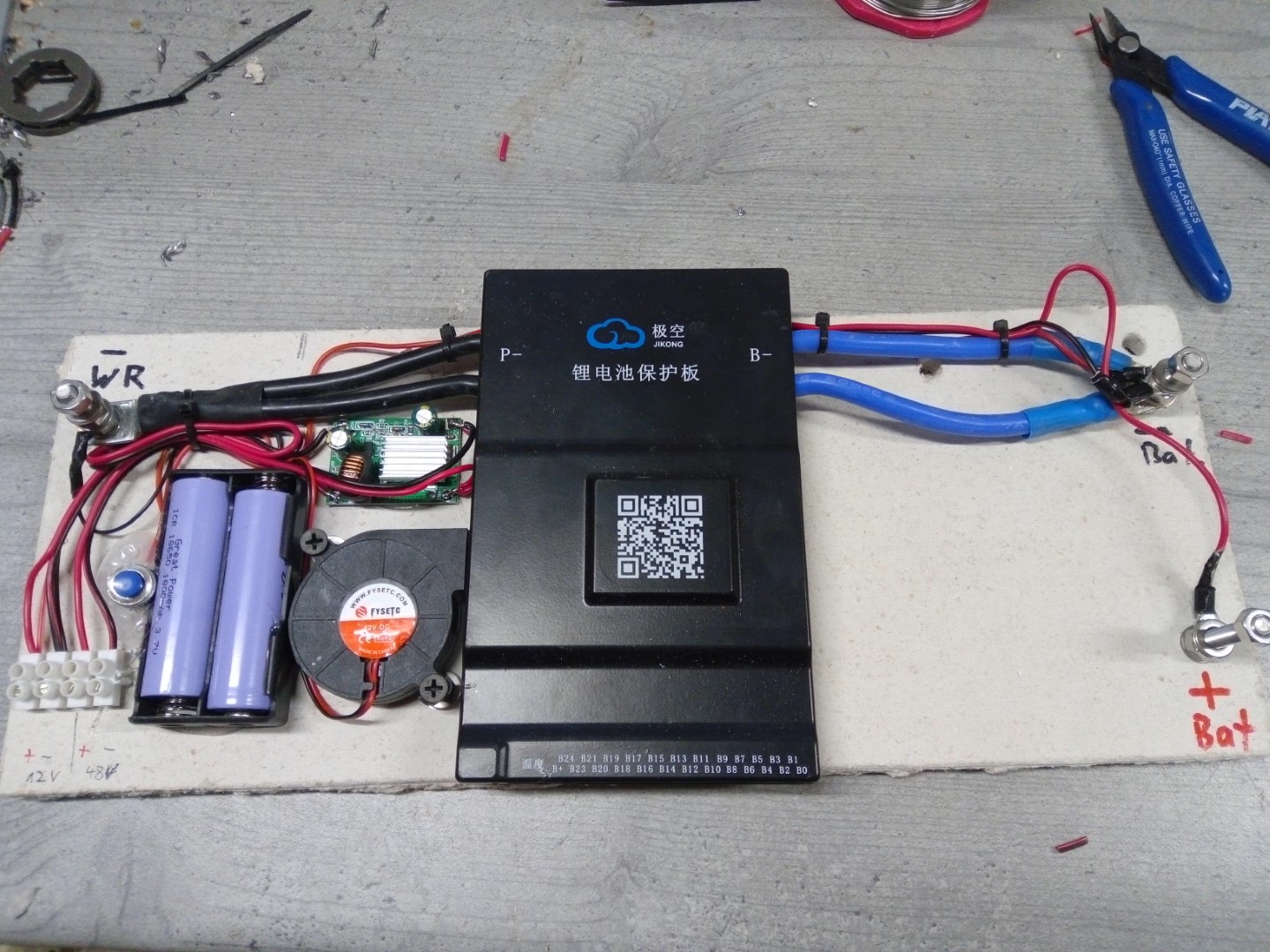
Den Lüfter braucht man idR auch nicht, bei mir sitzt die komplette Powerwall in einer gedämmten Kiste und das BMS wird direkt mit Mineralwolle bedeckt, obenrum kann also keine Luft zirkulieren und so kann es auch keine Wärme abgeben, deswegen nutze ich die Abstandshalter und einen kleinen Radiallüfter, damit die Kühlung wenigstens von unten gewährleistet ist
05 Handbuch, Passwörter, Tipps & Tricks

1. Handbuch & App
Der offz. Link für Handbuch und App ist: http://qr17.cn/BApbC0
Das dort verlinkte Handbuch ist leider unvollständig und wenig hilfreich. Ein vollständiges Handbuch kannst Du hier downloaden
{phocadownload view=file|id=23|target=b}
Falls der obige Link mal offline sein sollte findest Du hier die App für Android
{phocadownload view=file|id=53|target=b}
{phocadownload view=file|id=92|target=b}
2. Passwörter
Im offz. Handbuch auch nirgends beschrieben: Du benötigst zwei Passwörter
- zur Verbindung mit Bluetooth: 1234
- um im Bereich "Settings" Änderungen vornehmen zu können: 123456
Beide Passwörter kann man ändern, ich habe sie bei mir beide abgeändert auf 12345 😅
3. Starten des BMS
Auch nirgends komplett beschrieben: es gibt vier Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit sich das BMS starten lässt
- bei den dünnen Käbelchen müssen zwischen dem ersten (B-) und dem letzten (B+) mindestens 40V anliegen. Diese Spannung benötigt das BMS zur eigenen Stromversorgung
- das dicke Kabel "B-" muss an der Batterie angeschlossen sein
- "P-" darf nicht unter Strom stehen und muss komplett getrennt sein vom Ladegerät / Wechselrichter sonst geht das BMS beim Starten direkt kaputt
- zum Starten einen kurzen 5V-Impuls zwischen B- (+5V) und P- (Masse)
4. Verbindungsprobleme
Die Bluetoothverbindung funktioniert zwar immer schnell, allerdings unzuverlässig - die Verbindung zur App bricht ständig ab. Manchmal nach 5 Minuten, manchmal nach einer Stunde, manchmal schon nach 2 Minuten.
Das BMS wird dann in der Übersichtsleiste direkt wieder angezeigt, aber man kann sich nicht mehr damit verbinden.
Lösung: man muss nach einem Verbindungsabbruch immer zuerst wieder auf "Scan" tippen, danach klappt die Verbindung.
06 Canbus & RS485
Hier habe ich noch nichts gemacht, ist aber in Arbeit.
Man kann die Daten des BMS mittels Canbus und/oder RS485 abgreifen und extern weiterverarbeiten, hierzu gibt es einen Thread auf Secondlifestorage wobei dieser nur zum reinen Balancer ist, nicht zum Kombigerät. Inwieweit das übertragbar ist wird sich zeigen, das wird meine nächste Baustelle sein.
Hier schonmal zwei Dokumente zum RS485 Protokoll
{phocadownload view=file|id=24|target=b}
{phocadownload view=file|id=25|target=b}
Mehr Infos werden folgen, sobald ich damit weiter gekommen bin
Inhaltsverzeichnis:
- 1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)
- 2 Idee + Plan
- 3 Akku-Arbeitsplatz
- 4 eBike Akku Komponenten
- 5 eBike Akku zerlegen
- 6 Laptop Akkus zerlegen
- 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte
- 8 neue Hülle für 18650
- 9 China-Akkutest
- 10 Werkzeuge + Messgeräte
- 11 Null-Watt Einspeisung
- 12 Modbus / RS485 Adapter
- 13 BMS + Balancer
- 14 aktiv Balancer BMS - JKBMS
- 15 Ladegeräte + Kapazitätstester
- 16 kpl. Akkupacks testen
- 17 Innenwiderstand Ri
- 18 Solar Laderegler
- 19 Wechselrichter, Inverter
- 20 Löten - Anleitung für Akkus
- 21 Schlüsselanhänger aus 18650
- 22 Sicherheitskonzept
- 23 Akkus Beschaffung - wie und wo?
- 24 WVC / SG / GMI / PVGS Mikroinverter
- 25 Schritt-für-Schritt zur 18650 Powerwall
- 26 ATS - Automatic Transfer Switch
- 27 Schottky Sperrdioden für Parallelschaltung
- 28 Balkonsolar & Balkonkraftwerk
- 29 Hybrid Wechselrichter einrichten
15 Ladegeräte & Kapazitätstester
1.) Kapazitätstester
Das, was man als dringendstes über gebrauchte 18650-Zellen wissen möchte ist ja, "Wieviel nutzbare Restkapazität haben die denn noch?".
Dazu gibt es etwa eine handvoll Ladegeräte, die eine eingebaute Kapazitäts-Testfunktion besitzen

Es gibt prinzipiell nur zwei Arten, wie man die Kapazität ermitteln kann.
1. Akku aufladen und dabei die Strommenge zählen, die in den Akku geflossen ist.
- Vorteil: schnell, billig, diesen Test können viele Ladegeräte, auch günstige.
- Nachteil: sehr ungenau da man nie genau weiß, wieviel Ladung noch im Akku war, bevor man ihn aufgeladen hat -> ungeeignet
2. Akku aufladen -> Akku vollständig entladen und dabei die Strommenge zählen, die aus dem Akku geflossen ist.
- Vorteil: relativ genau und verlässlich
- Nachteil: nur wenige Geräte können das, etwas teurerer Preis, Test dauert länger
1.1 Geräte mit 4 Schächten
- Opus BT-C3100: der Klassiker, mit um 40€ preislich im Mittelfeld, teilweise lauter Lüfter, den man ggf. umbauen könnte. 1A Ladestrom / 1A Entladestrom
- Zanflare C4: um 30€, hat oftmals auch gute Bewertungen
- LiitoKala Lii500: normal um 45€, bei Amazon.uk für um 25€ / direkt aus China um 16€ und damit preislich sehr attraktiv. 1A Ladestrom / 0,5A Entladestrom
- XTAR VP4 Plus Dragon: von der Ressonanz im Netz sehr gut aber preislich mit um 65€ scheidet das für mich aus
- MiBoxer C4: nur in einem von vier Slots sind Tests möglich -> uninteressant
- XTar VC4S: -> nur das Modell mit dem "S" am Ende kann Kapazitätstest. 0,3A Ladestrom / 0,3A Entladestrom
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
1.2 Geräte mit 8 Schächten oder mehr
- XTar VC8: kann zwar nur auf vier der insgesamt 8 Slots auch die Kapazität per Entladung testen aber preislich ist das Gerät mit um 45€ dann trotzdem noch mehr als topp. 0,3A Ladestrom / 0,3A Entladestrom + automatische Reaktivierungsfunktion für tiefentladene Zellen
- Megacell Charger: 16 intelligente Ladeschächte, PC-Anbindung, Crowdfunding Projekt, aktuell noch Entwicklungsstatus mit Kinderkrankheiten, s. auch -> Forumsbeitrag
1.3 Bastellösung für 1 Schacht:
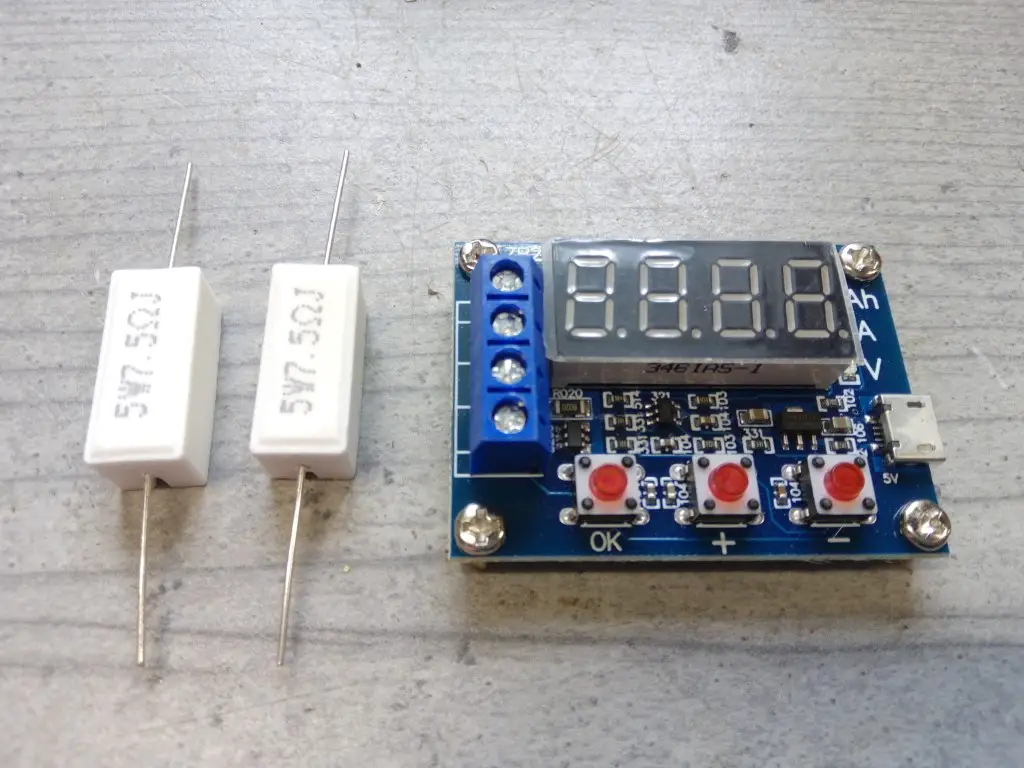
Kombination aus TP4056 (Lader, Amazon / eBay / Aliexpress)
und ZB2L3 (Kapazitätstester, Amazon / eBay / Aliexpress)
damit kann man dann eine LiIo Zelle testen. Ist in der DIY Powerwall Szene häufig an zu treffen, speziell in Verbindung mit dem billigen Ladechip
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
1.4 Testkriterien
Wieviel Kapazität eine Akkuzelle ab Werk hat findest Du über die aufgedruckte Modellnummer heraus. Hilfreich ist auch die "Cell Database" von Secondlifestorage.com
Wenn die Akkuzelle nach dem Kapazitätstest noch mindestens 75% ihrer ursprünglichen Kapazität aufweist, ist sie noch gut nutzbar für alle Anwendungen.
Hat sie weniger Kapazität in % dann ist sie zumindest für einen Solarakku / eine Powerwall / sonstige Hochleistungsanwendungen eher nicht mehr zu gebrauchen, da sie dann schon viel schuften musste in ihrem Leben und sehr wahrscheinlich nicht mehr sehr lange fehlerfrei funktionieren wird.
Solche Zellen sind jedoch nicht zwangsläufig Müll, sie sind noch für nicht-kritische Anwendungen wie Solar-Außenlampen, Akku-Lautsprecher, Taschenlampe, Wildtierkamera, Elektrospielzeug, Bastelprojekte etc. brauchbar
|
Du findest unsere Beiträge hilfreich und möchtest uns unterstützen?  Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten und zwar ganz ohne, dass es Dich etwas kostet (hier klicken) |
2.) Ladegeräte
Ein Kapazitätstest dauert in der Regel recht lange, erstrecht wenn das Kapazitätstestgerät den vollen Zyklus durchführen muss, also "Laden -> entladen -> laden"
Man kann diesen Vorgang verkürzen, indem man den ersten Ladeprozess nicht durch den Kapazitätstester übernehmen lässt, sondern durch ein separates, normales Ladegerät. Diese sind idR um einiges günstiger als solche mit Kapazitätstest.

Hier einige Modelle, gängige Modelle:
2.1 Geräte mit 4 oder mehr Ladeslots
- XTar VC4: Pro: günstig (um 17€), mit sanfter 0-Volte-Reaktivierung. Con: benötigt USB-Netzteil als Stromversorgung, nur 300mA Ladestrom
- XTar VC8: 8 Slots von 4 mit Kapazitätstest sind. Ich nutze immer 4 Slots zum Vorladen und 4 zum Testen. Pro: mit sanfter 0-Volte-Reaktivierung. Con: benötigt starkes USB-Netzteil als Stromversorgung, nur 300mA Ladestrom
- MiBoxer C8: 8 Slots, um 40€
2.2 Bastellösung:
- TP4056: billiger 1-Platinen-Ladechip für LiIon Zellen. Pro: 5 Stk. = 1€ auf Aliexpress. Con: kein Verpolungsschutz

Bildquelle: User zorrex
Gute Bauberichte zu den Chips findest Du auch hier: Klick 1 - Klick 2
2.3 Phomax 10-Slot Lader für 10€ inkl. Versand
Ich selbst nutze zum Vorladen der Zellen ein paar billige Ladegeräte mit 10 Schächten. Bei Aliexpress für um 10€ bestellt (der Preis schwankt tageweise zwischen 10,xx und 11,xx €)
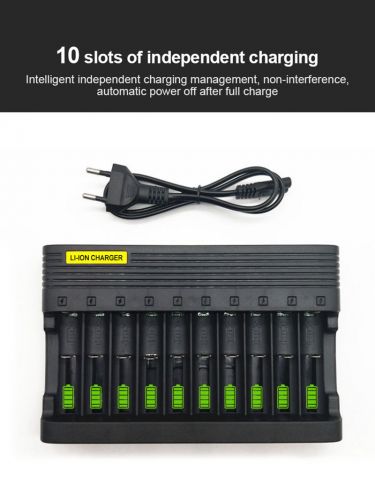
Herstellerangaben:
- Features: 10 slots unabhängige lade
- Power versorgung modus: EU plug power kabel
- Die rote LED anzeige zeigt die lade status, und die LED anzeige leuchtet grün nach voller ladung
- Ausgang spannung: DC4.2V/6000mA
- Eingang: AC100-240V 50/60Hz
- Produkt größe: 205*130*40mm
- Gewicht: 280g
- Compatiblebatterymodel: 26700/26650/26500/25500/22700/21700/20700/22650/22500/18700/ 18650/18500/18490/18350/17650/16650/16340 (RCR123) 14650/14500/10440
- 100% marke neue und hohe qualität
- Sechs schutze: überladung schutz, überstrom schutz, über temperatur schutz, kurzschluss schutz, verpolung schutz, über entladung schutz
- Quick Charge Technologie: schnelle lade
Da ich zu dem Gerät ansonsten nirgends etwas finden konnte hier mal ein paar erste Eindrücke von mir:

wird auf der Internetseite nicht so ganz klar da teilweise widersprüchlich, hier nun Klarheit: Angaben zum Ladestrom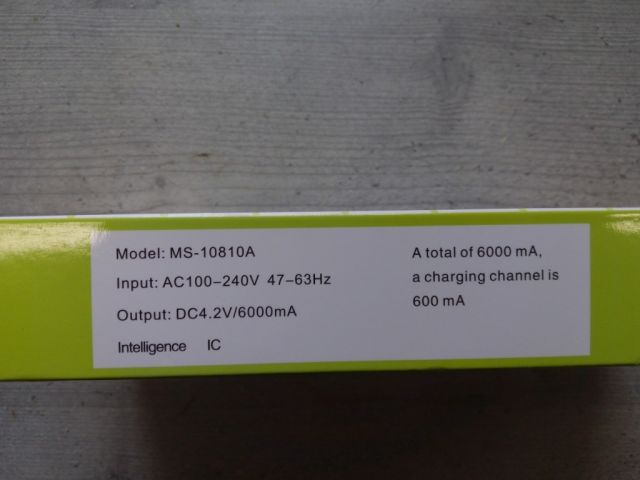
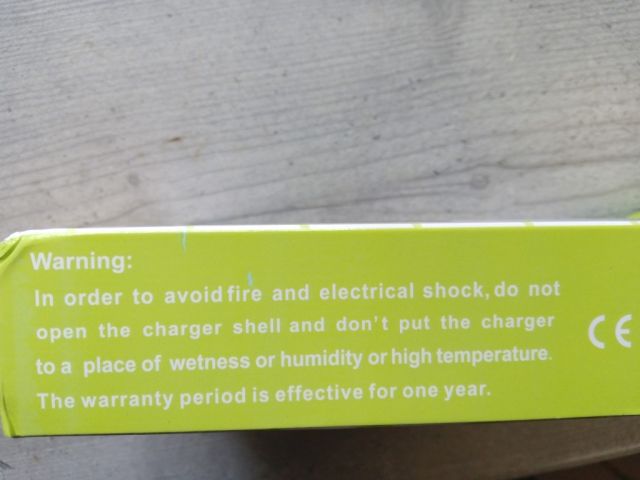

EU-Stecker ist standardmäßig dabei
die Federn der Schlitten sind leichtgängig, Zellwechsel gehen so locker von der Hand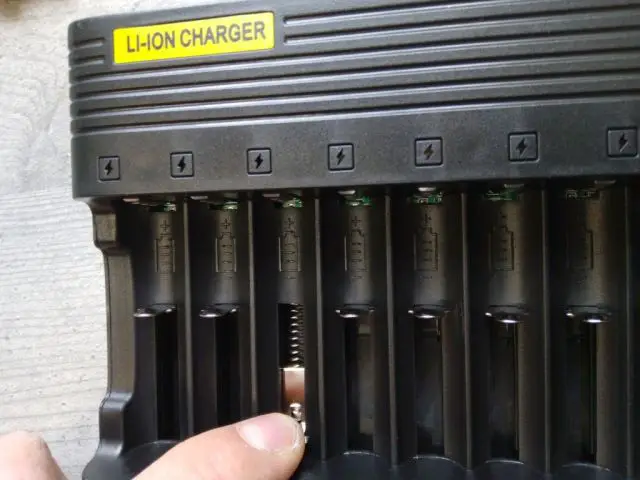
Unterseite

Lüftungsslöcher an der Rückseite

erster Minuspunkt: das Netzkabel ist mit 60cm recht kurz geraten
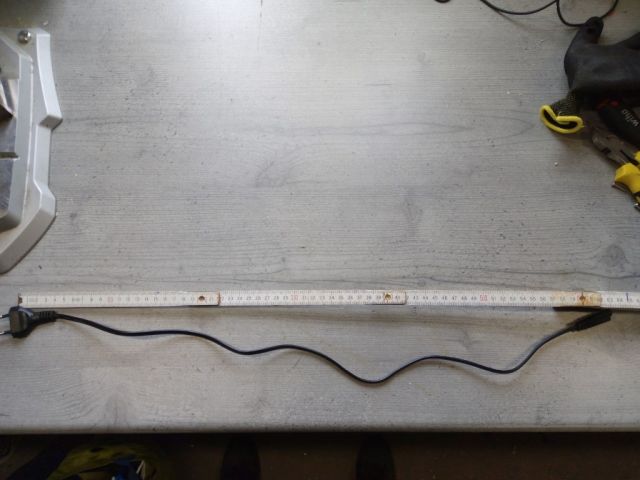
erster Test: mit ein paar LG MG1 in unterschiedlichem Zustand befüllt. Die Anzeigen beschränken sich auf LED Rot/Grün
um heraus zu finden, ob der Lader auch eine Reaktivierungsfunktion für 0V-Zellen hat suche ich gezielt eine handvoll Samsung 26H raus, allesamt mit Restspannung zwischen 0,51 und 0,52 V, gemessen mit dem Vapcell YR-1030. Die fünf Zellen links haben >3V
einige Zeit später: bei den MG1 sind die ersten fertig, die unabhängige Ladeelektronik scheint schonmal zu funktionieren
Ohne Bild:
bei einer handvoll fertig geladener Zellen habe ich mit dem Vapcell die Spannung gemessen, lag bei 4 von 5 Zellen bei 4,22V und bei einer Zelle bei 4,11V.
Kann an der Zelle liegen oder am Ladegerät, kann ich noch nicht genau sagen. Das Laden war seit etwa 1 Stunde beendet, erst dann habe ich gemessen.
mein Zwischenfazit nach 2 Wochen Benutzung:
Stärken:
- sehr preiswert
- 10 Schächte mit getrennter Ladeelektronik
- Schiebeschlitten angenehm leichtgängig gefedert
- Reaktivierungsfunktion für 0V Zellen
- 0,6A Ladestrom = brauchbar hoch. 1A wäre wünschenswert, aber deutlich besser als die 0,25A des XTar VC8, das ich auch nutze
- 230V Netzanschluss = kein Netzteilgebastel notwendig
Schwächen:
- keine Sicherung
- Netzkabel mit 60cm relativ kurz
- Ladeschächte versenkt, sodass man keine Zellen aus der Mitte entnehmen kann
- keine Spannungsanzeige sondern nur "LED Rot / Grün"
- lange Lieferzeit (rund 4 Wochen) aus China
zweiter Minuspunkt: die Ladeschächte sind recht tief in das Kunststoffgehäuse eingelassen, sodass man Zellen nur von außen nach innen herausnehmen kann, nicht aber mittendrin welche rausnehmen. Zumindest bekomme ich das nicht hin
mal schauen, was drin steckt
fünf identische Platinen für je zwei Zellen, die unabhängig voneinander mit dem 230V Netz verkabelt sind. Keine Sicherung, kein Netzteil zu sehen
MS-10810A darüber findet man (aktuell?) jedoch nichts, außer Verweise zu ebendiesem Ladegerät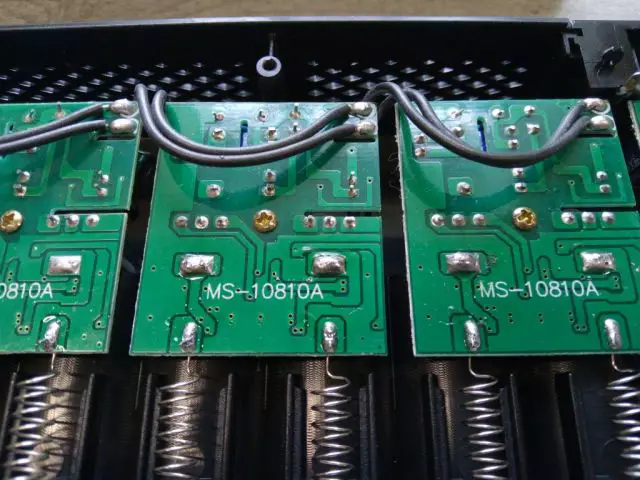
falls jemand mit Elektrokenntnissen etwas damit anfangen kann hier noch ein paar Detailsbilder mit der Bestückung der Platine / des Ladecontrollers

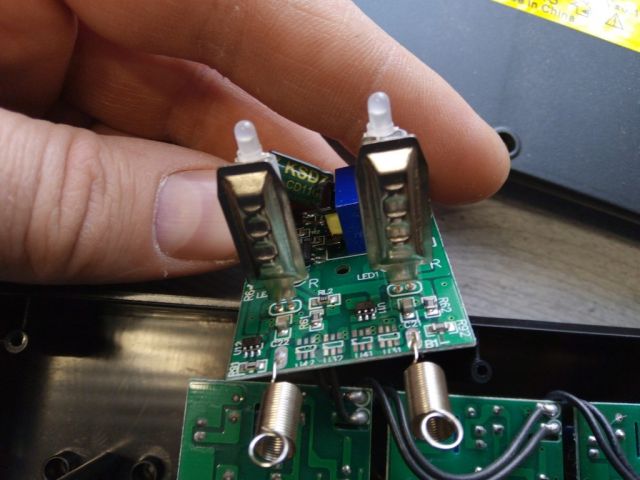

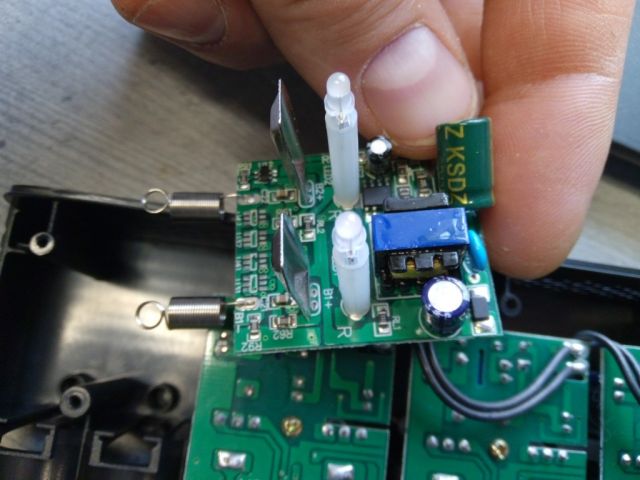
Nach 2 Wochen:
Heute festgestellt: in beiden Ladegeräte haben einzelne Slots sporadisch Aussetzer. Die LEDs gehen aus, nach ein paar Sekunden gehen sie wieder an.

Habe ich nun schon ein paar Mal beobachtet, auch mit gewechselten Zellen.
Muss das Gerät mal auseinander bauen und schauen, ob die Platine darunter vielleicht einen Wackler hat
Nachtrag nach 1 Monat (intensiver 24/7) Nutzung:
einer der beiden Lader hat nun einen ersten "richtigen" Defekt.
Nachdem die LED-Aussetzer erstmal nichts zu sagen hatten und die Zellen trotzdem geladen wurden ist nun ein Slot-Päärchen komplett tot.
Ersatz hat der Verkäufer bereits nach Rückmeldung der LED-Aussetzer losgeschickt, ist aber noch nicht angekommen.
Da das Austauschgerät noch nicht angekommen ist nutze ich den teildefekten Lader mit 8 funktionierenden Slots weiter.
Doch über Nacht ist dann wohl etwas durchgeschmort. Heute Morgen beim Akkucheck: alles dunkel in der Werkstatt, Sicherung geflogen. Alle Geräte ausgestöppselt, Sicherung wieder rein, nacheinander alles wieder eingestöppselt und siehe da, beim 10er Ladegerät flirgt die Sicherung direkt raus.
Also ausgesteckt und mal auseinander geschraubt. Der Übeltäter ist schnell gefunden:

auf dem defekten 2er Slot Päärchen ist ein Chip durchgebrannt (links vom Kondensator)

Nachtrag nach 6 Monaten 24/7 Nutzung:
Mittlerweile sind 8 von 10 Geräten mal defekt gewesen, und immer ist eine der Zweierplatinen durchgebrannt, immer eines von denselben zwei Bauteilchen

zum Glück kann man recht einfach so eine defekte Platine auslöten und eine andere funktionierende wieder einlöten
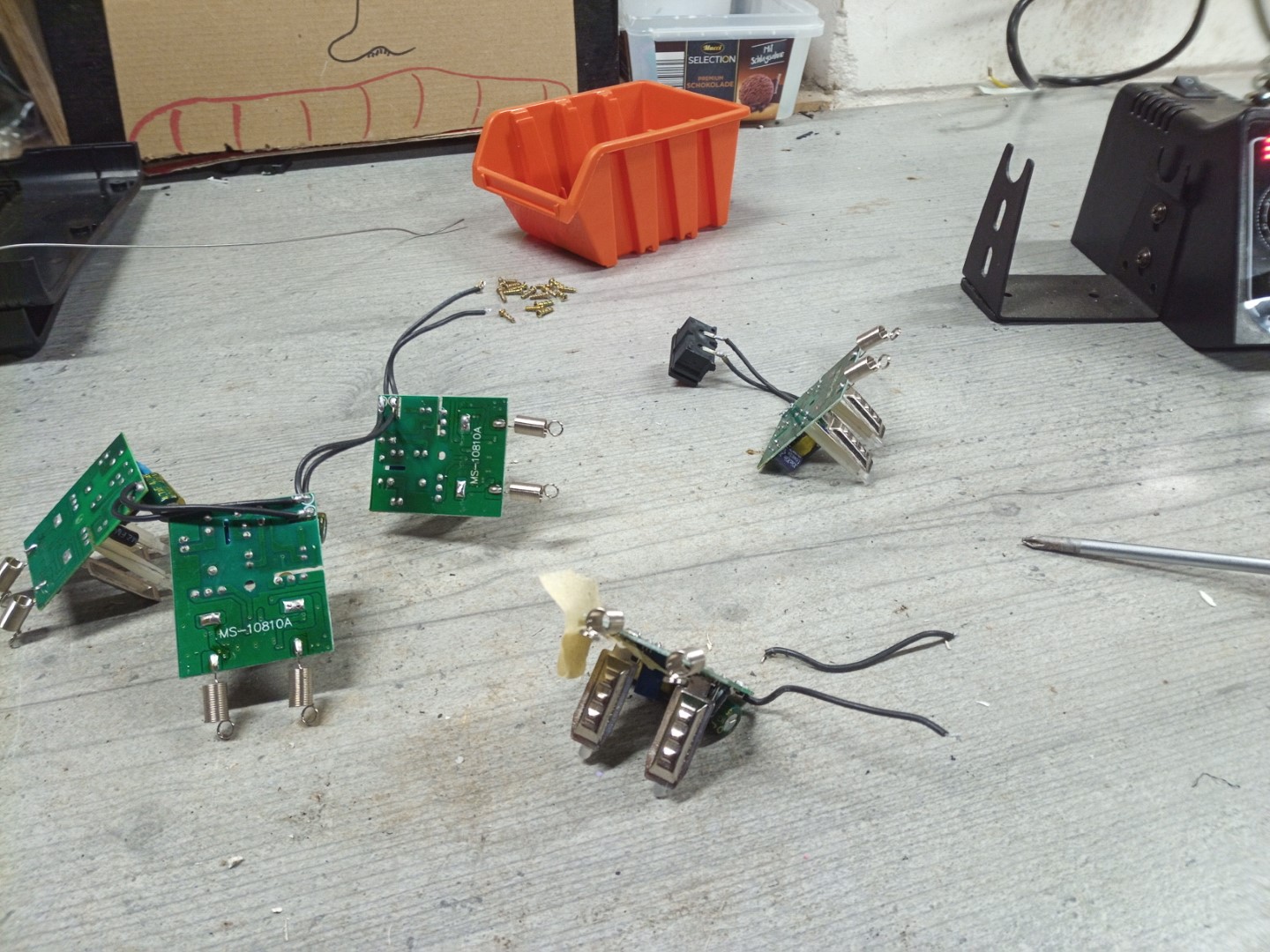
so konnte ich aus 5 defekten Geräten wieder 4 funktionierende zusammenstellen
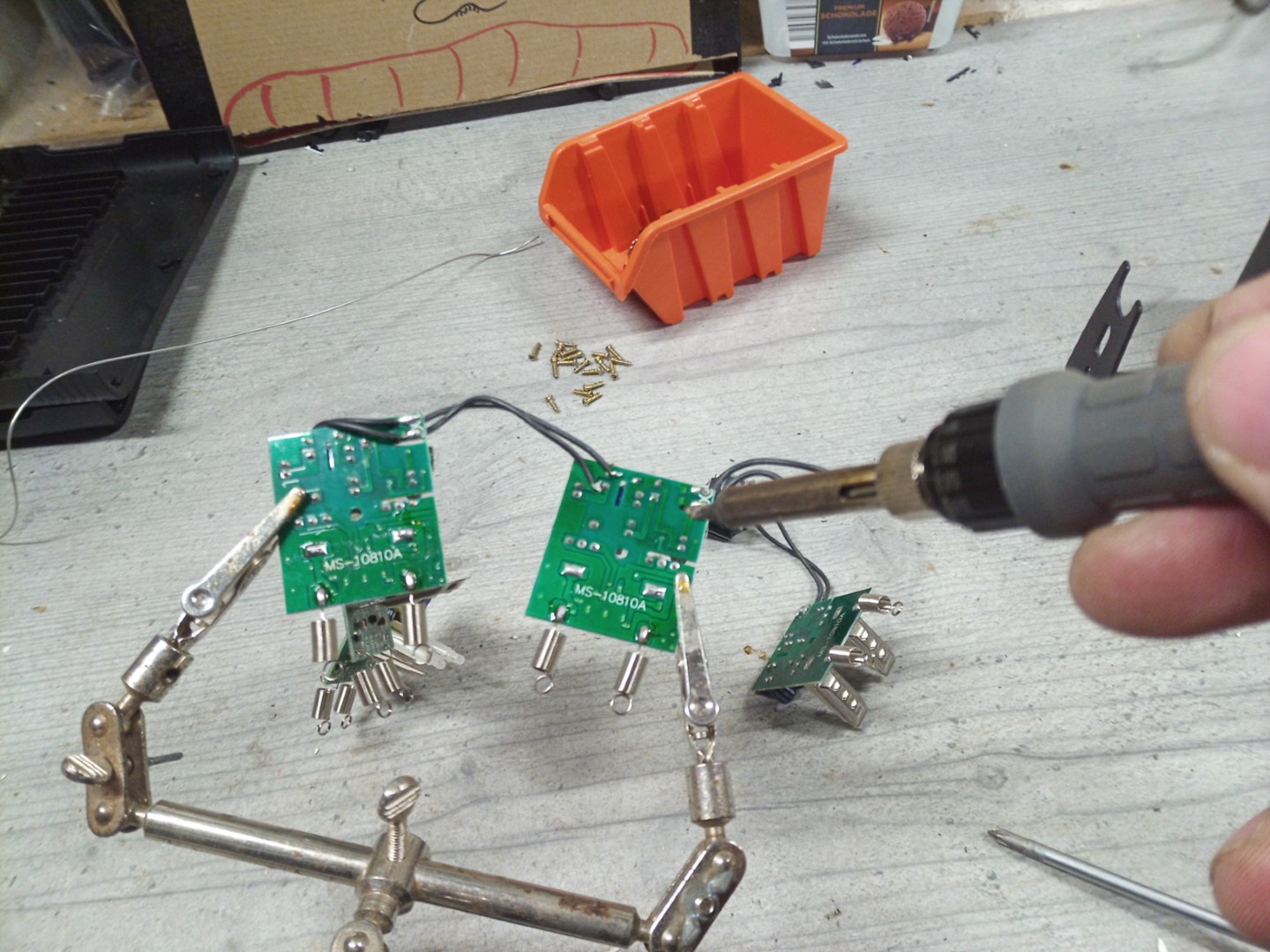
Schade, zuverlässig ist anders.
Mein Fazit:
- Man muss definitiv mit einplanen, dass man ab und an nachbessern muss, ggf. also ein Ersatzgerät als Ersatzteilspender vormerken.
- Nicht als Erste-Wahl-Ladegerät zu empfehlen, auf das man angewiesen ist und das zuverlässig funktionieren muss.
- Dennoch brauchbar um günstig, schnell und einfach viele Zellen vorzuladen.
- 10€ je Gerät = 1€ je Ladeslot, das geht auch kaum billiger mit einer Selbstbau-Bastellösung a la TP4056 + Zubehörteile
16 kpl. Akkupacks testen
Wie man einzelne 18650er Zellen auf Kapazität testet findest Du unter dem Punkt 15 Ladegeräte & Kapazitätstester
Hier findest Du nun eine Möglichkeit, wie Du ein fertiges Akkupack laden und auf Kapazität testen kannst.
Wozu?
Die Kapazitätsmessgeräte für Einzelzellen testen in der Regel in einem Bereich zwischen 4,20V und 2,80V oder 2,60V - und diesen Bereich kann man auch nicht verändern.
Für eine Powerwall ist es sinnvoll, den Spannungsbereich zu verkleinern, damit die Akkuzellen länger leben. Ich nutze den Bereich 4,05V bis 3,30V.
Um nun herauszufinden, wieviel Kapazität ein Akkupack mit diesem verkleinerten Spannungsbereich tatsächlich haben wird benötigen wir zwei Dinge
- ein einstellbares Netzteil
- eine elektronische Last
Das einstellbare Netzteil deswegen, damit wir vor dem Test das Akkupack auf eine exakt definierte Spannung aufladen können, in meinem Fall 4,05V
In einem zweiten Schritt wird das geladene AKkupack mit Hilfe der elektronischen Last dann entladen und die Energiemenge dabei mitgezählt.
16.1 einstellbares digitales Netzteil

"Einstellbar" meint, dass die Ausgangsspannung des Netzteils stufenlos einstellbar ist, sowie auch die Ausgangsstromstärke.
In der Regel nimmt man für sowas ein 300W Labornetzteil - was recht teuer ist.
Eine preiswerte Alternative ist hier die "DPS"-Serie von Riden / RD-Tech.
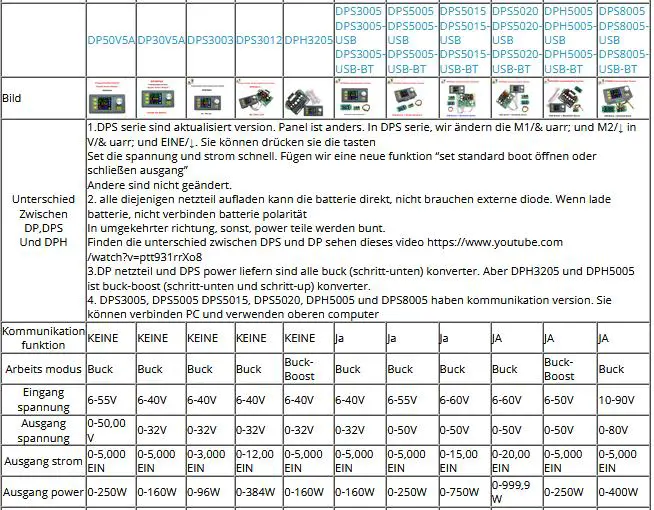
Hier ein Link zum offz. Shop mit allen Modellen: RD Offizial @ Aliexpress
Ich habe mich für das "größte" Modell mit der meisten Power entschieden, das DPS5020 mit 20A Ausgangsleistung.

die Teile sind überschaubar, aber mangels Zusammenbauanleitung hier schrittweise erklärt

das ist das eigentliche Netzteil. Erstaunlich, dass es 1.000W liefert. Im Grunde ist das ein großer "Step-down" oder "Buck" Konverter

das Bedienteil samt Display wird einfach in das Gehäuse eingeklippst

die DSP-Platine mitsamt den Abstandshalter-Füßchen am besten nicht direkt verschrauben...

...sondern erst die rückseitigen Platinen für die Stromversorgung / Lüftersteuerung einbauen
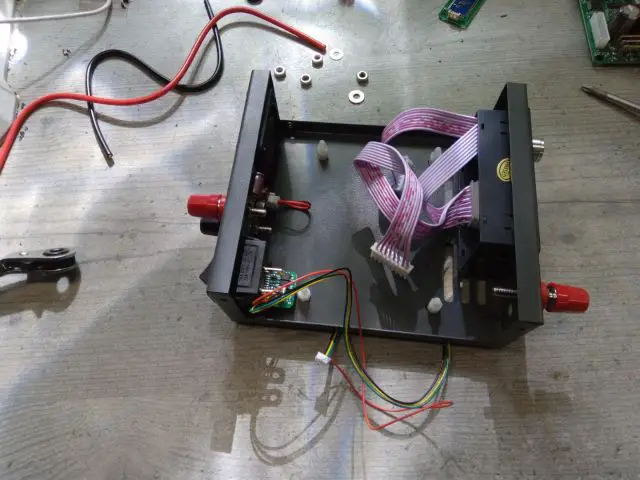
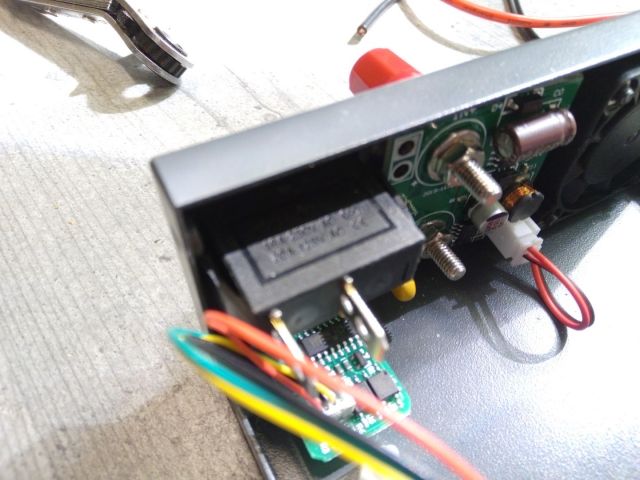
hier hier Anschlüsse an der Front

dann werden die Kabel angelötet. Achtung: die beigelegten Kabelstücke sind ziemlich genau abgemessen, da ist kein cm zu viel mit dabei, also vor dem Zuschneiden genau messen
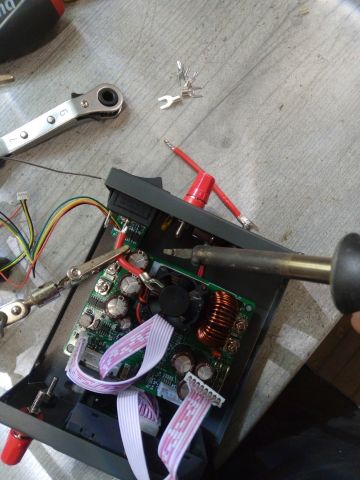
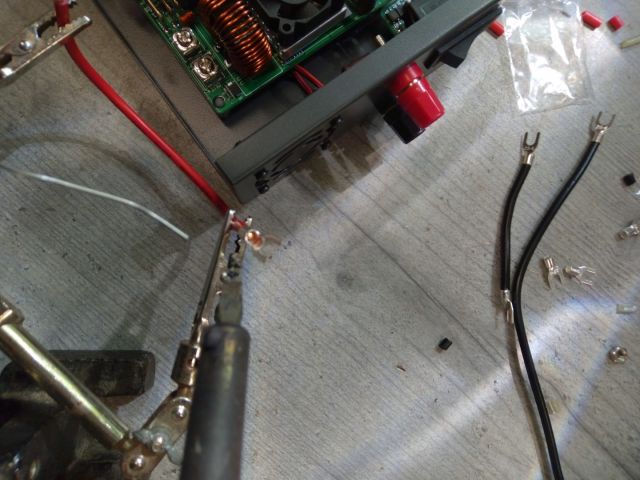

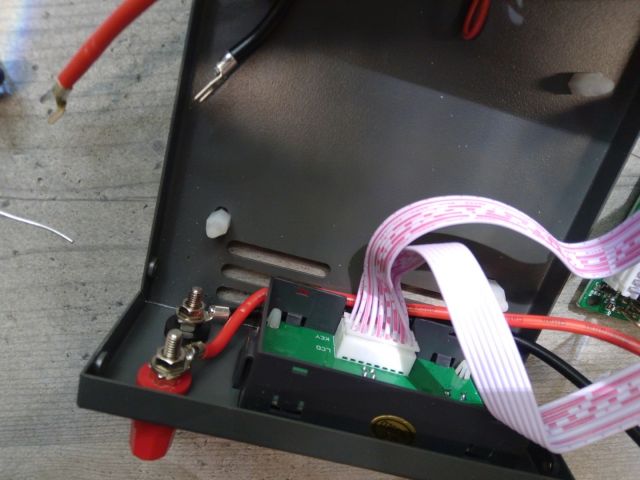

so sollte das dann fertig verkabelt aussehen


es sind keine Anschlusskabel mitgeliefert, hier musst Du noch was passendes basteln. Entweder mit Bananensteckern, oder mit Ringterminals.
Die Krokodilklemmen (Aliexpress / eBay) hier auf dem Bild haben sich als untauglich erwiesen,die sind bis max. 2A brauchbar, eher nur 1A, mehr schaffen sie nicht.

Manko bei allen DPS Geräten ist: man benötigt ein separates Netzteil zur Stromversorgung, wobei der Eingangsspannungsbereich relativ groß ist.
Für mein zweites DPS, ein kleines DPS5008 mit 5A nutze ich z.B. ein Laptopnetzteil für 10€.
Doch für das große DPS5020 reicht das nicht aus, hier habe ich ein PC-Netzteil. Genauer: ein Server-Netzteil mit 1.200W für ebenfalls um 10€ auf eBay ersteigert

das liefert 60A auf der 12V Schiene

wichtig zu wissen: die DPS-Varianten, die als "Buck" gekennzeichnet sind können immer nur eine niedrigere Spannung ausgeben, als reinkommt. Bei 12V Eingangsspannung liegt die max. Ausgangsspannung bei etwa 11V.
Nur die Modelle mit "Buck/Boost" Bezeichnung können eine niedrige Eingangsspannung am Ausgang erhöhen.
Da ich nur mit 4,05V laden will reichen mir 12V Eingangsspannung aus

fertig und läuft

Testaufbau

zusätzlich zur Bedienung direkt am Display-Bedienteil kann man das DPS auch über eine Handyap oder Windows-Software steuern - sofern man die Variante mit Bluetooth-Erweiterung oder USB bestellt hat (es kann nur eines von beiden genutzt werden).
PS: lohnt für unsere Zwecke nicht wirklich, ich bediene das DPS mittlerweile nur noch direkt am Gerät, das geht sehr einfach und intuitiv, viel schneller als erstmal nich Laptop und Kabel anzuschließen
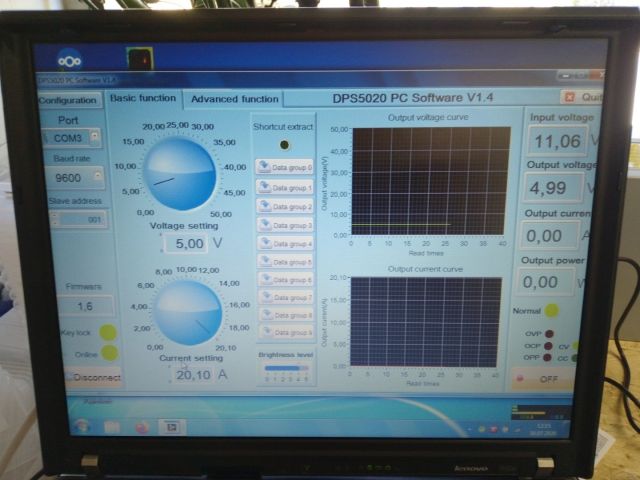
Überprüfung der Genauigkeit: bei eingestellten 4,0V am DSP messe ich am Multimeter 4,004V
Das ist für mich genau genug
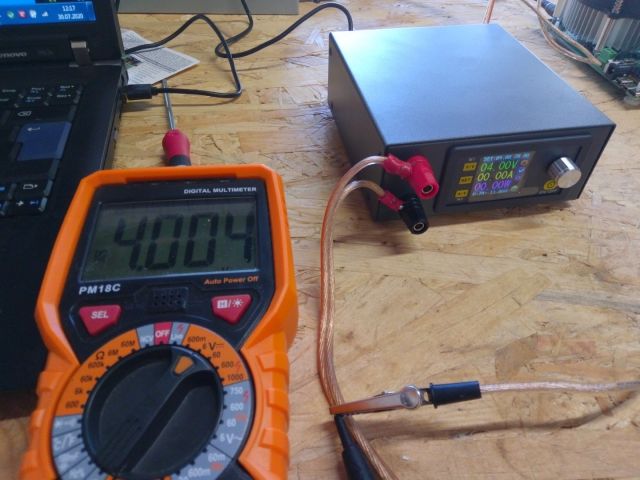
das fertig gebaute Akkupack lade ich so auf exakt 4,00V auf

dadurch, dass man auch die Ampèrezahl begrenzen kann hat man hier automatisch einen CC - CV Modus mit einer entsprechenden Ladekurve

Hier sieht man gut, dass der, noch nicht volle, Akku erst 3,948V hat, obwohl mit 4,0V geladen wird. Je näher er der 4,0V kommt desto weniger Strom wird er aufnehmen, der Akku kann so also nicht überladen werden denn bei erreichen der Zielspannung wird er nichts mehr aufnehmen

16.2 elektronische Last / Dummy Load
Um die tatsächliche Kapazität eines Akkupacks zu testen benutze ich eine elektronische Last. Auf Aliexpress gibt es eine handvoll unterschiedlicher Modelle, dort findet man sie über die Stichworte "electronic load"oder "dummy load"
Ich benutze ein modifiziertes DL24 von Hidance / Atorch




das DL24 wird mit den beiden Messklemmen an den Akku angeschlossen und gestartet

modifiziert?
Es gibt grundsätzlich zwei Arten von elektronischen Lasten.
- 2 Messkabel
- 4 Messkabel
Die meisten haben zwei Messkabel. DIese werden an das Akkupack angeschlossen und das Gerät schaltet einen (meistens einstellbaren) Widerstand, sodass der Akku entladen wird. Dabei wird die verbrauchte Energiemenge gezählt, also ganz ähnlich wie bei den Ladegeräten mit Kapazitätstestung, nur dass man hier
- größere Akkus anschließen kann
- einen größeren Spannungsbereich hat (Akkuspannungen bis 220V können hier getestet werden)
- der zu testende Spannungsbereich frei wählbar ist (z.B. für unsere Powerwall empfehlenswerte 4,0V bis 3,3V)
Und genau beim letzten Punkt gibt es zwei kritische Dinge, die zu beachten sind:
- damit beim Test der Akku nicht gnadenlos bis auf 0V tiefenentladen wird braucht man ein Gerät,welches auch eine automatische Abschaltung bei einer frei wählbaren Spannung beherrscht, das können schonmal nicht alle elektronischen Lasten -> in Artikelbeschreibung / Handbuch unbedingt nachschauen
- wird der Test gestartet und der Akku mit z.B. 15A = 60Watt belastet gibt es in der Messleitung einen Spannungsabfall. Das ansicht ist erstmal nicht schlimm, aber bei den Geräten mit nur 2 Messleitungen verfälscht dieser Spannungsabfall eben die Spannungsmessung und somit kann die automatische Abschaltung nicht zuverlässig funktionieren, s. auch Timelapsvideo
nach langem Hin und her mit dem Hersteller hat dieser mir ein zweites Gerät geschickt, welches er um zwei zusätzliche Messleitungen erweitert hat

nun gibt es zwei dicke Kabel durch die der STrom fließt sowie zwei separate dünnel Kabel nur zum Spannungstest
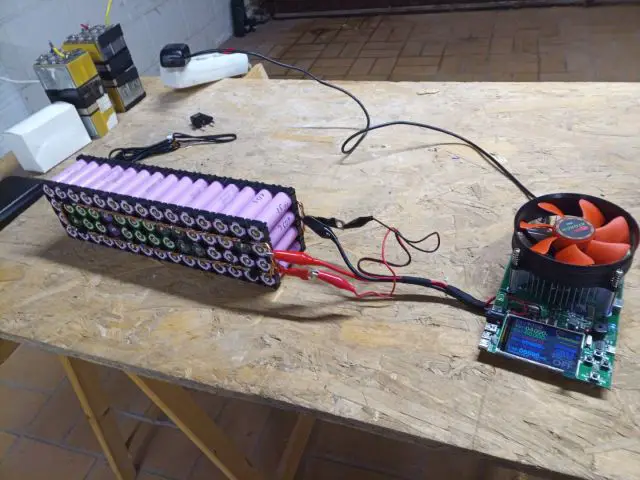
nun funktioniert die Dummy Load auch gescheit und schaltet zuverlässig bei der eingestellten Spannung ab
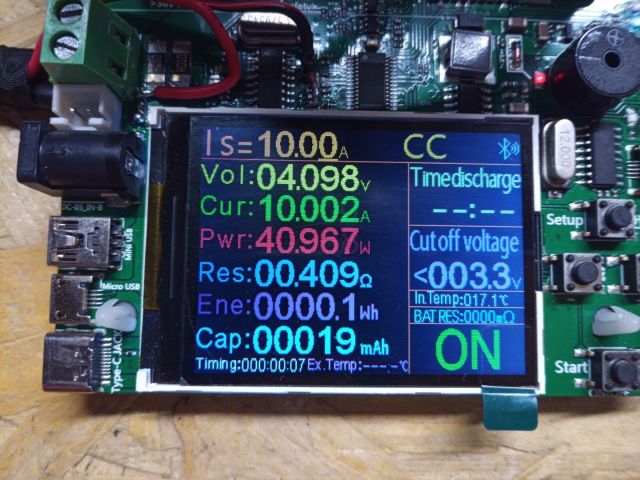
so, nun brauchst Du aber nicht ein DL24 kaufen und daran rumlöten, das ist zum Glück nicht notwendig, denn seit kurzem (vermutlich auch auf meine "Beschwerde" hin) gibt es auch eine Variante mit 4 Messkabeln, das DL24P-Plus
Bei der Variante ohne Lüfter kannst Du einen x-beliebigen PC-Lüfter anbauen. Bei 15A Teststrom sind das rund 60 Watt Wärmeabfuhr, das sollte jeder CPU-Lüfter locker schaffen. Solltest Du mit höherer Leistung arbeiten brauchst Du entsprechend einen Hochleistungslüfter.
Fazit:
- unbedingt auf ein 4-Kabel Modell achten
- die Verbindung zwischen elektronischer Last und Akku sollte sein: kurze Kabel mit dickem Durchmesser + massive Verbinder (Ringterminals), keine Krokodilklemmen (Aliexpress / eBay) wie im ersten Bild, die sind nur bis max. 2A zu gebrauchen
- dieser Schritt ist nicht unbedingt notwendig aber gut um zu wissen, wieviel Kapazität ein fertiges Akkupack tatsächlich hat
Alternativ:
Nach nun rund 20 getesteten Akkupacks kann ich sagen, dass wenn man alle Einzelzellen getestet hat (4,20V - 2,80V) und dann die Powerwall aber nur betreiben möchte im Bereich 4,00V bis 3,30V kann man recht genau 25% Kapazität abziehen
Wenn also die Summe der Einzelkapazitäten der getesteten Zellen 400Wh beträgt sind es schlussendlich nutzbar noch 300Wh.
PS: Umrechnung Ah zu Wh ? -> Onlinerechner
Randnotiz: Wieso überhaupt Wh und nicht Ah?
Ah als Einheit für Energiemenge ist ziemlich unpraktisch da sie immer bezogen ist auf eine spezielle Spannung. Sprich: man kann keine 12V Batterie vergleichen mit einer 24V Batterie. Kann man schon, aber dann muss man umrechnen.
Beispiel: eine 100Ah KFZ-Batterie hat genausoviel Energie wie eine 33Ah eBike-Batterie.
Wieso? 100A x 1 Stunde x 12V = 1.200A x h x V = 1.200Wh. und 33Ah x 1h x 36V = 1.200Wh
Besser ist es also, direkt in Wh umzurechnen, weil dann kann man immer direkt alle Batterietypen miteinander vergleichen, unabhängig von der Betriebsspannung.
Und ohne Angabe der Spannung ist eine Angabe in Ah sowieso komplett unbrauchbar. Wenn also jemand sagt "meine Powerwall hat 500Ah - ja, keine Ahnung ob das nun viel ist oder wenig. Bei einem 12V-System sind das 5.000Wh = 5kWh also eher klein. Bei einem 48V System sind das 24kWh also schon sehr viel.
Deswegen haben eBike-Akkus und auch eAutos in der Regel immer die Angaben zur Batteriekapazität in Wh bzw. kWh
Inhaltsverzeichnis:
- 1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)
- 2 Idee + Plan
- 3 Akku-Arbeitsplatz
- 4 eBike Akku Komponenten
- 5 eBike Akku zerlegen
- 6 Laptop Akkus zerlegen
- 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte
- 8 neue Hülle für 18650
- 9 China-Akkutest
- 10 Werkzeuge + Messgeräte
- 11 Null-Watt Einspeisung
- 12 Modbus / RS485 Adapter
- 13 BMS + Balancer
- 14 aktiv Balancer BMS - JKBMS
- 15 Ladegeräte + Kapazitätstester
- 16 kpl. Akkupacks testen
- 17 Innenwiderstand Ri
- 18 Solar Laderegler
- 19 Wechselrichter, Inverter
- 20 Löten - Anleitung für Akkus
- 21 Schlüsselanhänger aus 18650
- 22 Sicherheitskonzept
- 23 Akkus Beschaffung - wie und wo?
- 24 WVC / SG / GMI / PVGS Mikroinverter
- 25 Schritt-für-Schritt zur 18650 Powerwall
- 26 ATS - Automatic Transfer Switch
- 27 Schottky Sperrdioden für Parallelschaltung
- 28 Balkonsolar & Balkonkraftwerk
- 29 Hybrid Wechselrichter einrichten
|
Du findest unsere Beiträge hilfreich und möchtest uns unterstützen?  Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten und zwar ganz ohne, dass es Dich etwas kostet (hier klicken) |
17 Innenwiderstand Ri
Bevor man eine gebrauchte LiIon Akkuzelle in einer Powerwall verwendet sollte man unbedingt deren Innenwiderstand messen, denn der gibt Aufschluss darüber, in welchem Zustand sich die Zelle befindet.
17.1 generelles zum Innenwiderstand:
- bei einem niedrigen Innenwiderstand kann die Zelle einen hohen Strom (Ampère) abgeben -> U = R x I
- bei einem hohen Innenwiderstand kann sie nur einen niedrigen Strom abgeben
- zudem ist ein hoher Innenwiderstand ein Indikator dafür, dass sie schon viel gearbeitet hat oder sogar bereits defekt ist oder kurz davor steht
17.2 Wert des Innenwiderstands
Prinzipiell hat jedes Akkumodell einen eigenen, spezifischen Innenwiderstand. Meistens findet man die Angabe dazu durch Googeln in einem Herstellerdatenblatt.
In der Regel liegt der Innenwiderstand bei einer brandneuen Zelle, je nach Modell, zwischen 30 und 70 mOhm (Milli-Ohm).
Samsung-Zellen haben in der Regel sehr niedrige Werte, Sony-Zellen etwas höhere.
17.3 Richtwert 70 mOhm
Möchte man nun nicht zu jeder einzelnen Zelle den genauen Herstellerwert raussuchen kann man auch mit einem Mittelwert arbeiten:
70 mOhm
Viele DIY-Powerwall-Menschen im Netz nehmen 70mOhm (manche auch 75mOhm) als Grenzwert.
D.h.: Zellen mit einem Innenwiderstand von unter 70 sind OK und werden benutzt, darüber sind sie zwar noch für andere Anwendungen zu gebrauchen z.B. in Spielzeugen, Taschenlampen, Wildtierkameras etc., aber nicht mehr für eine Powerwall.
Dieser Wert ist nicht in Stein gemeißelt sondern ein Richtwert, an dem sich viele orientieren. Wie gesagt, manche arbeiten mit 75mOhm, und ich habe eine Test-Powerwall mit Zellen bis 150mOhm in der Garage gebaut bei der ich allerdings noch Langzeiterfahrungen zusammentrage und etwa 2022 erste Ergebnisse liefern kann.
Von daher empfehle ich dringend: 70mOhm als Grenzwert
17.4 Innenwiderstand messen
Multimeter: jedes Multimeter kann den WIderstand messen. Doch vorsicht: der Innenwiderstand von LiIon AKkusliegt im Milli-Ohmbereich und ist außerhalb des Messbereichs von Multimetern, auch von guten / teuren / Elektrikermultimetern, daher sind Multimeter ungeeignet.
Ladegerät: einige Ladegeräte / Kapazitätstester haben eine eingebaute Innenwiderstandsmessung. Doch auch diese ist ungeeignet, da sie sehr unexakte und nicht reproduzierbare Werte liefert. Das betrifft alle Ladegeräte am Markt. Bitte gerne mal Googeln, man findet zu diesem Thema einige Beiträge die das belegen.
Vapcell YR-1030: zum Bestimmen des Innenwiderstandes von LiIon Zellen benötigt man ein sehr feinfühliges Messgerät mit 4-Spitzen-Messung. Sowas findet man in der Regel eher nur im Profi- und Laborbereich und ist zudem sehr kostspielig. Eine Ausnahme ist hier das YR-1030 von Vapcell. Es ist äußerst genau. Es ist quasi das einzige Gerät, das tatsächlich zur Innenwiderstandsbestimmung taugt.

Das Gerät gibt es mit verschiedenen Zubehörpaketen, was den Preis entsprechend erhöht.
Tipp 1: Du brauchst weder die Zellhalter noch die Messklemmen. Dir Grundausstattung wie auf dem Bild zu sehen ist perfekt geeignet.
Tipp 2: wenn es nicht eilt schau bei Aliexpress, da ist das Messgerät meistens erheblich günstiger als auf eBay / Amazon / bei deutschen Händlern. Achte dann aber auf ein englischsprachiges Menü. Im Grunde muss man im Menü zwar nichts einstellen und die Messergebnisse werden auch in der chinesischen Version in lateinischen Zeichen angezeigt, aber trotzdem würde ich kein chinesisches Menü haben wollen.
Es gibt auch noch ein, zwei andere Messgeräte mit 4-Spitzen-Messung, allerdings habe ich hierzu keinerlei Eigenerfahrung und auch keine belastbaren Erfahrungsberichte, deswegen kann ich nur das YR-1030 empfehlen, mit dem ich auch selbst arbeite.
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
Einzelzellen zu messen fand ich ziemlich nervig da diese ständig wegkullern

also habe ich mir eine simple Konstruktion aus einer Dachlatte und einem Holzbrettchen gebaut

etwa 120 Akkuzellen passen auf einen Schlag drauf
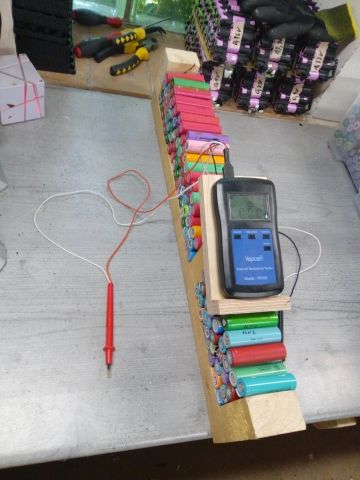
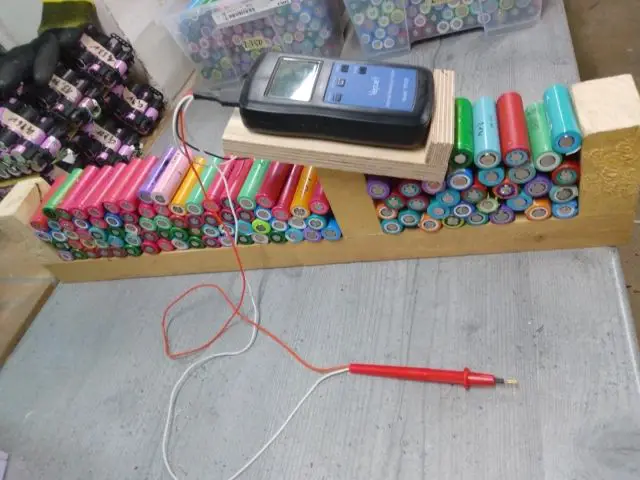
Arbeitsweise: Reihe um Reihe messe ich die einzelnen Zellen durch. Die mit > 70mOhm schiebe ich zunächst ein kleines Stückchen seitlich raus...

...erst wenn ich alle Zellen durchgemessen habe ziehe ich die markierten Zellen raus und lege sie auf Seite. So stürzt der Stapel nicht zusammen

Inhaltsverzeichnis:
- 1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)
- 2 Idee + Plan
- 3 Akku-Arbeitsplatz
- 4 eBike Akku Komponenten
- 5 eBike Akku zerlegen
- 6 Laptop Akkus zerlegen
- 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte
- 8 neue Hülle für 18650
- 9 China-Akkutest
- 10 Werkzeuge + Messgeräte
- 11 Null-Watt Einspeisung
- 12 Modbus / RS485 Adapter
- 13 BMS + Balancer
- 14 aktiv Balancer BMS - JKBMS
- 15 Ladegeräte + Kapazitätstester
- 16 kpl. Akkupacks testen
- 17 Innenwiderstand Ri
- 18 Solar Laderegler
- 19 Wechselrichter, Inverter
- 20 Löten - Anleitung für Akkus
- 21 Schlüsselanhänger aus 18650
- 22 Sicherheitskonzept
- 23 Akkus Beschaffung - wie und wo?
- 24 WVC / SG / GMI / PVGS Mikroinverter
- 25 Schritt-für-Schritt zur 18650 Powerwall
- 26 ATS - Automatic Transfer Switch
- 27 Schottky Sperrdioden für Parallelschaltung
- 28 Balkonsolar & Balkonkraftwerk
- 29 Hybrid Wechselrichter einrichten
18 Solar Laderegler
In diesem Kapitel geht es um Solar-Laderegler. Die Punkte, die ich kurz ansprechen werde sind:
- 18.1 Funktionsprinzip
- 18.2 Step-Down / Step-Up
- 18.3 PWM / MPPT
- 18.4 ein paar Modelle vorgestellt
18.1 Funktionsprinzip
Laderegler machen immer zwei Dinge:
- PV-Module werden daran angeschlossen
- Batterie wird angeschlossen
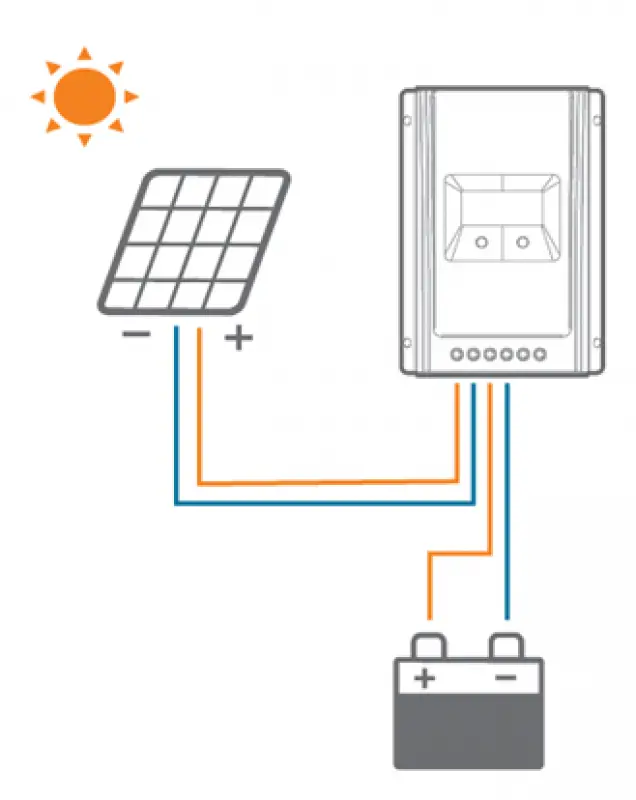
Ein Solar-Laderegler wandelt also von den PV-Modulen den DC-Strom (Gleichspannung), um damit die Batterie (ebenfalls Gleichspannung) zu laden.
Intern ist also immer ein DC-DC-Wandler verbaut, der die, je nach Sonneneinstrahlung ständig wechselnde, Gleichspannung der PV-Module umwandelt in eine genau definierte Gleichspannung zum Laden der Batterie.
Dabei muss der Laderegler auch noch dafür sorgen, dass die Batterie nicht überladen wird und den Ladevorgang rechtzeitig beenden,
zusätzlich sollte er passend zum verwendeten Batterietyp auch noch verschiedene Ladekurven beherrschen. Dazu gleich mehr.
18.2 Step-Down / Step-Up
Bei preiswerten Solar-Ladereglern wird das Wandeln der Spannung mittels Stepdown-Wandler (oder auch Buck Konverter / Step-Down Converter) gemacht.
Achtung:
Das bedeutet, dass die Spannung der angeschlossenen PV-Module immer ein paar Volt höher sein muss, als die Batteriespannung da ein Stepdown nur Spannungen generieren kann die niedriger sind, als die EIngangsspannung.
Beispiel:
Um eine typische 12V KFZ-Batterie mit 14,4V laden zu können müssen die PV-Module allermindestens 16V liefern, besser 18V als niedrigsten Wert.
Das bedeutet: mit einem 12V Solarpanel kann man keine 12V Batterie laden.
Step-Down Module sehen so oder so ähnlich aus

zur technischen Funktionsweise hier auch eine schematische Darstellung

Bildquelle und mehr Infos zur Funktionsweise von Step-Down Konvertern -> Abwärtskonverter @ itwissen.info
Ganz selten haben Solar-Laderegler anstelle eines Stepdown Konverters auch einen Step-Up oder Boost Konverter verbaut. Der funktioniert genau andersherum, er benötigt eine niedrige Eingangsspannung und macht daraus eine höhere Ausgangsspannung.
Vor dem Kauf solltest Du also immer darauf achten, welches Funktionsprinzip dahinter steckt wobei in der Regel wenn es ein Step-Down ist es nicht immer dabei steht weil das die Regel ist, und falls es ein eher seltener Step-Up ist dann steht es immer dabei.
18.3 PWM / MPPT
- PWM steht für Puls-Weiten Modulation
- MPPT für Maximum Power Point Tracker
Beides bezeichnet eine Technik zur Regelung der PV-Eingangsspannung.
PWM Laderegler
Beim PWM Regler wird im Grunde die Spannung der PV-Module durch die Ladereglersteuerung so weit nach unten gezogen, bis sie nur noch so hoch ist wie die Batteriespannung. Dann wird der Strom durchgeschaltet.
- Vorteil: diese Schaltung ist billig zu produzieren
- Nachteil: Leistung ist immer Spannung x Stromstärke und dadurch dass der PWM die Modulspannung runterbricht ist die Leistung, die tatsächlich in den Batterien landet idR sehr niedrig
Ein typischer und oft zu findendender PWM Laderegler ist dieser (unterschiedliche Markennamen)

Kostet zwischen 7€ und 15€
Meistens wird er als MPPT Laderegler beworben, aber das ist ein Fake, es ist definitiv ein billiger (im wahrsten Sinne des Wortes) PWM Laderegler, über den man auch unzählige Reviews und Berichte im Internet findet
Es gibt auch viele Varianten davon, die mit unterschiedlichen Farben oder leicht geändertem Plastikgehäuse daherkommen

Hier noch ein schönes Vergleichsvideo zwischen PWM und MPPT
Ohne jetzt allzu sehr vorgreifen zu wollen aber: Bitte - kauf Dir keinen PWM Laderegler und erstrecht nicht die o.g. Billigst-Regler. Die sind Schrott und gefährlich.
Zudem ist PWM ineffizient, d.h. Du verschenkst jede Menge Sonnenenergie. Diese verpufft einfach ungenutzt anstatt damit die Batterie zu laden.
MPPT Laderegler
Um zu verstehen, wie ein MPPT Laderegler funktioniert vorher noch eine kurze Erkäuterung, wie PV-Module leistungstechnisch funktionieren.
- jedes PV-Modul hat eine eigene, typische Arbeitsspannung
- je nach Sonneneinstrahlung und Belastung varriiert diese Spannung
- je nach Spannugshöhe variiert auch die Stromstärke, die das Modul liefern kann und damit auch die Leistung in Watt
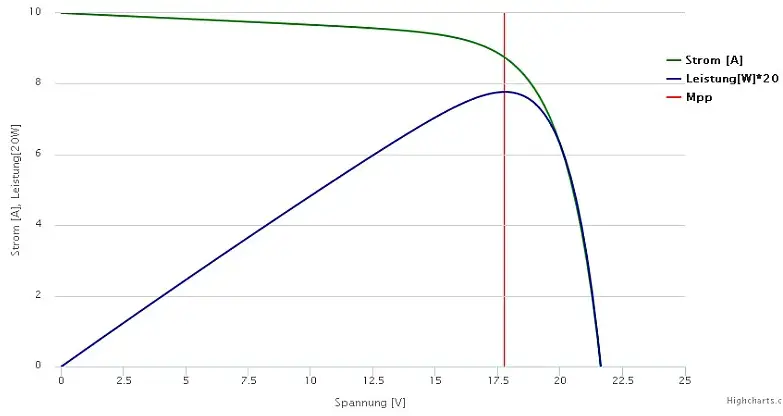
Am obigen Bild erkennt man die beiden Verläufe von Spannung und Stromstärke eines PV-Moduls. Diese Kurven sind bei jedem Modul von den Werten her anders, aber der schematische Verlauf ist übertragbar und überall ähnlich.
Man sieht auch, es gibt einen optimalen Punkt in dem das Ergebnis von Spannung [U] x Stromstärke [I] den höchsten Wert = Watt [W] hat. Diesen Punkt nennt man MPP = Maximum Power Point also Punkt der maximalen Power.
Um das besser zu visualisieren kann man auch diesen Punkt als Fläche einzeichnen. Ist die Fläche am größten dann ist auch die Leistung am größten.
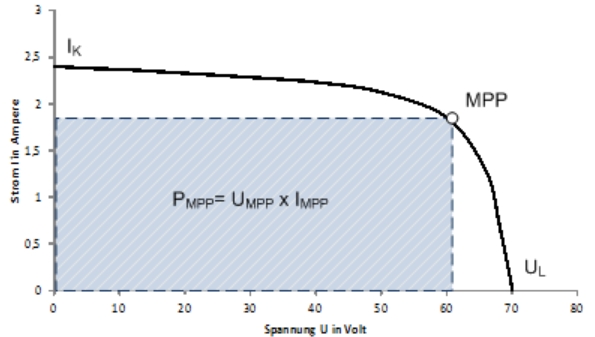
Zur Erinnerung:
je nach Sonneneinstrahlung und Belastung am Ausgang (sogar abhängig von der Außentemperatur) verschiebt sich dieser Punkt, ist also nicht fix sondern ändert sich ständig je nach Modul und Situation.
Ein MPPT (das T steht für Tracker = engl. für "Sucher" oder "Aufspürer") sucht und findet also immer den Punkt auf der Spannungskurve eines PV-Moduls, an dem die Leistung maximal ist. Dieses sog. Tracken geschieht permanent, solange der MPPT-Laderegler läuft.
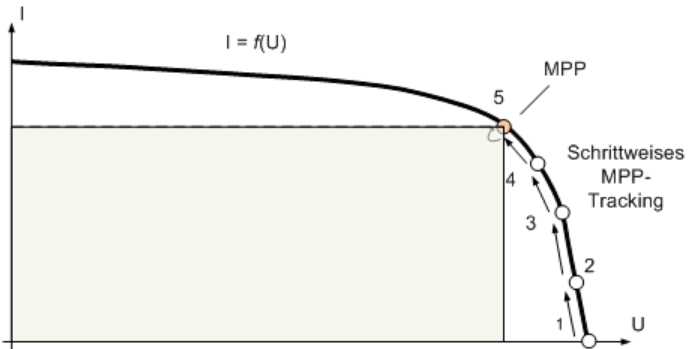
Hier im direkten Vergleich zum PWM Laderegler wird der Unterschied noch klarer
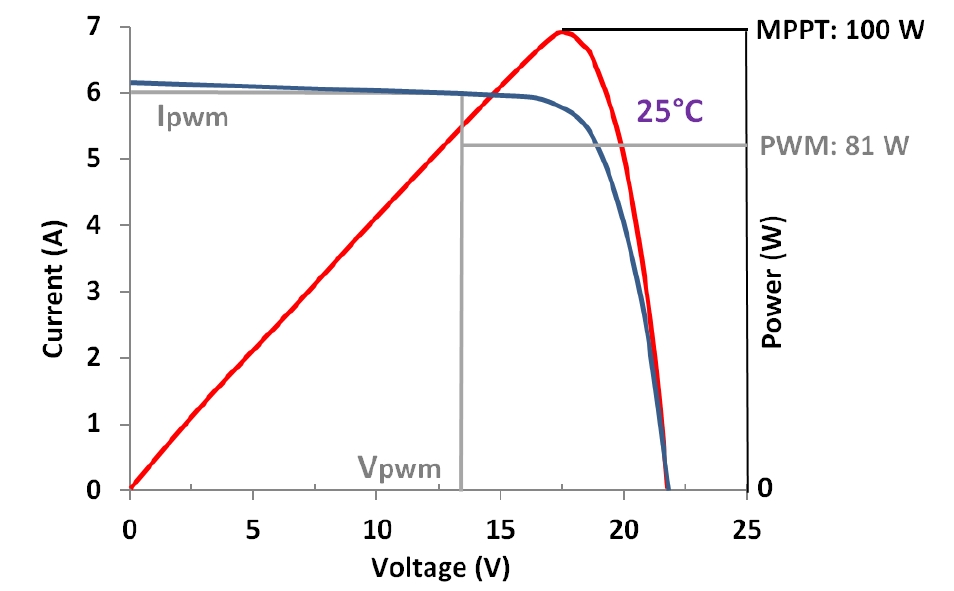
Anstatt wie beim MPPT den Punkt der idealen Leistungsausbeute zu nutzen (hier 100W) nimmt der PWM den Punkt, der am besten zur Batterie passt (hier 81W), der Rest an Leistung geht schlicht verloren.
Da MPPT-Laderegler immer teurer sind als PWM Geräte habe ich mir ein paar Modelle genauer angeschaut, die ich im nachfolgenden kurz vorstellen möchte.
18.4 ein paar Modelle vorgestellt
Hier nochmal der Hinweis:
Wir bekommen weder Geld für Werbung noch erhalten wir Geräte kostenlos oder sonstige Gegenleistungen, haben keine Affiliate-Links, bekommen keine Provisionen, haben keine Werbebanner geschaltet oder sonstwas. Wir versuchen nur unsere eigenen Erfahrungen mit anderen Menschen zu teilen.
Deswegen lassen wir uns auch nicht kaufen oder sonstwie beeinflussen. Wenn ein Gerät scheisse ist dann steht hier auch - dass es scheisse ist. Und das wird auch so bleiben. Punkt.
- 18.4.1 MPPT Solar Laderegler mit um 30A Ladestrom und Eignung für 48V LiIon Akkus
- 18.4.2 Solar Laderegler mit 60A
- 18.4.3 MPPT Laderegler 20 - 25A super-billig
18.4.1 MPPT Solar Laderegler mit um 30A Ladestrom und Eignung für 48V LiIon Akkus
Zuerst habe ich selbst nach günstigen MPPT Ladereglern mit um 30A Ladestrom geschaut, die auch 48V Batteriespannung können. Davon gibt es nicht viele, aber ein paar habe ich gefunden.
1.) noname Solar Charge Controller PWM 30A
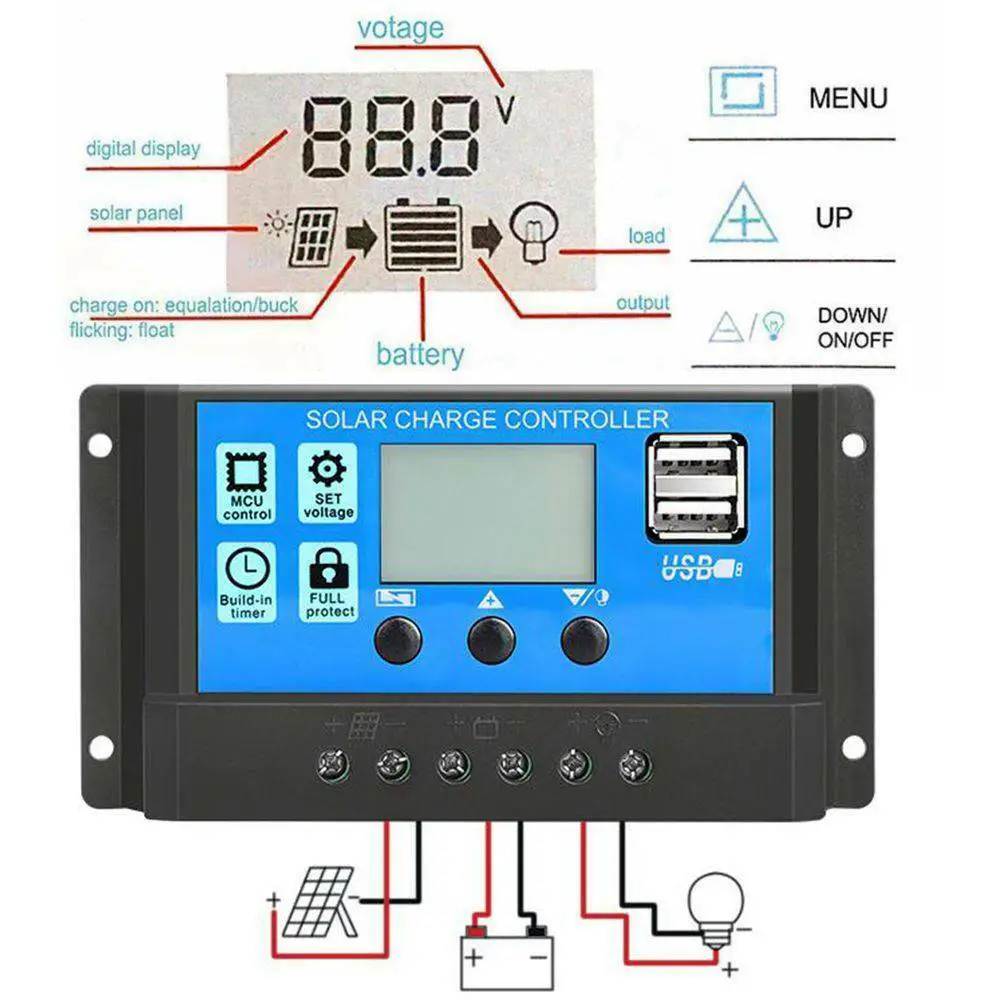
- Nennspannung: 12V 24V Auto
- Anwendung: Solar System Controller
- Nennstrom: 30A
- Max. PV Spannung: 50V
- um 7€ inkl. Versand für das Modell mit 30A (gibt es auch in 10er-Schritten gestaffelt von 10A bis 60A) -> Aliexpress
Kurzbewertung:
- Fake-MPPT
- PWM = ineffiziente Methode
+ sehr günstig, als Einstieg in Photovoltaik oder für Basteleien gut geeignet, auf Youtuber und im Netz findet man hierzu auch viele Infos
Hier ein Test-Video auf Youtube ->Billiger 10 Euro PWM Laderegler im CHECK #SOLAR LADEREGLER 12/24 Volt
2.) MPT-7210A

- Eingangs spannung: DC 12-60V
- Ausgangs spannung: DC 15-90V, einstellbar, um 24V / 36V / 48V / 60V / 72V batterie
- Ausgang strom: 0-10A einstellbar
- Ausgang power: 20-600W
- Besonderheit: Step-Up Konverter. Achtung: bei Eingangsspannung gleich oder größer Batteriespannung funktioniert die Ladeabschaltung nicht mehr
- auf Aliexpress und auf eBay
- ausführlicher Testbericht hier -> MPT-7210A - günstiger MPPT Solar Laderegler mit Boost
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
Kurzbewertung:
+ günstigste Ausführung, echter MPPT
- nur 10A Leistung, Lüfter sehr laut
mehr Infos:
- -> recht ausführlicher Thread im PV-Forum
- YT-Review 1
- Lüfter-Problematik @ Youtube von HBPowerwall
- Handbuch als Pdf zum Download @ Filehorst
3.) Yosun MPPT Solar Charge Controller -> ACHTUNG FAKE - nur PWM

- Versionen mit 10A/20A/30A/40A/50A/60A verfügbar. 30A Version: max. 1.600W PV-Modul Anschlussleistung, 30A Batterieladestrom
- Eingangs spannung: DC 12-80V
- alle relevanten Spannungen (Lade- , Ladeschluss- / Unter- ...) einstellbar
Kurzbewertung:
-> gute Leistungswerte, aber die max. 80V PV-Moduleingangsspannung ist gerade so nicht ausreichend, um zwei Standard-Module in Serie zu schalten, d.h. man muss alles parallel anschließen. Zudem: rein passive Kühlung
-> Nachtrag: schein kein MPPT sondern nur PWM zu sein, siehe Kommentare hier
Handbuch als Pdf zum Download @ Filehorst
4.) JNGE JN-MPPT-Mini

- Open-Circuit Spannungsbereich: 80V - 150V (Anfangsspannungsbereich unklar)
- PV-Anschlussleistung: max. 1.600W
- Ausgangs spannung: 12V / 24V / 48V
- Ladestrom: 30A
- separater Load-Ausgang: 15A
- RS485 Ausgang für Monitoring
- aktive Kühlung
- Hier mehr Infos + Handbuch als Pdf
Kurzbewertung:
- gefällt mir aktuell am besten da gute Leistungswerte und hoher Eingangsspannungsbereich + aktive Kühlung
- RS485 Schnittstelle nur mit Aufpreis nutzbar: +15USD für entsprechendes Interface (Modbus, USB, WiFi), +15USD für die benötigte Software = 50% Aufpreis für Monitoring welches nach diesem Youtube Video (mMn) nicht wirklich lohnt.
- Handbuch als Pdf zum Download @ Filehorst
- Achtung: ich habe den Solar-Laderegler 3x bestellt bei unterschiedlichen Händlern, bis er endlich ankam. Die beiden ersten Male gab es Lieferschwierigkeiten beim Verzollen / bei der Fluggesellschaft. Schlussendlich angekommen ist er nur bei Bestellung direkt beim Hersteller, s. Beispiellink weiter oben
- auch das Modell mit Auto-Spannungsbereich 12V/24V/48V hat einen einstellbaren Ladestrom bis max. 100V -> man kann auch größere Akkusysteme damit betreiben
+ stabiles Metallgehäuse, kein Plastik
+ Lüfter temperaturgeregelt bis zum kompletten Stillstand
+ Display gut lesbar, Menüführung auch ohne Handbuch intuitiv, beleuchtet während der Bedienung
+ Anschlussterminals sicher verdeckt
- Anschlussterminals nur mäßig gut erreichbar da halb verdeckt
- 6mm² max. Anschlussdurchmesser, auch für die Batterieanschlüsse. Ist bei 30A OK aber dann ist man gezwungen, die Kabelstrecke kurz zu halten
- Monitoring nur bei aufpreispflichtigen Erweiterungen (WLan / Ethernet + App). Ggf per RS485 möglich, dann aber in Eigenregie ohne vorgefertigte App
Nachtrag:
2021 hat das Modell ein Update mit einer Verschlechterungen bekommen, es ist nun nicht mehr für 48V Akkusysteme geeignet.
Bei einigen Händlern auf ALiexpress bekommt man noch das alte Modell mit 48V-Eignung aber hier gilt aufpassen und vergleichen
Möglicherweise! fällt die 48V EIgnung nur auf dem Papier weg, denn bei meinen Modellen mit 48V-Eignung ist die Ladespannung einstellbar bis 100V, also kann man auch Akkusysteme mit 72V / 96V betreiben bzw. im Grunde kann man ganz flexibel je nach verwendetem Akku die Werte genau einstellen und anpassen.
Evtl. hat der Hersteller JNGE hier nur die Beschreibung verändert, aber den einstellbaren Spannungsbereich nach wie vor auf max. 100V belassen, sodass man auch nach wie vor 48V Akkusysteme benutzen kann.
Falls jemand ein 2021er Modell in Benutzung hat würde ich mich über Rückmeldung freuen, wie weit man den Spannungsbereich einstellen kann. Danke
5.) Decdeal MPPT 30A

- Batteriespannung: 12V / 24V / 48V
- Betriebsspannung: DC 18-80V / 30-120V / 60-120V
- Optimale Spannung: 18-80V / 36-100V / 80-120V
- Nennleistung: 480W / 960W / 1920W
- PV Maximale Leistungsaufnahme: 550W / 1200W / 2400W
- Lademodus: 1 - MPPT; 2 - konstanter Strom; 3 - konstante Spannung
Kurzbewertung:
+ klingt von den Werten her gut, aktiver Lüfter, großer Eingangsspannungsbereich
- man findet keinerlei Infos über den Regler, einzig ein Video bei YT. Pdf Handbuch rückt niemand raus, habe alle Händler angemailt (hat angeblich niemand vorliegen)
Nachtrag:
Da man nirgends Informationen oder Handbuch erhält und der WR fast nirgends verfügbar ist -> uninteressant
18.4.2 Solar Laderegler mit 60A
Wer mehr Leistung benötigt kann sich hier einen guten Vergleich samt Erfahrungsbericht durchlesen mit
- Victron MPPT 100/30 (um 200€) / 30A / 12 bis 24V
- Victron MPPT 150/60
- MakeSkyBlue 60A
- eSmart3 MPPT-60A
Mehr Infos:
Ladereglervergleich Victron, eSmart3 und MakeSkyBlue
Video auf YT -> eSmart3 vs EPever XTRA 4415N MPPT Solar Laderegler Test Solaranlage, Balkonkraftwerk Stromspeicher
Hier ein netter Vergleich zwischen Makeskyblue, dem Nachbau PowMr und EPever Tracer 6415AN -> Test auf Youtube
Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich von zwei Modellen berichten, und zwar von
EPever Tracer 6415AN
Das Gerät habe ich seit März 2021 in Betrieb in meiner 18650 DIY Tesla Powerwall in der Garage, wo er 8 PV-Module mit je 380Wp und insgesamt 3kWp zuverlässig handelt

Pro / Contra:
+ sehr wertige Verarbeitung, gutes, splitterfreies, dickes Kunststoffgehäuse
+ massive Anschlussterminals mit Zugentlastung für dicke Kabelquerschnitte
+ Passivkühlung mit richtig großzügig dimensioniertem Kühlkörper auf der Rückseite, der auch unter hoher Dauerbelastung nicht zu heiß wird
+ sehr viele Einstellmöglichkeiten, nicht bloss automatische Spannungserkennung der Batterie, somit auch individuell gebaute Powerwalls benutzbar (z.B. bei mir die PW mit sehr untypischen 65V)
- Preis ist schon ordentlich hoch aber im Vergleich zur gebotenen Leistung und Qualität ein unschlagbarer Kompromiss aus Preis und Leistung
- nicht alle Einstellungen direkt am Gerät machbar, für die erweiterten Optionen benötigt man das optionale MT50 für um 18€
- Display ohne Beleuchtung
Erhältlich: bei z.B. Aliexpress oder eBay oder Amazon
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
gute Anschlussterminals mit Zugentlastung

MT-50

sehr viele Einstellmöglichkeiten

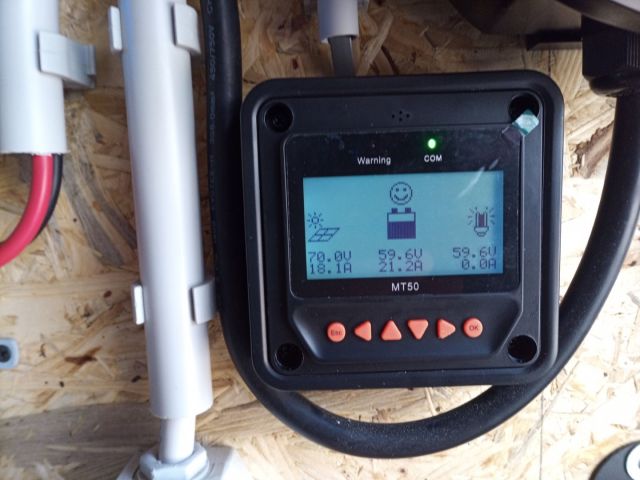
hier noch ein nettes Vergleichsvideo zwischen dem EPever 6415AN und dem günstigen Esmart3 -> Epever 6415 vs Esmart 3 60A MPPT Solar Laderegler Test
Fazit
Topp Gerät welches von der Qualität und auch den technischen Werten sowie Wirkungsgrad auf einer Höhe mit den richtig teuren Markengeräten ist, aber dennoch preislich etwas erschwinglicher.
EPever gilt schon fast als Geheimtipp für all diejenigen, die Super-Qualität haben wollen, aber zum bezahlbaren Preis.
Hier geht's zum Testbericht samt Bezugsquellen -> Akkus & PV - EPever MPPT 60A Solar Laderegler 12V 24V 36V 48V Tracer 6415AN
PowMr 60A

Den Laderegler habe ich zwar schon gekauft und hier liegen, aber noch nicht in Benutzung, da sich das Projekt "Geräte-Carport" mit 70m² Dachfläche und PV leider etwas verschiebt aufgrund der abnormal gestiegenen Holzpreise
Erhältlich: bei z.B. Aliexpress oder eBay oder Amazon
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
Aber ein paar Infos gibt es trotzdem bereits:
Beitrag auf Englisch
hier ein Beitrag auf Deutsch
noch eines auf Englisch
im Forum von Dr.Backe gibt es einen tollen Thread mit einer Anlage, gleich 9 der Laderegler benutzt -> mein kleines Kraftwerk @ forum.drbacke.de
Bis ich meinen eigenen PowMr benutzen kann habe ich, auch aufgrund der bisher gelesenen Erfahrungsberichte, zumindest schonmal eine Verbesserung der Wärmeabfuhr vorgenommen
Und zwar wie schon bei anderen Ladereglern und Wechselrichtern auch mittels zusätzlicher Aluminium-Kühlkörper an der Rückseite. Die gibt es günstig auf Aliexpress.
Ich setze dazu fünf Klecke Wärmeleitkleber in die Ecken + Mitte, den Rest bestreiche ich mit Wärmeleitpaste
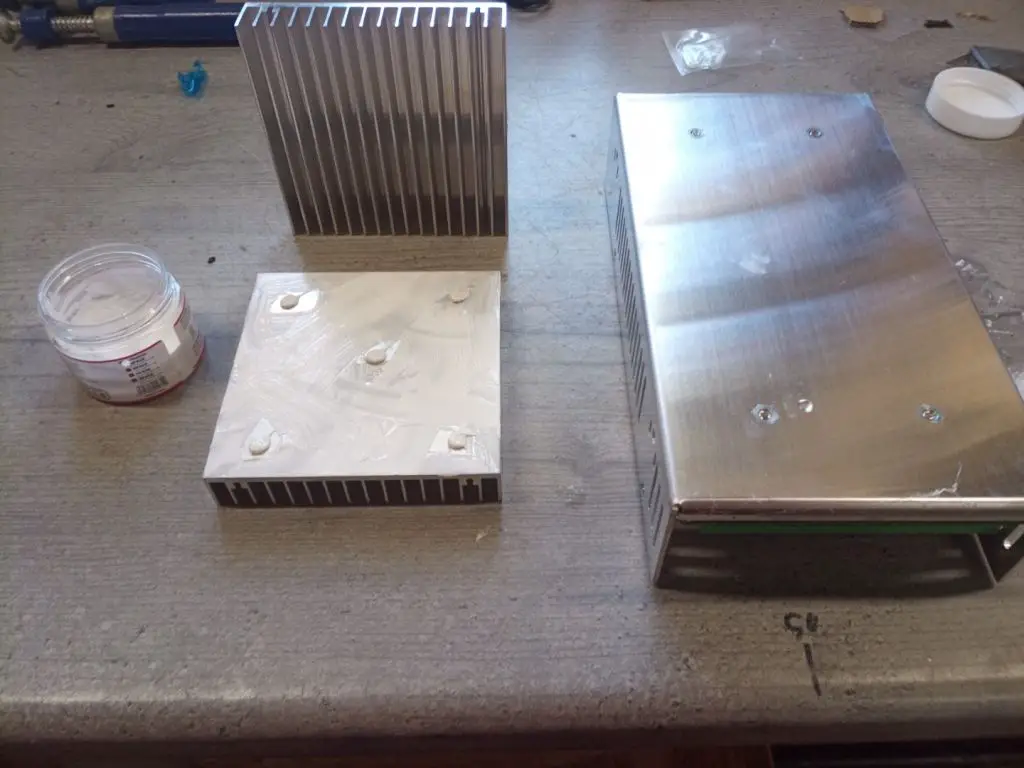
auf die Rückseite des PowMr passen genau zwei Kühlkörper mit 100x100mm
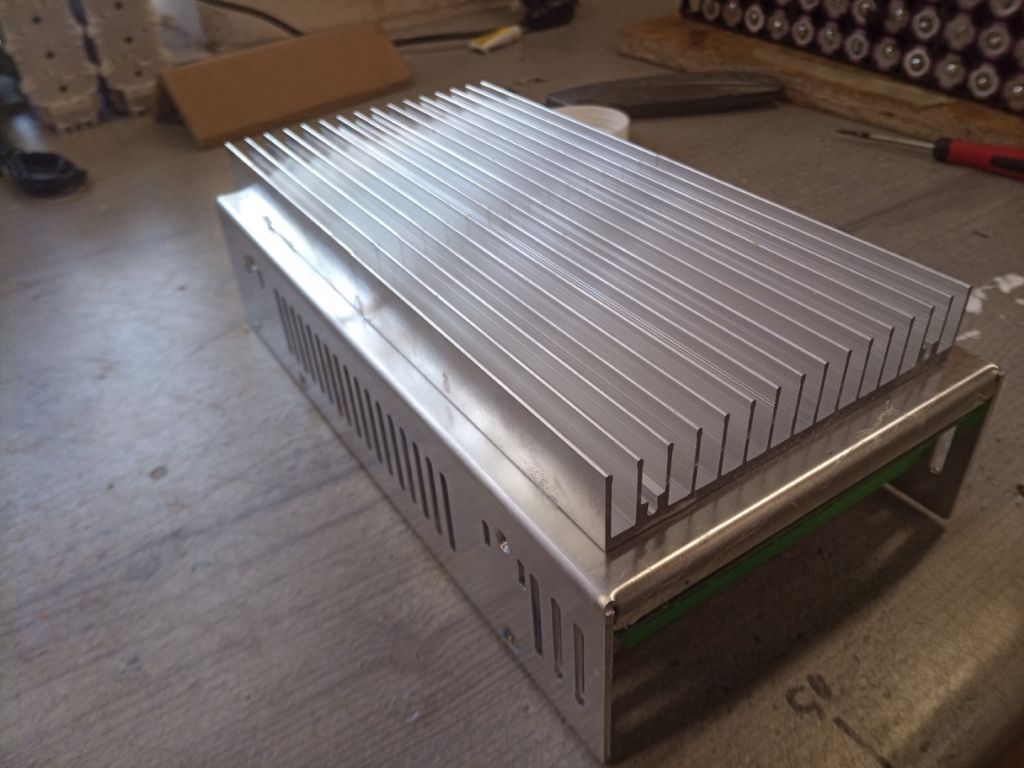
das Ganze dann noch über Nacht mit Schraubzwingen festspannen

fertig


so wird nun die Vorderseite bzw. alles, was auf der inneren Platine oben sitzt durch den aktiven Lüfter gekühlt, und die Leistungstranistoren die an der Rückseite sitzen und an das Metallgehäuse geklebt sind (und nichts vom Luftstrom abbekommen) können ihre Wärme nun durch die zusätzlichen Kühlkörper besser an die Umgebungsluft abgeben

Sobald ich den Laderegler selbst aktiv im Einsatz habe werde ich hier berichten
Bezugsquellen:
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
18.4.3 MPPT Laderegler 20 - 25A super-billig
Nachtrag: Warnung, nicht kaufen - die Laderegler von SX-Electronis sind Schrott, funktionieren nicht und es gibt weder Support noch Ersatz vom Hersteller
hier der neue, kleine MPPT Wechselrichter von SX-Electronics (ausschließlich über Aliexpress zu beziehen)
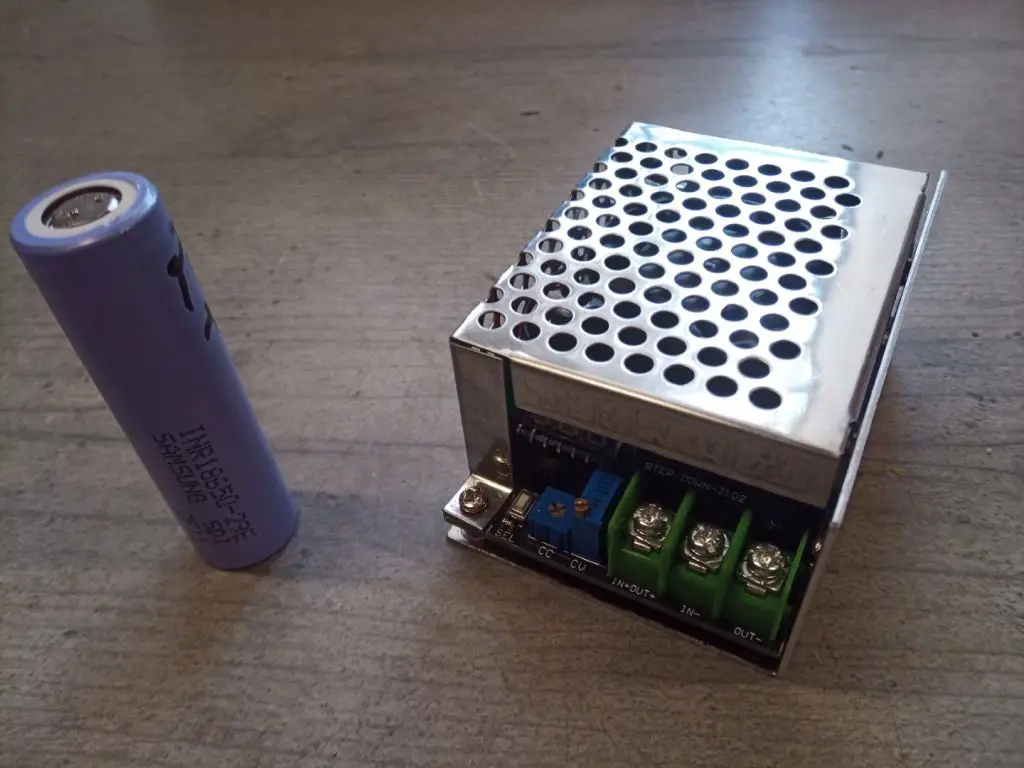
- bis 100V PV-EIngangsspannung
- Ausgangsspannung variabel einstellbar
- max. 25A Ladestrom, ebenfalls variabel einstellbar
- aktive Kühlung
- rund 25€ inklusive Versand
- weitere, ganz ähnliche Modelle verfügbar, z.B. mit 20A = 20€, mit 25A aber größerem Eingangsspannungsbereich bis 150V = 28€
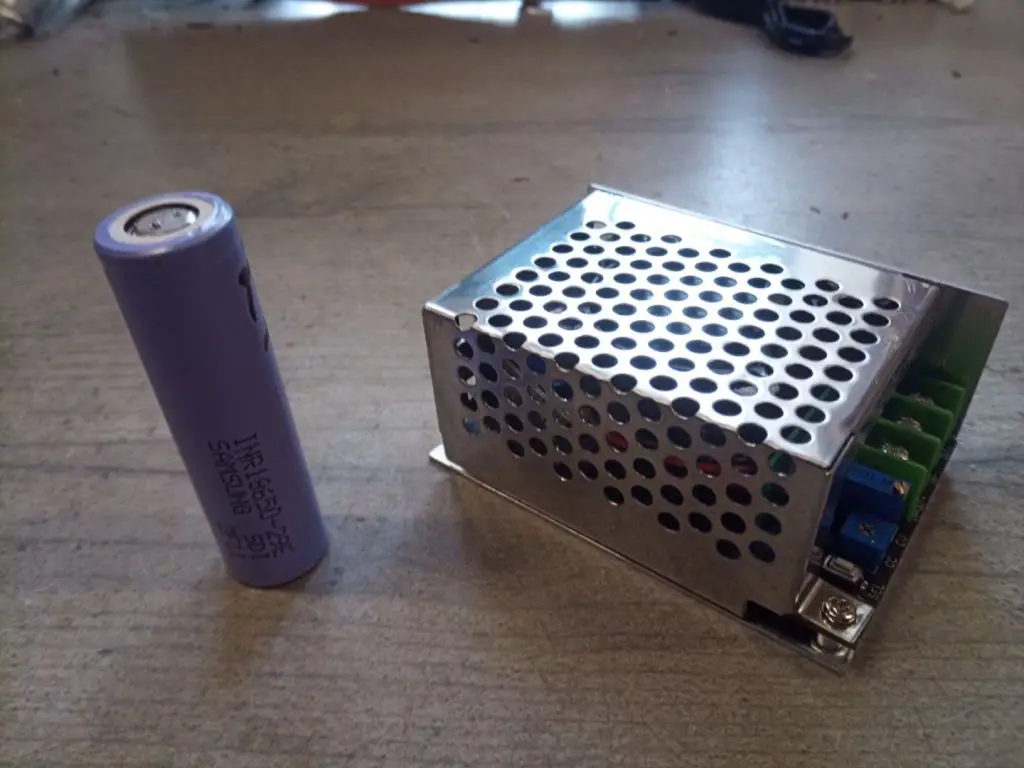
Nachtrag: Warnung, nicht kaufen - die Laderegler von SX-Electronis sind Schrott, funktionieren nicht und es gibt weder Support noch Ersatz vom Hersteller
Inhaltsverzeichnis:
- 1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)
- 2 Idee + Plan
- 3 Akku-Arbeitsplatz
- 4 eBike Akku Komponenten
- 5 eBike Akku zerlegen
- 6 Laptop Akkus zerlegen
- 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte
- 8 neue Hülle für 18650
- 9 China-Akkutest
- 10 Werkzeuge + Messgeräte
- 11 Null-Watt Einspeisung
- 12 Modbus / RS485 Adapter
- 13 BMS + Balancer
- 14 aktiv Balancer BMS - JKBMS
- 15 Ladegeräte + Kapazitätstester
- 16 kpl. Akkupacks testen
- 17 Innenwiderstand Ri
- 18 Solar Laderegler
- 19 Wechselrichter, Inverter
- 20 Löten - Anleitung für Akkus
- 21 Schlüsselanhänger aus 18650
- 22 Sicherheitskonzept
- 23 Akkus Beschaffung - wie und wo?
- 24 WVC / SG / GMI / PVGS Mikroinverter
- 25 Schritt-für-Schritt zur 18650 Powerwall
- 26 ATS - Automatic Transfer Switch
- 27 Schottky Sperrdioden für Parallelschaltung
- 28 Balkonsolar & Balkonkraftwerk
- 29 Hybrid Wechselrichter einrichten
19 Wechselrichter, Inverter
Ich möchte hier versuchen, ein paar interessante Wechselrichter für den DIY-Bereich vorzustellen und auch auf unterschiedliche Arten einzugehen.
Das Thema Wechselrichter an sich ist ein unendlich großes, weswegen das hier weder komplett noch abschließend sein kann sondern nur den Ausschnitt zeigt, den ich selbst relevant finde.
- Grid Tie inverter
- Grid Tie inverter mit Limiter
- Hybridwechselrichter
Was komplett fehlt ist der Bereich Inselwechselrichter.

Mehr zum Thema Inselbetrieb findest Du hier im Menüpunkt 11 Null-Watt-Einspeisung
1. Grid Tie inverter
Grid tie / Grid Tied / Grid Connected / GTI / Einspeisewechselrichter -> das alles meint dasselbe Prinzip. Das ist ein Wechselrichter, der in das öffentliche Stromnetz einspeist.
Und zwar ist das keine Funktion, die er zusätzlich zu etwas anderem kann, sondern das kann er ausschließlich.
Heißt: man kann damit keinen Inselbetrieb ermöglichen, da er zwingend ein öffentliches Netz benötigt um zu funktionieren. Das hat auch zur Folge, dass bei einem Stromausfall ein Grid tie inverter (GTI) sich ausschaltet, da er nur dann funktioniert, wenn auch ein Stromnetz mit 50 Hz anliegt.
Solche Wechselrichter sind die gängigsten und im Grunde an allen privaten sowie öffentlichen Photovoltaik-Anlagen zu finden, die weder über einen zusätzlichen Batteriespeicher verfügen noch einen autarken Inselbetrieb ermöglichen sollen.
Außerdem kommen sie auch vor an sog. Balkonkraftanlagen / Stecker-Photovoltaik / Balkonsolar, s. weiter unten.
1.1 SG Serie / WVC Microwechselrichter
Eine sehr preisgünstige Variante für Grid tie inverter sind die Modelle der WVC bzw. der SG Serie.

Die Geräte stammen alle aus China und es gibt keinen originären Hersteller, die Modelle werden von mehreren Fabriken gebaut, mit identischem Aufbau, identischen Preisen und dann direkt vertrieben. Ab und zu kommen auch neue Modelle hinzu, auch Weiterentwicklungen finden noch statt.
So ist die WVC-Serie die Grundserie, während die SG-Serie darauf aufbaut und nur minimale Verbesserungen gegenüber der WVC-Serie hat
- die WVC-Serie gibt es in verschiedenen Modellen von 300W bis 2.800W zu Preisen von 80€ - 250€ -> WVC 600+700 / WVC 1200+1400 auf Aliexpress
- die SG-Serie gibt es zwischen 200W und 1.400W zu Preisen zwischen 80€ und 250€ -> SG 700-1400 auf Aliexpress
Zu den beiden Mikro-Wechselrichtern gibt es ein eigenes Kapitel inkl. Erfahrungsbericht und Optimierungs-Modifikationen -> 24 WVC / SG / GMI Mikroinverter
1.2 ultra-günstige Microwechselrichter "GMI" Serie (= Grid tied Micro Inverter)
Noch günstiger als die WVC / SG Wechselrichter sind nur noch die Modelle der GMI Serie.

- ebenfalls reine Grid tie inverter
- ohne jeglichen Schnickschnack, ohne Display, WLan, App, Einstellmöglichkeiten
- einstecken und loslegen
- Leistungsbereich sehr eingeschränkt, es gibt lediglich Modelle zwischen 260W und maximal 350W
- ideal also für kleine Anlagen wie für Balkonkraftwerk / Gartenhütte oder/und um ein Photovoltaik-Modul direkt an zu schließen
- funktioniert laut mehrerer Internetberichte wohl sehr gut
Auf Youtube gibt es von Utuberlars zwei Videos zu dem Wechselrichter:
- Billigster Micro Tie Grid Inverter MPPT Solar Pure Sinewave on Grid Wechselrichter von Ebay/Amazon
- billigster Ebay Grid Inverter kurzes Resümee
as bei der geringen Größe nicht sehr wahrscheinlich ist)
GMI Mikro-Wechselrichter kaufen auf:
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
Handbuch zum Download:
{phocadownload view=file|id=17|target=b} {phocadownload view=file|id=16|target=b}
Auch zum GMI Mikrowechselrichter gibt es ein eigenes Kapitel inkl. Erfahrungsbericht und Optimierungs-Modifikationen -> 24 WVC / SG / GMI Mikroinverter
1.3 Wechselrichter mit 600W für Balkon-Anlagen / Balkonkraftwerke
Die oberhalb vorgestellten Modelle sind alle auch prädestiniert für den Einsatz von sog. Balkonkraftwerken / Balkonsolar-Anlagen / Solarkleinanlagen / Steckerdolaranlagen (die unterschiedlichen Bezeichnungen meinen alle dasselbe).

Erklärung Balkonsolar:
->Stecker-Solar: Solarstrom vom Balkon direkt in die Steckdose @ Verbraucherzentrale
Da die meisten der o.g. Modelle keine CE-Kennzeichnung haben und daher nicht verwendet werden können, falls Du vorhast eine solche Anlage von einem Elektriker installieren zu lassen oder offz. anzumelden (wozu man die Modellbezeichnung der verwendeten Komponenten alle angeben muss)
findest Du der Vollständigkeit halber hier eine Auflistung verschiedener Wechserlrichter mit 600W (= Grenze für Balkonsolar) und mit CE
-> Übersicht über Wechselrichter für Anlagen bis 600Wp @ Photovoltaikforum
2. Grid Tie inverter mit Limiter
Das sind Wechselrichter, die Strom ins Hausnetz einspeisen und zudem in der Leistung limitiert werden können.
Sinn macht das vor allem bei zwei Szenarien:
- wenn man eine Null-Watt-Einspeisung realisieren möchte, also wenn man genau den EIgenverbrauch durch Solarenergie abdecken will, darüber hinaus aber nichts ins öffentliche Netz einspeisen. Dazu braucht der Wechselrichter die Information, wie denn der (permanent schwankende) Haushaltsverbrauch gerade ist um sich in seiner Leistung entsprechend anpassen zu können
- wenn man einen Batteriespeicher benutzt. Da Batteriespeicher immer sehr teuer und daher begrenzt ist möchte man keinen Strom verschwenden und auch hier nur genau so viel ins Hausnetz einspeisen, dass der EIgenverbrauch genau gedeckt ist; darüber hinaus soll kein Strom ins öffentliche Netz eingespeist werden. Auch hier muss der Wechselrichter wissen, wievielStrom er einspeisen muss und sich entsprechend regulierend anpassen.
Wechselrichter mit Limiterfunktion sind in der Regel arg teuer. Nachfolgend werden zwei preiswerte Lösungen vorgestellt
2.1 Sun GTIL2 1.000W / 2.000W
Der Klassiker unter den günstigen Grid tie Invertern mit Limiter ist der "Sun GTIL2" (GTIL = Grid Tie Inverter with Limiter)
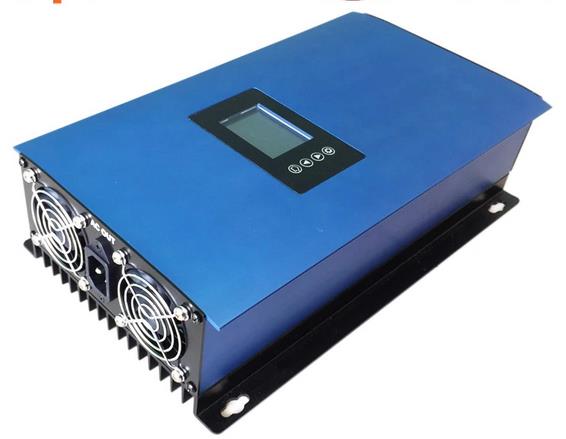
Es gibt ihn in zwei Varianten
- 1.000W Variante, wobei die Dauerleistung hier bei 800 Watt liegt
- 2.000W mit realen 1.600W
Einen Testbericht inkl. Bezugsquellen dazu habe ich hier geschrieben Akkus & PV - SUN GTIL2 1000 2000 MPPT Grid Tie Batterie Wechselrichter mit Limiter
Beide Modelle arbeiten nach demselben Prinzip.
Entweder man schließt an den Eingang eine Batterie an oder PV-Module. Beides zur selben Zeit geht nicht.
Der Limiter ist eine Stromklemme, die man nachträglich am Sicherungskasten an eine der drei Haupt-Phasen klemmt und die den Verbrauch an dieser Phase dem GTIL2 zurück meldet. Nun kann man den Wechselrichter so einstellen, dass er immer nur genau so viel Strom ins Hausnetz einspeist, wie verbraucht wird.
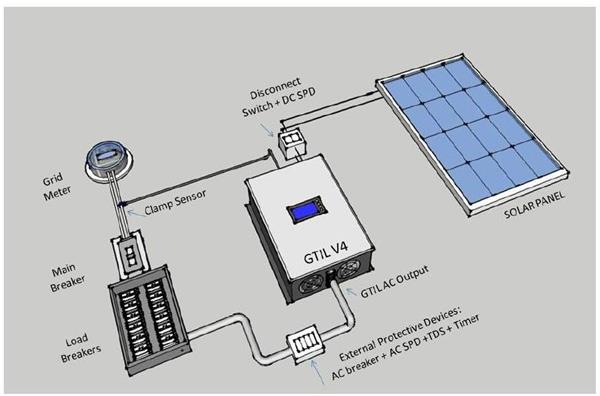
Achtung:
der GTIL2 arbeitet nur einphasig, d.h. er kann nur auf einer der drei Phasen einspeisen, und auch nur auf einer Phase messen.
Es ist möglich, drei Geräte zu kaufen und so alle drei Phasen damit abzudecken, aber dann ist man preislich in einem Bereich, wo sich ein Hybridwechselrichter lohnen könnte, s. weiter unten bei Punkt 3.
Downloads zum SUN GTIL2:
{phocadownload view=file|id=48|target=b}
{phocadownload view=file|id=49|target=b}
{phocadownload view=file|id=47|target=b}
Möchte man den GTIL2 mit Batterie betreiben benötigt man einen zusätzlichen Solar-Laderegler, hier am Schema der JN-MPPT-Mini
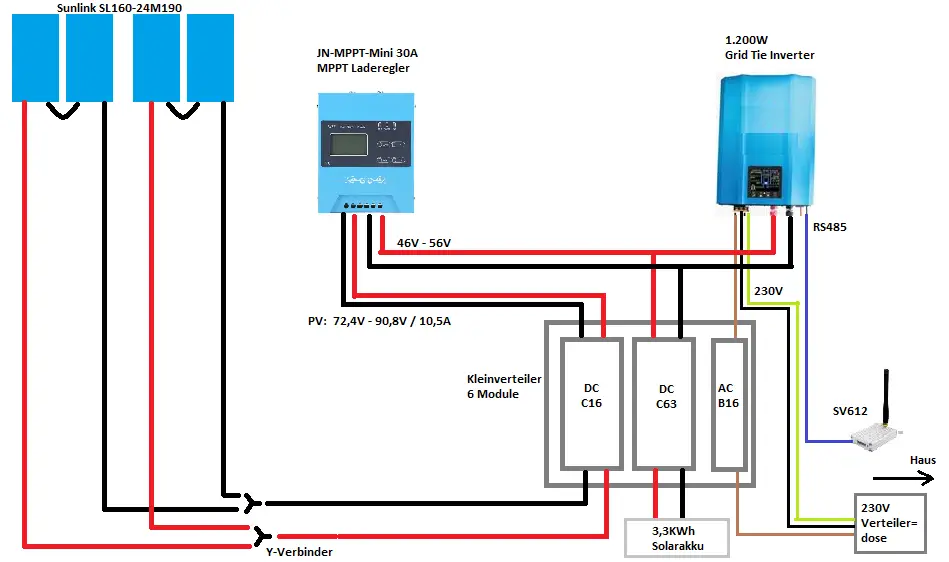
- die PV-Module kommen an den Solar-Laderegler
- der Laderegler lädt die Batterien
- der GTIL entnimmt Strom aus den Batterien und speist ins Netz ein
- an der Stelle in meinem Schema wo der "SV612" eingezeichnet ist kommt dann die Strom-Messklemme hin. In meinem Aufbau sitzt der GTIL und der Stromzählerkasten zu weit auseinander und um die Entfernung mittels Kabel zu überbrücken habe ich zwei Funkadapter (SV612) benutzt
Limiter manuel steuern:
Bastler haben den SUN GTIL2 so umgebaut, dass sie manuel und ohne Messklemme die Einspeisemenge steuern können, s. z.B. hier ->Ansteuerung GTIL2 @ Balkonsolar Forum
2.2 SoyoSource 1.200W
Von SoyoSource gibt es einen Wechselrichter, der ganz ähnlich ist wie der SUN GTIL2.

Er leistet reale 900W Dauerleistung und es gibt ihn in fünf Varianten
- PV Eingansspannung: 26V-45V oder 24V Batteriespannung
- PV Eingansspannung: 40V-60V oder 36V Batteriespannung
- PV Eingansspannung: 55V-90V oder 48V Batteriespannung
- PV Eingansspannung: 85V-130V oder 72V Batteriespannung
- PV Eingansspannung: 120V-180V oder 96V Batteriespannung
Kosten:
Der Preis liegt dabei bei unter 120€ + etwa 50€ Versand + Zoll = alles zusammen um 200€
Wie beim SUN GTIL2 auch kann man entweder Solarmodule direkt anschließen oder ihn für Batteriebetrieb nutzen.
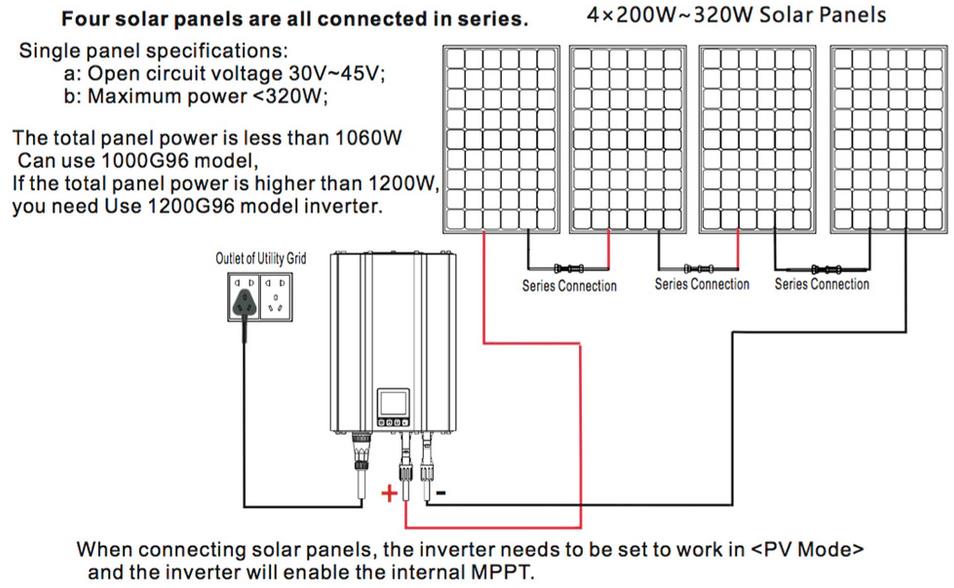
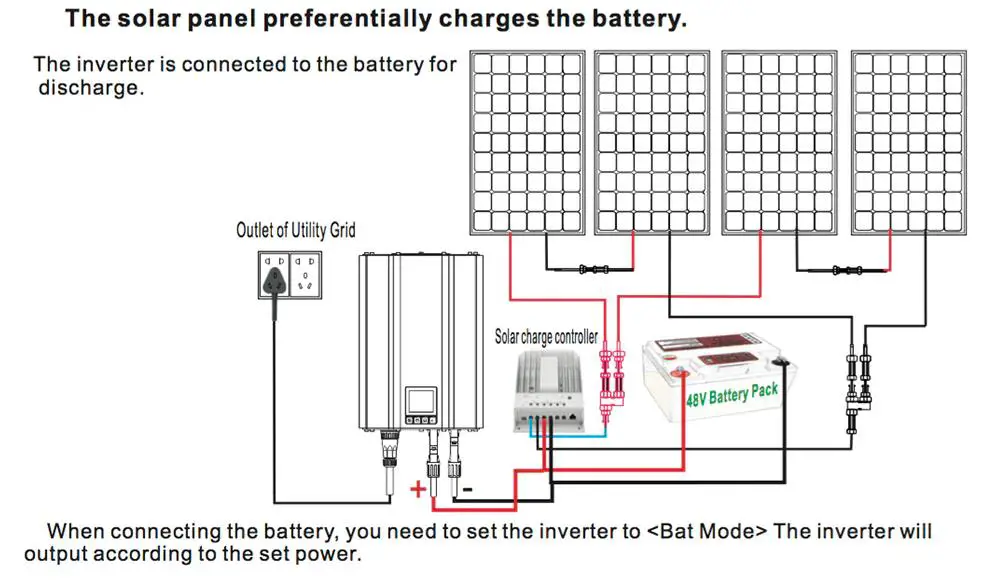
Und wie beim SUN GTIL2 auch besitzt der SoyoSource eine Stromklemme als Limiter, um auch einen Null-Watt-Einspeisebetrieb zu ermöglichen.
Positiv: man kann mehrere Geräte parallel betreiben, d.h. an derselben Phase anschließen um die Einspeiseleistung so zu erhöhen.
Ich benutze zwei der Modelle mit Spannungsbereich 55V-90V / 48V im Batteriebetrieb, wobei die Batteriespannung sehr flexibel einstellbar ist und ich sogar bis 64,8V gehe (16s100p System mit 16x 4,05V = 64,8V Gesamtspannung).
Die beiden Wechselrichter sind bei mir an der Powerwall in der Garage, um die Wallbox und damit auch das Elektroauto Aiways U5 mit sauberem Solarstrom zu versorgen.
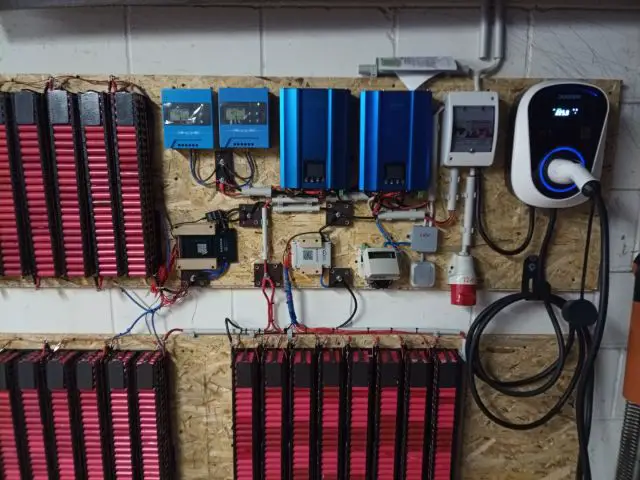
In meiner Konfiguration durch den Parallelbetrieb schießen die beiden Wechselrichter beim Laden des E-Autos 1.800W aus der Powerwall zu.
Bilder und Bericht von der Installation des Systems:
- KW51 - Belko Garagentoröffner, Duosida Wallbox
- KW52 - DIY Tesla-Powerwall 16s100p Mounting System
- KW53 - Aiways U5, DIY Tesla-Powerwall 16s100p
- KW01 - DIY 18650 Powerwall verkabeln
- KW02 - DIY 18650 Tesla Powerwall fertig, Gewürzregal
- KW05 - DIY 18650 Powerwall Spind 2
- KW10 - Garagendach PV
- KW11 - PV Holzunterstand klein
- KW19 - DIY 18650 Powerwall ATS
Ich habe zum SoyoSource 1.200W einen Testbericht veröffentlicht -> Akkus & PV - SoyoSource 1200W MPPT Grid Tie Batterie Wechselrichter mit Limiter
PS: es gibt noch eine Variante mit 1.000W
Ebenfalls gibt es noch eine ganz ähnliche Variante mit 500W sowie eine mit 600W wobei die beiden kleineren ohne Limiter kommen aber mit einer per Drehpoti einstellbaren Ausgangsleistung
Handbuch zum Download
{phocadownload view=file|id=42|target=b}
- Strom-Messklemmen für den SoyoSource Wechselrichter gibt es einzeln (soweit mir bekannt) aktuell nur über den Händler Jesudom bei Aliexpress -> EINE Neue Sensor Keine Meter für Soyosource GTN 1000W 2000W Solar Grid Tie Inverter
- Ersatzteile wie Display und MosFETs führt dieser auch -> GTN-1000W 1200W
2.3 Sonstige / Markenwechselrichter
Von den gängigen Markengeräten wie Victron, SMA, Kostal, Fronius gibt es auch Modelle mit Limiterfunktion.
Hier im Einzelnen in der Artikelbeschreibung darauf achten. Meist ist dann von einem "Energy Meter" oder "Smart Meter" oder von einem "S0-Zähler" die Rede.
Das ist die bessere / genauere Variante eines Limiters. Anstatt einer einfachen Stromklemme wird ein zusätzlicher Stromzähler im Sicherungskasten benötigt, der den aktuellen Stromverbrauch an den Wechselrichter meldet, der meist per Modbus verbunden wird.
Da die Geräte der o.g. Hersteller mit Limiterfunktion schnell sehr teuer werden lohnt es sich den nächsten Punkt als Alternative durchzulesen.
3. Hybridwechselrichter
Die Bezeichnung Hybridwechselrichter meint hier die Kombination aus Solar-Laderegler und Batterie-Wechselrichter in einem Gerät.

Bei den bekannten Markenherstellern wie Kostal, SMA, Fronius etc. gibt es natürlich auch Hybridwechselrichter, aber diese Modelle sind idR besonders teuer, arbeiten zudem oftmals mit Hochvolt-Baterien, die ebenfalls sehr teuer sind und für den DIY / Selbstbau definitiv nicht zu empfehlen sind weil lebensgefährlich.
Aus diesem Grund sind gerade im Bereich Selbstbau die Modelle von MPP Solar / Infinisolar äußerst interessant.
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
3.1 MPP Solar / Infinisolar / EASun / Effekta / FSP / Primo / Axpert -> Voltronic
Im Selbstbau / DIY-Bereich findet man häufiger Geräte von MPP Solar, Infinisolar, EASun etc.
Bei genauerem Hinschauen vertreiben die oben genannten Marken alle weitestgehend identische Wechselrichter-Modelle. Das kommt daher, dass das Original vom ein und demselben Hersteller stammt, von Voltronic aus China -> https://voltronicpower.com/
Einige der o.g. Marken bauen die Voltronic-Modelle in Lizenz (z.B. MPP Solar aus Taiwan), andere vertreibt Voltronic selbst unter diesen Markennamen (Infinisolar, Axpert).
Zudem findet man auf eBay und Aliexpress auch auf den ersten Blick identische Modelle mit weiteren Markennamen oder sogar noname. Bei diesen besonders aufpassen, da sie in der Regel unlizenzierte Billig-Nachbauten sind mit zweifelhafter Qualität, keinerlei Erfahrungswerten und ohne Support, z.B. hier:

und hier

Alle in der Überschrift genannten Markennamen sind bekannt und gebräuchlich, aber gerade mit MPP Solar und Infinisolar gibt es sehr viel Erfahrung und auch die Rückmeldungen & Erfahrungsberichte im Netz sind vielfältig und durchweg gut.
Nicht alle aber viele der Modelle von MPP-Solar / Infinisolar sind zudem VDE-konform und dürfen nach deutschem Recht verwendet werden - was bei den allermeisten der günstigen Wechselrichter aus China nicht der Fall ist.
Ergänzung: einzig die Modelle der MPI Serie sind VDE-konform und verfügen über die notwendigen AR-N 4105 Zertifikate
- Hybrid Wechselrichter MPI 10k mit 10000 Watt von MPP Solar Infinisolar
- Hybrid Wechselrichter MPI 5.5k mit 5500 Watt von MPP Solar Infinisolar
Ich verweise hier mal noch auf die Bezugsquellen für die beiden Hersteller.
MPP Solar:
- offz. Webseite: https://www.mppsolar.com
- Bezugsquelle per Mail über Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
- Bezugsquelle per Maximumsolar
- kein eigener Onlineshop, auch nicht über Aliexpress oder eBay / Amazon
Infinisolar:
- offz. Webseite: Infinisolar auf Voltronic.com
- Bezugsquelle 1: Cercastock.it
- Bezugsquelle 2: Cercastock auf eBay
- teilweise auch über Aliexpress und Amazon aber nicht alle Modelle
In der Regel sind die Geräte über Cercastock teurer als die vergleichbaren Modelle von MPP Solar, dafür hat man einen europäischen Händler mit europäischem Produkthaftungsrecht.
Bei MPP Solar bekommt man deutlich mehr Informationen / Updates / Downloads / Handbücher etc. über deren Webseite sowie einen guten technischen Support per Mail, was bei Infinisolar fast komplett fehlt.
Dafür wird der Schadensfall bei MPP-Solar idR so reguliert, dass man die Wahl hat, das defekte Gerät auf eigene Kosten nach Taiwan zu senden, oder ein Austauschteil (meistens irgendeine defekte Platine) zugeschickt bekommt, was man dann selbst einbauen muss.
Vorteil bei allen Geräten ist:
- große Auwahl an Geräten mit unterschiedlichen Leistungsklassen
- gute technische Ausstattung
- sehr viele EInstellmöglichkeiten per Software
- Konnektivität per diverser Schnittstellen (USB, Com, Modbus, teils WLan, teils Ethernet) entweder ab Werk bereits verfügbar oder für vergleichsweise wenig Geld nachrüstbar, bei vielen namhaften Herstellern entweder garnicht möglich oder sehr teuer
- sehr zuverlässig, es gibt mittlerweile viele Erfahrungsberichte in diversen Foren und auf Youtube über die letzten ca. 15 Jahre
- der Preis ist weitaus günstiger als ähnlich ausgestattete Markengeräte
Nachteil bei allen Geräten
- Serviceabwicklung / Garantieumsetzung schwierig
- Plagiate mit ungewisser interner Technik auf dem Markt (s. weiter oben, nonames auf eBay und Aliexpress)
- Eigenverbrauch ist nicht mehr zeitgemäß. Im Schnitt 50 Watt Eigenverbrauch je Phase mit wenig bis keinen Stromeinsparmechanismen im Standby, d.h. die großen dreiphasigen Modelle mit 10KW Leistung verbrauchen rund 150W permanent. Aktuelle Wechselrichter von Markenherstellern benötigen etwa 1/3 aber kosten dann eben in der Anschaffung etwa das Doppelte oder mehr.
Da ich je ein Gerät von Infinisolar und eines von MPP-Solar im Einsatz habe möchte ich meine Erfahrung mit den beiden gerne teilen.
3.2 Infinisolar E5.5 KW
Bei Infinisolar ist die "E" Serie identisch mit der "MPI" von MPP Solar und als einzige geeignet für den netzparallelen Betrieb
Die Übersicht der Modelle ist bei MPP-Solar am besten und gilt auch für die Infinisolar.
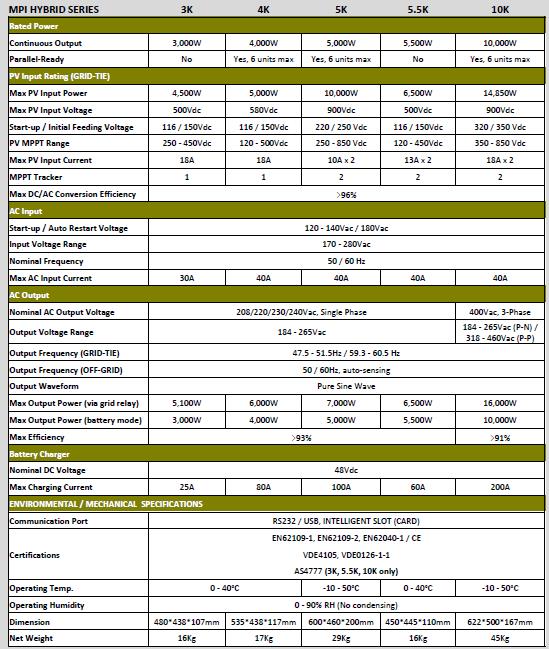
- Hybrid Wechselrichter MPI 10k mit 10000 Watt von MPP Solar Infinisolar
- Hybrid Wechselrichter MPI 5.5k mit 5500 Watt von MPP Solar Infinisolar
Die größte Einschränkung des E 5.5 zu den anderen Modellen (die auch den Haupt-Preisunterschied ausmachen dürfte): die maximale Ladeleistung in die Batterie bzw. den Akku beträgt nur 60A. Selbst das Modell mit 4KW hat 80A Ladeleistung und nur das Einstiegsmodell mit 3KW hat weniger.
Im Betrieb heißt das: wenn man im Sommer in möglichst kurzer Zeit möglichst jeden Sonnenstrahl in den Akku laden muss damit er voll wird (weil er sehr groß ist) dann hat man hier einen Flaschenhals.
Die beiden anderen abgespeckten Punkte:
- kein Parallelbetrieb mit mehreren Wechselrichtern möglich
- "nur" 500V maximale PV-Eingangsspannung, das kleinere Modell mit 5KW verträgt schon 900V
Ansonsten ist der Wechselrichter mit 5,5KW und sogar bis zu 6,5KW PV-Anschlussleistung richtig leistungsfähig und bietet dieselben Funktionen wie die anderen / teureren Modelle, weswegen ich den auch seit Sommer 2020 in Betrieb habe.

der Wechselrichter kann per Menü + Display, aber auch per Windows Software (USB oder Com-Port) eingestellt werden
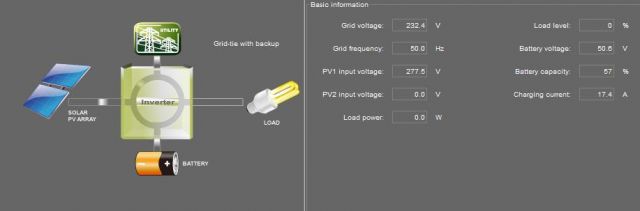
Hier ein paar Fotos samt Infos vom Einbau / Inbetriebnahme des Infinisolar Wechselrichters
Handbuch als Pdf zum Download:
{phocadownload view=file|id=21|target=b}
{phocadownload view=file|id=22|target=b}
Das besondere am Infinisolar E 5.5KW wie auch an der gesamten E-Serie bzw. der MPP Solar MPI-Serie ist, dass diese Wechselrichter für den netzparallelen Betrieb geeignet sind.
D.h. man kann sie parallel zur bestehenden Strominstallation im Haus dazu klemmen, ohne irgendwelche Leitungen umklemmen zu müssen.
Der Wechselrichter ist mittels Software sehr einfach und äußerst flexibel einstellbar. Das wichtigste sind die verschiedenenen, möglichen Arbeitsmodi und Priorisierungen der Leistung. Klingt kompliziert, ist es aber nicht.
Im Grunde kann und muss man hier einstellen, wenn ein Verbrauch am Haus ansteht (z.B. Waschmaschine läuft) woher der Strom nun kommen soll.
- von den Solarmodulen?
- aus dem geladenen Akku?
- oder aus dem Netz?
Dazu dann noch Priorisierungen, falls z.B. keine Sonne da ist, was passiert dann, Strom aus dem Netz oder der Batterie?
Oder wenn die Batterie leer ist und die Sonne geht auf was soll der Wechselrichter zuerst bedienen, den Stromverbrauch am Haus, oder soll er zuerst die Batterie aufladen?
Bei mir ist das so geregelt:
- decke den Strombedarf am Haus mittels Solarmodulen ab
- falls dann noch Strom übrig ist -> lade damit den Akku
- falls dann noch immer Strom übrig ist bzw. Akku voll -> speise ins Netz ein
- falls keine Sonne scheint -> entnimm Strom aus den Akkus um den Hausverbrauch zu decken
- falls keine Sonne scheint und Akku leer -> na dann mach eben garnix
Das gute beim Netzparallelbetrieb ist ja, dass keinerlei Einschränkungen entstehen, wenn weder Sonne noch Akkustrom vorhanden sind.
Dann wird das Haus eben ganz normal aus dem Netz gespeist, ohne irgendetwas umzuschalten und ohne, dass irgendetwas dabei nicht funktionieren könnte.
Nachteil dabei ist eben, dass man zwingend einen zusätzlichen Stromzähler zur eigenen Verwendung braucht.

Das ist ein Eastron SDM630 auch Energy Meter / Smart Meter / S0-Zähler genannt. Er verfügt über einen Modbus-Kommunikationsport und kann so mit dem Wechselrichter verbunden werden.
Der hat dann mit dem Energieversorger / Netzbetreiber nichts zu tun, kostet auch nur einmalig Geld (knappe 100€) und dient dazu, dem Wechselrichter den aktuellen Strombedarf des Hauses mitzuteilen.
Beispiel Waschmaschine:
heizt diese gerade das Wasser auf 60°C hoch wird sie ca. 2.800 Watt verbrauchen -> das meldet der Zähler dem Wechselrichter zurück, und wenn gerade keine Sonne scheint dann speist er die benötigten 2.800W aus dem Akku ins Hausnetz, sodass in der Summe kein Strom vom Energieversorger bezogen werden muss.
Da in der Summe also 0 Watt Verbrauch herauskommt und dementsprechend auch 0 Watt eingespeist werden spricht man von einer 0-Watt Einspeisung.
Ob der Wechselrichter bei Sonnenschein ins öffentliche Netz einspeisen soll oder nicht kann man getrennt einstellen und macht dann Sinn, wenn man die PV-Anlage offz. gemeldet hat und eine EEG Einspeisevergütung erhält.
Akkustrom einzuspeisen macht nicht nur keinen Sinn, es ist in Deutschland auch nicht erlaubt, hier MUSS also eine 0-Watt Einspeisung zumindest für den Akkubetrieb eingehalten werden.
Damit man den SDM630 Energy-Meter an den Wechselrichter mittels Modbus anschließen kann benötigt man übrigens die "Modbus Erweiterungskarte" für um 90€

Alle Wechselrichter der E-Serie bzw. der MPI Serie haben einen Erweiterungssteckplatz, in den man verschiedene Arten von Erweiterungskarten einstecken kann. Für den Netzparallelbetrieb benötigt man zwingend die Modbus-Karte.
Hier findest Du eine Anleitung zum Einstellen von SDM630 sowie auch der Modbuskarte -> 11 Null-Watt-Einspeisung
3.3 MPP Solar MPI 10k

Das Flagschiff der Serie netzparalleler Wechselrichter. Seit Ende 2020 gibt es von Infinisolar noch ein 15KW Modell, bei MPP Solar ist bei 10 KW Schluss.
Das Besondere hier: die 10k bzw. 15k Modelle sind die einzigen, die dreiphasig angebunden sind.
Ansonsten ist die Technik weitestgehend gleich.
- 2 MPP Tracker
- gigantische 200A Ladestrom (einstellbar, denn das müssen die angeschlossenen Akkus auch erstmal verkraften)
- im Vergleich zum Infinisolar E5.5 k ein paar mehr Einstellungsmöglichkeiten in der Software was aber eher Richtung Feintuning geht, keine echten, zusätzlichen Funktionen
- richtig robust / stabil und durchdacht konstruiert. Bringt mit 45 KG auch einiges auf die Waage
- genug Leistung, um auch ein Elektroauto damit zu laden
Hier ein paar Bilder und Eindrücke vom Einbau:
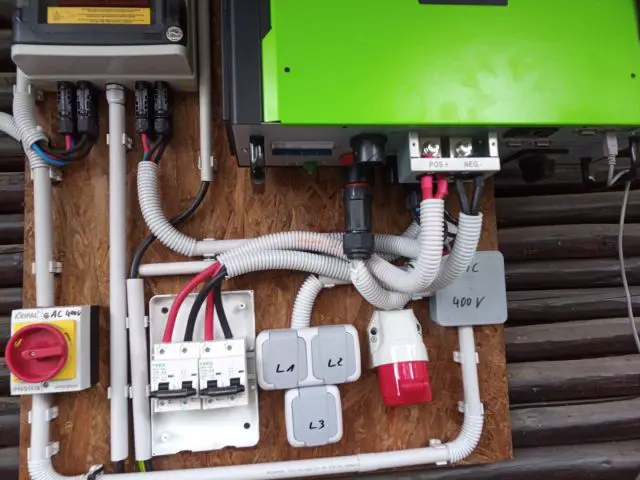
Handbuch als Pdf zum Download sowie Bezugsquellen samt Zubehör findest Du hier:
- Hybrid Wechselrichter MPI 10k mit 10000 Watt von MPP Solar Infinisolar
- Hybrid Wechselrichter MPI 5.5k mit 5500 Watt von MPP Solar Infinisolar
Inhaltsverzeichnis:
- 1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)
- 2 Idee + Plan
- 3 Akku-Arbeitsplatz
- 4 eBike Akku Komponenten
- 5 eBike Akku zerlegen
- 6 Laptop Akkus zerlegen
- 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte
- 8 neue Hülle für 18650
- 9 China-Akkutest
- 10 Werkzeuge + Messgeräte
- 11 Null-Watt Einspeisung
- 12 Modbus / RS485 Adapter
- 13 BMS + Balancer
- 14 aktiv Balancer BMS - JKBMS
- 15 Ladegeräte + Kapazitätstester
- 16 kpl. Akkupacks testen
- 17 Innenwiderstand Ri
- 18 Solar Laderegler
- 19 Wechselrichter, Inverter
- 20 Löten - Anleitung für Akkus
- 21 Schlüsselanhänger aus 18650
- 22 Sicherheitskonzept
- 23 Akkus Beschaffung - wie und wo?
- 24 WVC / SG / GMI / PVGS Mikroinverter
- 25 Schritt-für-Schritt zur 18650 Powerwall
- 26 ATS - Automatic Transfer Switch
- 27 Schottky Sperrdioden für Parallelschaltung
- 28 Balkonsolar & Balkonkraftwerk
- 29 Hybrid Wechselrichter einrichten
20 Löten - Anleitung für Akkus
Achtung:
Das Löten von LiIon Akkuzellen ist nicht ungefährlich. Bei zu viel Hitzeeintrag in die Zelle kann diese explodieren, also nicht einfach mit irgendeinem Lötkolben drauflos Löten und ewig auf der Akkuzelle herumkokeln sondern die nachfolgenden Punkte beachten.
Zum Einstieg noch zwei gute Videos zum Thema Löten von Akkuzellen:
Punktschweißen vs. Löten
Kapazitätsverlust durch Löten? (18650 Powerwall)
Was viele beim Punktschweißen auch unterschätzen ist der enorme Zeitaufwand, um gebrauchte Zellen für das Schweißen vorzubereiten. Beide Pole müssen sauber, glatt und komlett freivon Rückständen der alten Schweißstellen und Nickelstreifen sein, sonst kann man keine neuen Nickelverbinder aufschweißen.
Beim Löten entfällt das. Mit dem richtigen Lötdraht und Lötkolben musst Du weder vorher schleifen / Dremeln noch reinigen, und auch die Busbar nicht vor-verzinnen, diese Schritte könntest Du Dir sparen.
Wenn Punktschweißen oder ein andere Weg zu löten für Dich klappt - kein Problem, ich will hier niemanden missionieren, aber ich habe demnächst Akkzuelle Nr. 10.000 durch, und da lautet das Motto: was man an Einzelschritten einsparen kann - einsparen.
Deswegen hier eine Anleitung, wie ich es mache:
1. Zellen vorbereiten
- Nickelreste nur grob entfernen. Am Pluspol gehen die ja meist recht sauber ab, am Minuspol so, dass nichts störend absteht
- kein schleifen, ein Dremeln, kein Vorreinigen, kein Lötfett
2. Zellen vorlöten
- alle Zellen in die Plastikhalter / auf die Packs aufteilen
- Plus- und Minuspol vorlöten, also einen Tropfen Lötdraht drauf, s. auch Video weiter unten
- Lötdraht: "Fluitin Sn60" -> das ist ein sehr guter Lötdraht mit guten Verbindungen und prima Flussmittel, das erspart vieles an Vorarbeit.Gibt es nicht mehr frei verkäuflich wegen des Bleianteils, aber auf eBay-Kleinanzeigen findet man eigentlich immer welches. Eine 1KG Rolle kostet um 35€ und ist ausreichend um rund 2.500 Zellen zu verbauen.
- Unbedingt Rauchabsaugung / kleinen Ventilator benutzen. Gibt es so wie hier auf dem Bild mit Schlauch auf eBay oder Aliexpress

- Lötkolben: damit der Kontakt zu den LiIon Zellen möglichst kurz bleibt muss der Lötkolben ausreichend Leistung bringen. Ich benutze nach mehreren Versuchen nun einen Ersa 150S Lötkolben (erhältlich auf eBay und Amazon) (identisch mit Ersa 155 JD) mit 150W und flacher, abgewinkelter Dauer-Lötspitze. Das Ergebnis ist absolut topp und schnell, pro Lötpunkt unter 2 Sekunden
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |

- Technik: Löspitze etwa im 45° Winkel auf den Pol aufsetzen -> Lötdraht in die Ecke zwischen Pol und Lötspitze antupfen -> sobald der Draht zerfließt und man einen kleinen, hellbraunen Rand (= Flussmittel) erkennt -> fertig. So gibt es auch keine kalten / losen Lötstellen
3. Sicherungsdraht verlöten
- Busbars vorbereiten, also verdrillen, Ringkabelschuhe + Schrumpfschlauch (13mm Durchm./22mm Flachmaß in Rot / Schwarz = ideal für 16mm Ringkabelschuhe) dran, mit Kabelbindern auf den Akkupacks befestigen -> sonst nix, kein Vorlöten, keine Markierungen, kein Säubern, kein Anrauhen. PS: wenn das Kupfer schon länger liegt und patiniert ist muss man es natürlich vorher säubern, ansonsten nicht
- Sicherungsdraht (0,2mm / 5A) ohne zu Schneiden am Stück = in Wellen nach und nach auf das Akkupack auflöten. In zwei Schritten, zunächst nur auf die Zellen löten und nicht auf die Busbars -> Video dazu am Ende des nächsten Abschnittes
Sicherungsdraht 0,2mm = 5A Belastbarkeit auf eBay1 / eBay2 / eBay3

- Lötkolben: für den Sicherungsdraht braucht man nicht so viel Hitze. Mein 45W Ersa-Kolben war zu schwach, damit konnte ich nicht flüssig am Stück arbeiten. Mittlerweile habe ich hier eine billige noname Lötstation (-> ca. 30€ auf eBay) mit 60 Watt, mit 5mm Rundspitze die schräg abgeflacht ist, das geht 1A.
Temperatur: 370°C Löttemperatur an den Pluspolen, 390°C an den Minuspolen (+/- 5°C je nachdem, wie die Außentemperatur ist)

4. Busbars verlöten
- um den Sicherungsdraht an die Busbars zu löten braucht man wieder mehr Power, da das dicke Kupfer die Hitze des Lötkolbens sehr schnell abzieht und weiter leitet.
- Lötkolben: Hierzu wieder den Ersa 150 Watt Lötkolben hernehmen
- Technik: wenn die Busbar eine typische "U-Form" hat dann an einem Ende der Busbar anfangen und reihum über die Busbar arbeiten. Löspitze etwa im 45°Winkel auf die Stelle setzen, wo der Sicherungsdraht die Busbar kreuzt. Geht auch kurz davor oder kurz dahinter (+/- 1mm). Beim ersten Lötpunkt ist die Busbar noch kalt und es dauer länger, etwa 5 Sekunden die Lötspitze aufsetzen, dann erst -> Lötdraht in die Ecke zwischen Busbar und Lötspitze antupfen -> sobald der Draht zerfließt und man einen kleinen, hellbraunen Rand (= Flussmittel) erkennt -> fertig. Bei der zweiten Lötstelle braucht es noch etwa 2 Sekunden "Vorheizzeit" und ab dann kann man direkt nacheinander die Lötpunkte setzen, sodass es auch hier insgesamt rund 2 Sekunden prio Lötpunkt braucht.
- Achtung: im Bereich der Kabelbinder aufpassen. Zu viel Hitze (= zu langer Lötkontakt) kann verursachen, dass der Schrumpfschlauch der Zelle unter der Busbar schmilzt, die Busbar durch den Kabelbinder nach unten gezogen wird -> Kurzschluss am unisolierten Zellengehäuse. Deswegen im Bereich der Kabelbinder die Lötzeit möglichst kurz halten. Falls man mal länger braucht -> kurz unterbrechen, mit der übernächsten Zelle weiter machen (und den zwei, drei darauffolgenden) und erst dann wieder zurück zur Kabelbinderstelle, bis dahin ist die Busbar abgekühlt
- Tipp: auch wenn die Busbar einen dicken Durchmesser hat -> man benötigt auch hier nur einen kleinen Tropfen Lötdraht, damit der Sicherungsdrakt Kontakt hat, keinen riesigen Klecks
Sicherungsdraht 0,2mm = 5A Belastbarkeit auf eBay1 / eBay2 / eBay3

5. Sicherungsdraht abknippsen
nachdem alles gelötet ist den überflüssigen Sicherungsdraht zwischen den Zellen mit einem Mini Seitenschneider abknippsen (-> 5€ auf eBay) überflüssig = so, dass jede Zelle nur einen Weg zur Busbar hat und nicht mit zwei Enden verbunden ist, da er sonst nicht durchbrennen wird.
Die Schritte 3 bis 5 siehst Du hier:
Hier noch ein langweiliges, ungeschnittenes Video vom kompletten Lötvorgang eines 10p AKkupacks, bei dem man mal ohne Zeitraffer die Arbeitsgeschwindigkeit abschätzen kann.
DIY 18650 Powerwall - 100p Akkupack löten mit Busbars und Sicherungsdraht
21 Schlüsselanhänger aus 18650
Was tun mit defekten / schwachen Zellen außer zum Wertstoffhof bringen?
Eine Möglichkeit: Schlüsselanhänger machen.

Zuerst mittels Last oder Widerstand dafür sorgen, dass die Zellen auch wirklich komplett leer sind.
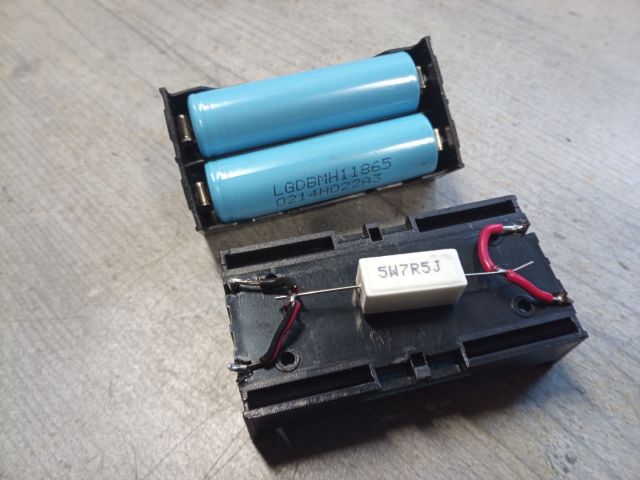
da ich zwei Zellen parallel an einem 5W Widerstand habe und dieser dann sehr heiß wird habe ich noch einen Aluminiumkühlkörper aufgelegt

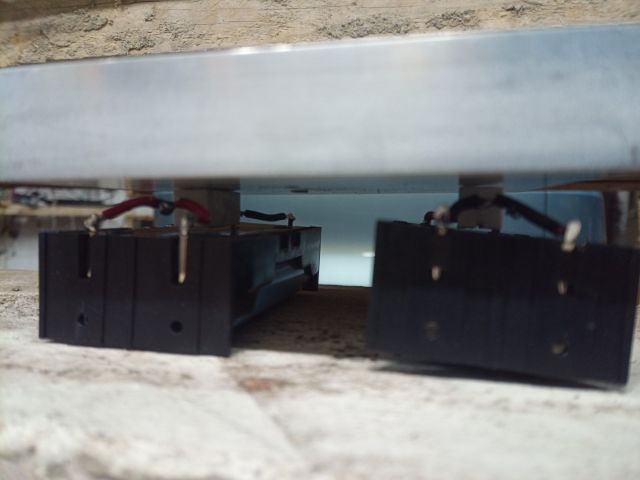
nach zwei Tagen Entladen dann um ganz sicher zu gehen nochmal eine Woche kurzgeschlossen. Danach sind die Akkus zu 100% tot und es kann in der Hosentasche zusammen mit Kleingeld oder Schlüsseln nichts mehr passieren

die Hülle kann man auch dran lassen, ich wollte einen Schlüsselanhänger, bei dem die Zellen nackt / silbrig sind

minimale Nickelreste sind OK, das ist sogar hilfreich beim späteren Löten

nun einen ordentlich großen Tropfen Lötdraht auf den Boden

so

als Schlüsselanhänger habe ich diese einfachen Schlüsselketten / Schlüsselringe von eBay für rund 3€ für 5 Stück

das äußerste Kettenglied vorverzinnen

dann den Lötklecks wieder verflüssigen und das Kettenglied komplett eintauchen

so hält das nun bombenfest

geht auch ruckzuck. Mit einem Zellhalter (50er Pack 5x4 auf Aliexpress) kann man auch gut arbeiten da die Zelle dann beim Löten nicht wackelt

fertig


Inhaltsverzeichnis:
- 1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)
- 2 Idee + Plan
- 3 Akku-Arbeitsplatz
- 4 eBike Akku Komponenten
- 5 eBike Akku zerlegen
- 6 Laptop Akkus zerlegen
- 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte
- 8 neue Hülle für 18650
- 9 China-Akkutest
- 10 Werkzeuge + Messgeräte
- 11 Null-Watt Einspeisung
- 12 Modbus / RS485 Adapter
- 13 BMS + Balancer
- 14 aktiv Balancer BMS - JKBMS
- 15 Ladegeräte + Kapazitätstester
- 16 kpl. Akkupacks testen
- 17 Innenwiderstand Ri
- 18 Solar Laderegler
- 19 Wechselrichter, Inverter
- 20 Löten - Anleitung für Akkus
- 21 Schlüsselanhänger aus 18650
- 22 Sicherheitskonzept
- 23 Akkus Beschaffung - wie und wo?
- 24 WVC / SG / GMI / PVGS Mikroinverter
- 25 Schritt-für-Schritt zur 18650 Powerwall
- 26 ATS - Automatic Transfer Switch
- 27 Schottky Sperrdioden für Parallelschaltung
- 28 Balkonsolar & Balkonkraftwerk
- 29 Hybrid Wechselrichter einrichten
22 Sicherheitskonzept
Lithium Akkus und generell der Umgang mit Batterien und hohen Strömen ist nicht ganz ungefährlich.
Zur Brandgefahr von LiIon Akkus geistern oft auch viele unbestimmte Schreckensszenarien in den Kopfen der Menschen herum.
Hinzu kommen dann auch entsprechende Berichte in den Medien.

Hier mal zwei abschreckende, aber sehr interessante Beiträge zur Brandgefahr von Akkus:
-> Unberechenbar? Wenn Akkus und Batterien zur Gefahr werden | Exakt - Die Story | MDR @ Youtube
oder auch hier:
Moin,
hier im Nachbarort hat es gestern dann mal offensichtlich Ratlosigkeit gegeben:
"Brennende Lithium-Ionen-Akkus im Keller eines Einfamilienhauses sorgen für langen Einsatz"
Zeitungsartikel mit Bild vom Einsatz
Gruß
Jan
-> zum Ursprungsthread @ PV-Forum
Klar ist:
Hier hilft kein Kleinreden, kein "Augen zu und durch" oder "mir wird das schon nicht passieren".
Aber:
Nicht selten ist den Menschen unklar, was genau passieren kann und wieso es passiert, geschweige denn, ob und wie man einen Schadensfall im Vorfeld verhindern könnte.
Das einzige was hilft:
sich vor Baubeginn mit der Thematik LiIon / Akku / Strom / Brandgefahr intensiv auseinanderzusetzen und danach erst zu entscheiden, ob man eine Powerwall aus LiIon Zellen bauen möchte oder nicht - und dann dementsprechend Vorkehrungen zu treffen.
Die mit großem Abstand allermeisten Akkubrände passieren übrigens nicht bei Selbstbau, sondern im Bereich Unterhaltungselektronik.
- Handys, die durch Dauerbenutzung überhitzen
- (billige) Elektrospielzeuge ohne Schutzmechanismen
- eBike-Akkus deren Ladegerät versagt und den Akku unzulässig überladen
- Verdampfer, Drohnen, Hoverboards, ...
Hier möchte ich so gut mir möglich ist einige Tipps und Informationen bereit stellen, um die DIY 18650 Powerwall soweit irgend möglich ungefährlich zu konstruieren.
Gleich Vorweg:
es gibt keine 100%-ige Sicherheit, ein Restrisiko bleibt immer. Aber wenn DU die nachfolgenden Punkte beherzigst bleibt es äußerst gering.
Es gibt bestimmt noch andere, weitgehendere Methoden, aber ich für mich habe folgendes Sicherheitskonzept erarbeitet:
Sicherheitskonzept - Kurzform
Zunächst als Übersicht eine Kurzfassung meines Sicherheitskonzetes. Ausführlicher und mit vielen Details dann weiter unten.
1. Unfallvermeidung im Vorfeld
- alle Zellen einzeln auf Herz und Nieren testen in einem mehrstufigen Testverfahren und erst dann verwenden, wenn alle Werte einwandfrei sind
- Kabel, Verbinder, Elektronikbauteile so dimensionieren, dass immer Leistungsreserven da sind und sich nichts erhitzt
- die Akkupacks in einem Bereich benutzen, wo sie kaum Leistung bringen müssen (0,5A je Zelle) und schonen / ohne Erwärmung betrieben werden
2. Unfallvermeidung im Betrieb
Mehrere Sicherheitsmechanismen parallel
- wie Einzelabsicherung auf Zellebene (Sicherungsdraht)
- DC-Sicherungen zwischen Akku und Wechselrichter
- BMS mit Über- und Unterspannungsschutz auf Einzelzellebene, Überlast- sowie Übertemperaturschutz
- Wechselrichter mit Über- / Unterspannungsschutz sowie Überlastschutz auf Packebene
3. Unfallminimierung im Ernstfall
Sollte im laufenden Betrieb eine Zelle schadhaft werden (durch Alterung, Produktionsmangel) und im schlimmsten Fall sich so stark erhitzen, dass sie Feuer fängt dann wäre der Worst-Case ein Thermal Runaway, also eine Kettenreaktion, bei der die benachbarten Zellen ebenfalls erhitzt werden und Feuer fangen.
Ich setze hier an zwei Punkten an:
- Separatoren zwischen den Akkupacks, damit sich eine Kettenreaktion nur auf das betroffene Akkupack beschränkt und nicht auf andere Packs übergreifen kann. Und wenn dann nur zeitverzögert, wodurch ein Thermal Runaway zumindest stark abgeschwächt wird
- feuerfestes Gehäuse. Falls alle Maßnahmen von der Vorauswahl der Zellen, über die verschiedenen Absicherungen und technischen Schutzeinrichtungen erfolglos bleiben, dann können die Akkus gefahrlos innerhalb des feuerfest ausgekleideten Metallspindes ausbrennen und fertig
Sicherheitskonzept - ausführlich

1. Unfallvermeidung im Vorfeld
1.1 alle Zellen einzeln auf Herz und Nieren testen in einem mehrstufigen Testverfahren und erst dann verwenden, wenn alle Werte einwandfrei sind

- Sichtprüfung: äußerlich erkennbare Schäden wie Undichtigkeit / Elektrolytverlust, Löcher im Zellenboden durch Entfernen der Nickelstreifen, Rost (auch kleinste Roststellen), Dellen / Knicke im Zellmantel -> solche Zellen werden gnadenlos aussortiert und wandern zum Wertstoffhof
- Spannungsprüfung: Tiefenentladung (= 2,5V und niedriger) schädigt Li-Ion Zellen. Hier kommt es auf die Dauer der Tiefenentladung an, je länger desto schädlicher. Ich entsorge solche tiefentladenen sowie 0-Volt-Zellen, bei denen ich nicht weiß, wie lange sie schon tiefenentladen sind. Dazu gehören generell alle Zellen aus Laptopakkus. Viele Powerwall-Bastler lassen einmal getestete Zellen noch rund 4 Wochen ruhen und prüfen die Spannung danach erneut um einen Spannungsverlust zu messen. Ich mache das nicht da der Aufwand bei über 10.000 Zellen einfach zu hoch ist, und ich minimal abfallende Spannungen vertreten kann da ich in all meinen Systemen aktive Balancer verbaut habe, die das ausgleichen.
- Innenwiderstand: alle Zellen werden mit einem speziellen Messgerät auf ihren internen Widerstand hin geprüft s. hier im Menü Punkt 17 Innenwiderstand Ri
- Kapazitätstest: alle Zellen werden einzeln auf ihre Rest-Kapazität hin geprüft. Zellen mit weniger als 70% ihrer ursprünglichen Kapazität haben bereits zu viel geschuftet und werden entsorgt, die guten Zellen werden nach ihrer Kapazität in 50mAh-Schritten in Boxen sortiert s. 15 Ladegeräte + Kapazitätstester
- Heater: das sind Zellen, die beim Ladevorgang Energie in Hitze umwandeln anstatt in Aufladung. Das kann dazu führen, dass sie so heiß werden, dass sie Feuer fangen. Man erkennt sie während des Kapazitätstests wenn die dort sehr heiß werden, aber idR auch während der Innenwiderstandsprüfung durch einen hohen Wert meist weit über 100mOhm. Hilfreich ist hier auch eine Wärmebildkamera, um Heater zu identifizieren, s. auch -> 10 Werkzeuge + Messgeräte
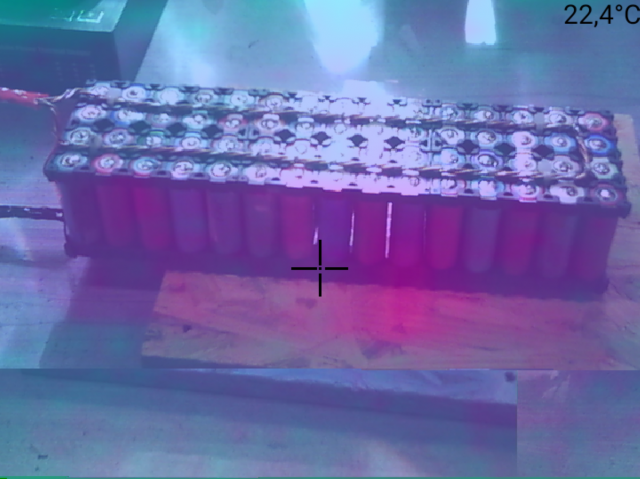
1.2 Kabel, Verbinder, Elektronikbauteile so dimensionieren, dass immer Leistungsreserven da sind und sich nichts erhitzt
Ich benutze immer einen Online-Rechner um verlässliche Angaben zu erhalten, wie dick die Kabel und Busbars ausgelegt sein müssen, um die geplante Stromstärke zu verkraften -> Kabellängen & Kabelquerschnitts Rechner @ elektroinstallation-ratgeber.de
Ich habe ein 48V Akkusystem und hauptsächlich Akkupacks mit 60 Zellen parallel. Die Einzelzellen möchte ich mit maximal 1A belasten, also ist 60A das absolute Maximum insgesamt - und das auch nur kurzfristig. Laut dem Online-Rechner ist ein 16mm² Kupferkabel für 60A ausreichend solange man nicht mehr wie 3,5m Kabellänge hat.
Dasselbe gilt für die Kupfer-Busbar, die muss dann entsprechend denselben Durchmesser haben wie die Verbindungskabel zwischen Akkupack und Wechselrichter / Solar-Laderegler.
Bei den Verbindern: keine Lüsterklemmen, keine Kabel einfach nur verdrillen oder sonstwie zusammenfriemeln sondern vernünftige Ringkabelschuhe und Verschraubungen nutzen.

1.3 die Akkupacks in einem Bereich benutzen, wo sie kaum Leistung bringen müssen (0,5A je Zelle) und schonen / ohne Erwärmung betrieben werden
- Stromstärke: ja, 18650er Zellen können idR 10A und auch mehr leisten. Aber: nicht dauerhaft und nicht, ohne sich dabei zu erhitzen. Noch dazu benutze ich gebrauchte Zellen, daher halte ich mich an die Vorgabe: maximal 1A Lade- und auch Entladestrom je Zelle, und das auch nur kurzzeitig. Für den Dauerbetrieb strebe ich 0,5A je Zelle an. In diesem Bereich erwärmen sich die Zellen auch bei langer Lade- und Entladedauer nicht was ein Plus an Sicherheit und an Lebensdauer mit sich bringt da hohe Temperaturen schlecht sind für LiIon.
- Spannungsbereich: noch wichtiger als die Stromstärke ist die Spannung der Zellen. Üblicherweise geht der nutzbare Spannungsbereich von LiIon Zellen von 2,6V bis 4,20V. Voll geladen hat eine LiIon-Zelle 4,20V und je leerer sie wird, desto weiter sinkt ihre Spannung. Im Bereich um 3,7V hat sie am meisten Energie. Doch der Betrieb an der oberen sowie unteren Spannungsgrenze stresst die Zellchemie und lässt sie altern. Deswegen benutze ich in der Powerwall einen eingeschränkteren Spannungsbereich von 3,30V - 4,05V das stresst die Zelle weniger und erhöht die Lebensdauer. Hinweis an dieser Stelle: absolut tödlich für LiIon und häufigste Brandursache ist ein "Überladen" also eine Spannung über 4,20V
- Temperaturbereich: LiIon mag es nicht kalt. Und auch nicht heiß. 25°C sind die optimale Betriebstemperatur. Bei Temperaturen um +5°C und darunter sinkt die Kapazität sowie auch die Ladeleistung und Entladeleistung. Das Gute: wenn es wieder wärmer wird steigen die Werte wieder und die LiIon Zellen haben dadurch keinen Schaden genommen. Anders bei Hitze. Temperaturen um 70°C und mehr schädigen LiIon nachhltig
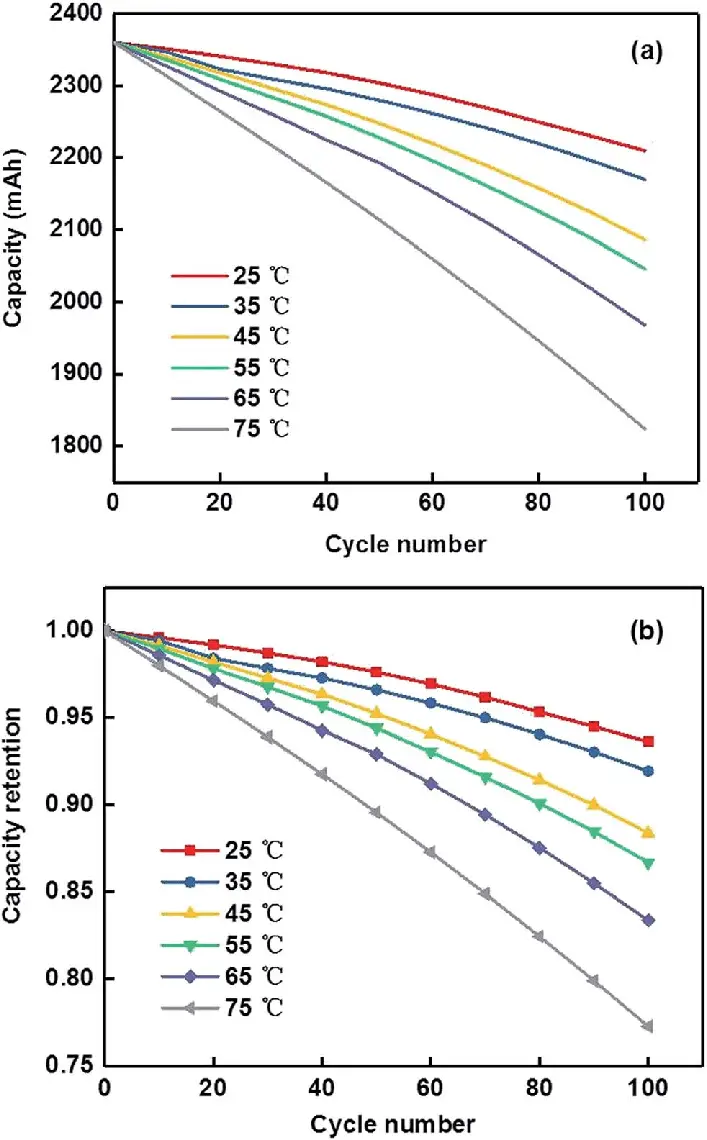
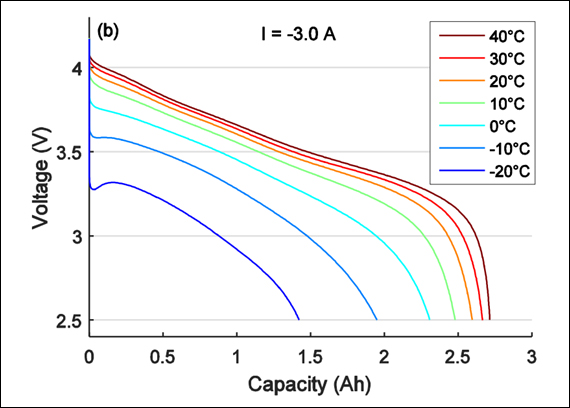
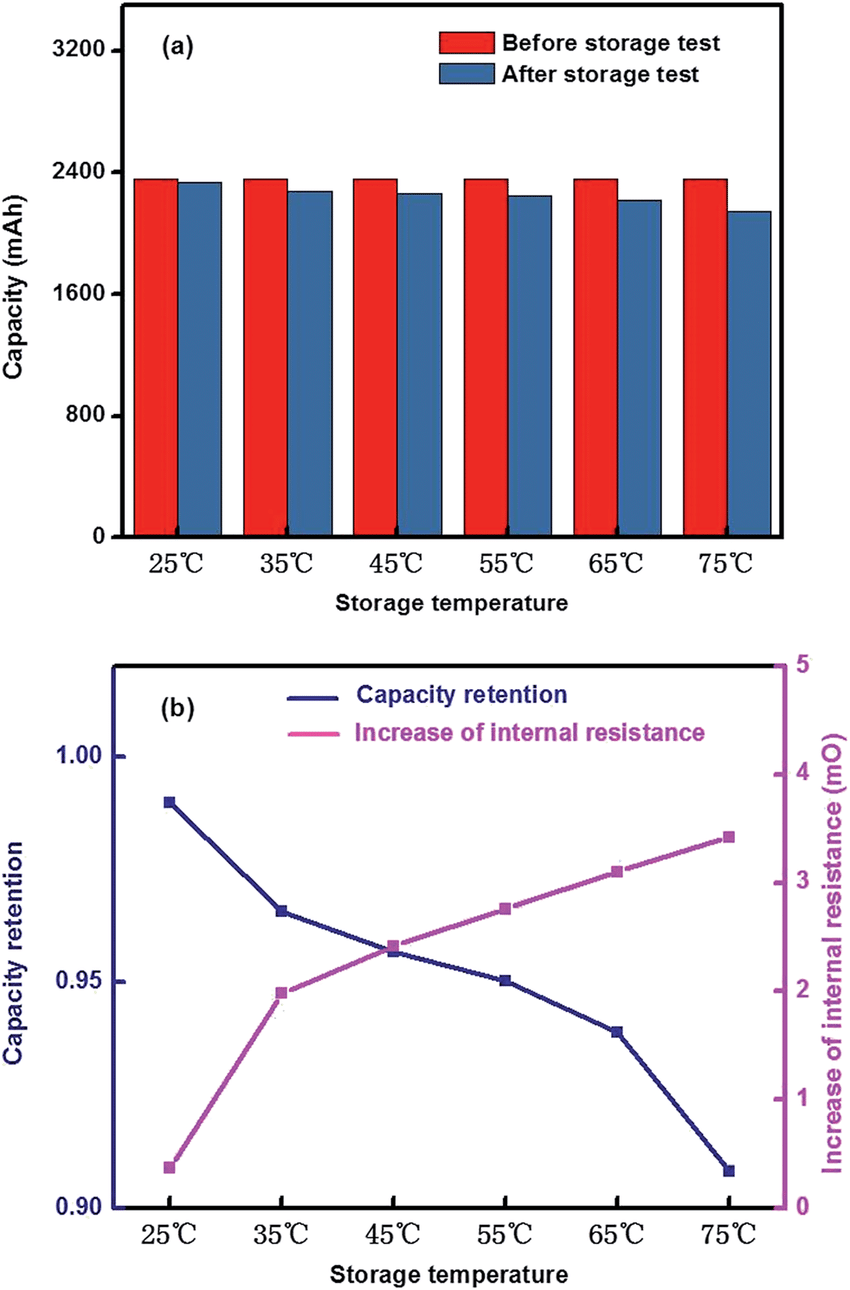
Bildquellen: Thermal management investigation for lithium-ion battery module with different phase change materials
2. Unfallvermeidung im Betrieb
Nach der Vorsortierung der Zellen kann es dennoch im laufenden Betrieb zu Ausfällen und Fehlern kommen, sei es durch Versagen oder einfach durch Alterung der Zellen. Aus diesem Grund setze ich auf mehrere Sicherheitsmechanismen parallel
2.1 Einzelabsicherung auf Zellebene (Sicherungsdraht)
Jede Zelle sichere ich einzeln ab mittels Sicherungsdraht / Fuse wire. Und zwar in 0,2mm Stärke = 5A Absicherung. Ich benutze diesen hier -> eBay-Link (seit Brexit leider mit extrem teurem Porto, aber es gibt kaum Alternativen).

Prinzipiell geht jeder 0,2mm Kupferdraht, das Problem ist nur dass man hier entweder nur Bastel- / und Schmuckdraht findet = nur kurze Längen, oder Trafodraht um Spulen zu wickeln = emailliert (isoliert mit Lack) was sich nicht ohne weiteres löten lässt.
Bei Sicherungsdraht ist zu beachten, dass die Ampèrezahl bei der er durchbrennt variiert mit der Länge des Drahtes, s. auch hier -> Diy Tesla Powerwall ep15 Testing Cell Level Fuse Wire Part 2 Shocking Results @ Youtube, Average Joe
Das ist auch einer der Hauptgründe, weswegen Punktschweißen / Spotwelding für DIY Powerwalls nicht in Frage kommen sollte, da man hier keine gescheite Einzelabsicherung machen kann s. auch hier -> 20 Löten - Anleitung für Akkus
2.2 DC-Sicherungen zwischen Akku und Wechselrichter
Trotz Zell-Einzelabsicherung mit Sicherungsdraht ist eine Sicherung zwischen dem kompletten Akkupack und dem weiteren System enorm wichtig, denn im Falle eines Fehlers / eines Kurzschlusses fließen hier bei 60 Zellen und 5A Sicherungsdraht für einen kurzen Moment 60 x 5A = 300A (= genug um 15mm Stahl zu schweißen) x 48V = 14.400 Watt.
Das will man nicht haben, also ist eine zusätzliche Sicherung sinnvoll. Beim geplanten 60A maximaler Leistungsentnahme benutze ich einen 63A Sicherung. Und zwar weder eine KFZ-Flachsicherung noch einer Keramiksicherung die durchbrennt und erstrecht keine schaltbare 12V KFZ-Sicherung so wie hier

Solch eine Sicherung mit 100A hatte ich ganz zu Anfangs verbaut und die ist bei 25A Dauerstrom bereits so heiß geworden, dass man sie kaum noch anfassen konnte.
Deswegen benutze ich nur noch Sicherungsautomaten speziell für DC / Gleichspannung und zwar diese von FEEO
Die sind sehr hochwertig gebaut, mit CE Zertifikat und bis 500V Gleichspannung ausgelegt. Wichtiger Unterschied gegenüber AD-Sicherungen: diese hier haben einen speziellen Innenaufbau mit Funkenstrecken-Schutz. PS: die nutze ich auch als 16A Variante an den PV-Modulen. Diese haben idR um 10A Leistung und man kann sie damit dann auch einfach abschalten, für Wartungsarbeiten o.ä.
2.3 BMS mit Über- und Unterspannungsschutz auf Einzelzellebene, Überlast- sowie Übertemperaturschutz
Wer behauptet, man könne bei LiIon auf ein BMS verzichten hat keine Ahnung und ist maßlos leichtsinnig. Punkt, da gibt es keine sinnvolle Diskussion und auch keinen Spielraum.
Immer dann wenn Li-Ion Zellen in Reihe geschaltet werden MUSS ein BMS = Battery Management System verwendet werden -> s. 13 BMS + Balancer

Hauptgrund: Schutz vor Überladung. Zwar kann man im Wechselrichter bzw. im Laderegler die maximale Ladespannung einstellen, z.B. bei einem 14s System wären das 14x 4,20V = 58,8V aber das ist nicht ausreichend.
Folgendes Szenario:
Wenn beispielsweise ein Zellpaket deutlich fitter ist als die anderen 13 (oder weniger schnell altert als der Rest) dann wird es nach einem Entladezyklus, welcher planmäßig bei 3,3V endet vielleicht noch 3,8V haben. Erstmal unkritisch. Das gefährliche geschieht beim Laden.
Das Laden endet dann, wenn die Zellen 4,20V erreicht haben. Rechnet man da die 0,5V des einen fitten Packs dazu hat man ein Problem, denn dieses wird dauerhaft bis 4,70V überladen, bis (vielleicht) mal die Gesamt-Abschaltspannung von 58,8V erreicht wird. Und genau bis das passiert hast man sehr wahrscheinlich einen Thermal Runaway also eine Kettenreaktion, bei der die überladenen, überhitzten AKkus sich entzünden und alle benachbarten Zellen anstecken.
Und genau das verhindert ein BMS da es die Einzelzellspannungen überwacht und den Ladevorgang frühzeitig unterbricht, sobald ein einzelnes Zellpaket (hier in dem Fall das eine fitte Akkupack mit 0,5V höherer Spannung) die Grenze von 4,20V erreicht.
Ein gescheites BMS hat zudem noch weitere Schutzmechanismen:
- Unterspannung
- Überbelastung beim Entladen
- Überbelastung beim Laden
- Überhitzung
- Kurzschlussschutz
Ein BMS sitzt immer im Minus-Strang zwischen Powerwall und Wechselrichter und unterbricht den Kontakt im Fall eines Fehlers.
Ich benutze ein BMS mit all diesen Schutzfunktionen und zudem integriertem aktiven Balancer sowie App -> 14 aktiv Balancer BMS
2.4 Wechselrichter mit Über- / Unterspannungsschutz sowie Überlastschutz auf Packebene
Ein weiterer Schutz der gesamten Powerwall sind die Optionen, die Wechselrichter und Laderegler idR bieten
- Überspannungsschutz (= einstellbare maximale Ladespannung)
- Unterspannungsschutz (= einstellbarer Schutz vor Tiefenentladung)
- Überlastschutz (= einstellbarer maximaler Lade- / Entladestrom)
2.5 Absicherung AC-seitig
Der Wechselrichter selbst ist natürlich mittels separatem Sicherungsautomaten an das Hausnetz angeschlossen.
- 1x B16 für die kleinen SoyoSource / SG-Series Grid Tie Inverter
- 1x B20 für den Infinisolar E 5.5K
- 3x B16 für den MPP Solar MPI 10k
Also immer nur leicht höhere Absicherungswerte als die maximale Einspeiseleistung des Wechselrichters bzw. sogar darunter, der E 5.5k packt AC-seitig bis zu 25A aber dafür ist meine Stromleitung nicht ausgelegt, also habe ich ihn per Software begrenzt auf 20A.
3. Unfallminimierung im Ernstfall
Sollte im laufenden Betrieb eine Zelle schadhaft werden (durch Alterung, Produktionsmangel) und im schlimmsten Fall sich so stark erhitzen, dass sie Feuer fängt dann wäre der Worst-Case ein Thermal Runaway, also eine Kettenreaktion, bei der die benachbarten Zellen ebenfalls erhitzt werden und Feuer fangen.
Ich setze hier an zwei Punkten an:
3.1 Separatoren zwischen den Akkupacks
Damit sich eine Kettenreaktion nur auf das betroffene Akkupack beschränkt und nicht auf andere Packs übergreifen kann verwende ich Fermacellplatten in 10mm Stärke (feuerfest > 1.000°C) zwischen den Akkuppacks, darüber, darunter und auch seitlich.

Falls es dann trotzdem zu einem Übergreifen auf ein benachbartes Akkupack kommen sollte dann allenfalls stark zeitverzögert, wodurch ein Thermal Runaway verhindert oder zumindest stark abgeschwächt wird.
Mehr Bilder vom Aufbau der Powerwall mit Fermacell Separatoren hier -> KW06 - DIY 18650 Powerwall Spind 3
3.2 feuerfestes Gehäuse
Falls alle bis hierher genannten Maßnahmen von der Vorauswahl der Zellen, über die verschiedenen Absicherungen und technischen Schutzeinrichtungen erfolglos bleiben, dann sind die Akkuzellen dennoch in einem feuerfesten Metallgehäuse untergebracht.
Hier können die Akkus dann gefahrlos ausbrennen und fertig.
Ich habe zwei Arten von feuerfesten Gehäusen gebaut. Mit Metallkisten und mit Spinden, wobei die Art im Grunde identisch ist und sie sich nur in der Größe unterscheiden.
Da dünnses 2mm Metall alleine nicht sicher genug ist um einem Lithiumbrand mit 1.000°C stand zu halten (und falls doch dann würde es root glühen und trotzdem alles drumherum in Brand setzen) habe ich das Gehäuse zunächst von innen isoliert und zwar mit Mineralwolle von Isover in 40mm und mit WLG32.

Die ist einerseits feuerfest bis > 1.000°C und schützt damit das Metallgehäuse, zudem schirmt es die Hitze vom Metallgehäuse durch die Isolierfähigkeit auch ab. Also ist das Metallgehäuse doppelt geschutzt. Die o.g. fermacellplatten hingegen sind zwar feuerfest, aber durch die fehlende Isolierung wird Hitze sehr schnell durch sie hindurch wandern.
Deswegen habe ich mich auch für Mineralwolle in WLG32 entschieden. Das ist die beste aktuell verfügbare Wärmedämmung welche somit vergleichsweise wenig Hitze durchlassen wird.
Leider ist WLG32 in 40mm Stärke sehr unüblich und daher in der Regel in keinem baumarkt vor Ort verfügbar. Im Internet lohnt es sich oftmals auch, für eine Rolle zu bestellen (um 65€ pro Rolle inkl. Versand = ausreichend für einen 3er-Spind und zwei Metallkisten).
Randnotiz: mehr Infos zu Dämmung und Mineralwolle auch hier in unserem Energiekonzept
1.) Metallkiste für 14s60p System

Bilder vom Bau: Teil 1 - Teil 2 - Teil 3 - Teil 4 - Teil 5
PS: die Lüfter + Kühlkörper sind überflüssig, wenn man max. 1A Lade- / Entladestrom pro Zelle einhält
2.) Spind für entweder 2x separate 14s60p Systeme oder 1x 14s120p System je Abteil

Bilder vom Bau: Teil1 - Teil 2 - Teil 3 - Teil 4 - Teil 5 - Teil 6
Inhaltsverzeichnis:
- 1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)
- 2 Idee + Plan
- 3 Akku-Arbeitsplatz
- 4 eBike Akku Komponenten
- 5 eBike Akku zerlegen
- 6 Laptop Akkus zerlegen
- 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte
- 8 neue Hülle für 18650
- 9 China-Akkutest
- 10 Werkzeuge + Messgeräte
- 11 Null-Watt Einspeisung
- 12 Modbus / RS485 Adapter
- 13 BMS + Balancer
- 14 aktiv Balancer BMS - JKBMS
- 15 Ladegeräte + Kapazitätstester
- 16 kpl. Akkupacks testen
- 17 Innenwiderstand Ri
- 18 Solar Laderegler
- 19 Wechselrichter, Inverter
- 20 Löten - Anleitung für Akkus
- 21 Schlüsselanhänger aus 18650
- 22 Sicherheitskonzept
- 23 Akkus Beschaffung - wie und wo?
- 24 WVC / SG / GMI / PVGS Mikroinverter
- 25 Schritt-für-Schritt zur 18650 Powerwall
- 26 ATS - Automatic Transfer Switch
- 27 Schottky Sperrdioden für Parallelschaltung
- 28 Balkonsolar & Balkonkraftwerk
- 29 Hybrid Wechselrichter einrichten
23 Akkus Beschaffung - wie und wo?
- Wo bekommt man nun 18650er LiIon Zellen her, um sich daraus eine Powerwall selbst zu bauen?
- Wie stellt man das an?
- Was kostet das?
Diese Fragen möchte ich versuchen, nachfolgend zu klären.

Vorab:
Es geht entweder schnell und teuer oder mit viel Zeit und Geduld, dafür günstig bis kostenlos.
Wer das hier liest und am liebsten morgen fertig sein will muss seine Akkuzellen kaufen. Hier gibt es auch keine wirklich günstige Quellen, da die Preise auf dem Markt bei allen Händlern in etwa gleich sind.
Nun aber der Reihe nach
- Kaufen - Neu
- Kaufen - gebraucht & getestet
- Laptopakkus
- eBike-Akkus
1. Kaufen - Neu
Die bequemste Möglichkeit ist es sicherlich, neue Zellen zu kaufen.
Samsung INR18650-35E mit 3.500mAh (= derzeit bester 18650 Akku auf dem Markt) auf eBay1 / eBay2 / eBay3 / eBay-Suche / Amazon / Amazon-Suche / Manomano / Aliexpress-Suche

Bei einer typischen Powerwall mit 14s60p Bauweise und insgesamt 840 benötigten Zellen ist man hier schnell bei 8.400€ Kosten - für eine Speicherkapazität von effektiv 8,7 KWh = 965€ pro KWh Speicher.
Das ist sehr viel und man kommt etwa gleich teuer weg, wenn man sich einen fertigen Solarspeicher von einem namhaften Hersteller kauft.
Eine preiswertere Alternative bei Neukauf ist der Shop nkon.nl aus Holland
Dort kostet z.B. die o.g. Samsung 35E nur 4,95€ Einzelpreis. Noch dazu kommt, dass es bei nkon gute Staffelpreise gibt, man bei Bestellungen in der Größenordnung einer Powerwall sehr schnell sehr viel günstiger ist. So kosten die 35E ab 600 Stück "nur noch" 3,75€ / Stück.
Bei anderen Modellen sind die Staffelpreise teilweise noch besser.
Achtung:
Vorsicht vor noname Zellen mit riesigen Kapazitätsangaben.
Auf eBay, Amazon und Aliexpress gibt es Unmengen verschiedener Lithiumzellen mit Phantasie-Angaben.
Diese sind in der Regel aus chinesischer Fertigung und sind - Betrug, Abzocke, Beschiss. Hierzu habe ich extra 62 Chinaakkus (20 unterschiedliche Modelle von 10 Herstellern) bestellt und einen großen Test durchgeführt.
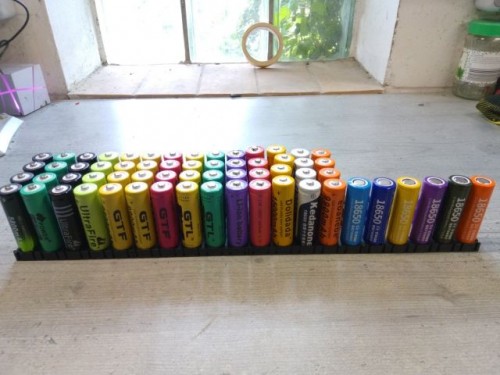
Definitiv abraten würde ich auch von Bestellungen von neuen Marken-Zellen über eBay und gerade eBay-Kleinanzeigen.
Nicht nur dass die Preise dort meist stark überteuert sind, viel schlimmer ist, dass sich dort viele unseriöse Händler herumtreiben, die
- Restposten
- B-Ware
- Rückläufer
- Zellen mit Produktionsdatum von vor drei, vier oder fünf Jahren anbieten (Zellen altern auch durch Herumliegen und Nichtbenutzung)
Also wenn eBay dann bitte ganz genau in der Artikelbeschreibung lesen, woher die Zellen stammen, wie alt sie sind und darauf achten, wie die Rezensionen des Verkäufers ist.
Hinweis:
Auch bei fabrikneuen Zellen ist es so, dass die Werte leicht schwanken. Kapazität und Innenwiderstand sind hier nicht exakt gleich weswegen man auch beim Kauf von neuen Zellen diese nicht einfach so auf die Akkupacks aufteilen, sondern vorher trotzdem auch zumindest die Kapazität messen sollte.
2. Kaufen - gebraucht & getestet
Eine Alternative zum Kauf neuer Zellen ist es, gebrauchte / recycelte Zellen zu kaufen, die bereits auf ihren Zustand hin getestet wurden.

Preislich lohnt es sich hier manchmal (eher selten) von Privat zu kaufen auf eBay.de und eBay-Kleinanzeigen, wobei auf eBay.de mittlerweile der Handel mit losen 18650er Zellen verboten ist und es daher nur wenige Auktionen bei eBay.de gibt.
Bei eBay-Kleinanzeigen gibt es immer einige private Angebote. Meistens aber nur kleinere Mengen ( 20 - 50 Zellen) was einen nicht wirklich besonders viel weiter bringt.
Der Vorteil liegt sicher darin, dass man weiß, welche nutzbare Kapazität die Zellen noch haben. Das ist allemal sicherer, als ein Blindkauf von beispielsweise defekten Laptopakkus.
Allerdings sollte man auch hier vorsichtig sein, denn man weiß ja nie, in welchem Umfang, unter welchen Bedingungen, mit welchen Messgeräten und mit welcher Sorgfalt die Privatverkäufer die Zellen tatsächlich geprüft haben.
Gewerbliche Verkäufer die mit gebrauchten und getesteten Zellen handeln gibt es auch, aber nur zwei, die mir bekannt sind.
3. Laptopakkus
Eine gute Möglichkeit, eine Powerwall einerseits kostengünstig zu bauen und zudem auch Zellen weiter zu verwenden, die ansonsten recycelt werden würden sind gebrauchte / defekte Laptopakkus.
In 95% aller Laptopakkus sind 18650er LiIon Zellen verbaut (im Grunde sind nur in den ganz flachen Businessnotebooks manchmal flachere "Pouch"-Zellen verbaut).

Im Schnitt sind 6 Zellen in jedem Laptopakku verbaut. Manchmal auch 8, 9 oder 10, selten auch nur 4.
Laptopakkus kaufen
Man findet auf eBay.de und eBay-Kleinanzeigen unzähliche Angebote mit defekten Laptopakkus. Meist bis um 10 Stück zusammen, selten auch mal ein Konvolut mit 20 Stück.
Defekte Laptop-Akkus zusammen zu kaufen halte ich persönlich für absoluten Quatsch. Erstens sind diese Angebote in der Regel viel zu teuer (aufgrund der geringen Mengen und der daraus resultierenden hohen Portokosten im Verhältnis), zum anderen gibt es auch andere Wege um an Laptopakkus ran zu kommen, mehr dazu weiter unten.
Wenn Kauf dann sollte der Preis bei maximal 2€ pro Akku liegen, inkl. Versand etc. Alles darüber ist zu teuer und auch das ist schon viel. Wenn man damit rechnet, dass etwa 50% der verbauten Akkus benutzbar sind sind wir bei einem Preis von 2€ für 6 Zellen, davon 50% benutzbar = 67 Cent pro Zelle und damit kaum unter dem, was Energycells für bereits fertig geprüfte Akkus nimmt.
Laptopakkus kostenlos
Am besten mal Telefon zücken und / oder Mail aufsetzen und
- Computerhandlungen / PC-Service-Shops
- Verwandte & Bekannte, Nachbarschaft, Arbeitskollegen
- ggf. die IT-Abteilung auf der eigenen Arbeit
durchtelefonieren bzw. anschreiben, ob sie alte Laptopakkus zum Abgeben haben.
Stell Dich darauf ein, dass 1. die meisten absagen und 2. wenn zusagen dann nicht verschicken, Du sie also abholen musst.
Außerdem Wertstoffhöfe in Deiner erreichbaren Umgebung abklappern. Nicht anrufen, da bekommt man durchweg Absagen, sondern vorbeifahren, am besten wenn nicht so viel los ist, nett fragen. Hier das hatte ich mal woanders geschrieben:
Ich habe nun auch ein paar Mal bei defekten Laptop-Akkus auf eBay mit geboten, aber die Preise gehen (mir) schlussendlich zu hoch.
Letzte / Diese Woche habe ich insgesamt drei Wertstoffhöfe in meiner unmittelbaren Umgebung angefahren, durch das Zerlegen von Akkus fällt eh immer Zeugs zum Entsorgen an.
Wertstoffhof 1: die hüten alles, was Lithium hat wie einen Goldschatz. Die Fässer stehen direkt am Pförtnerhaus, Kameras, und ein Ordnungshüter. Da hab ich gar nicht erst gefragt.
WH 2: "Ach übrigens, habt ihr Laptopakkus, die ich haben könnte?" Mitarbeiter schaut sich verschwörerich um "Ja, komm am besten Morgen, heute hat es viele Augen. Ach was solls, park einfach da hinten, direkt vor den Fässern". Ergebnis: 35 Akkus für nen 10er in die Kasse, mit der Gewissheit, dass ich nächsten Monat wieder da hin kann und er mir bis dahin die anfallenden Akkus auf Seite legt.
WH3: "Ach übrigens, habt ihr Laptopakkus, die ich haben könnte?" "Keine Ahnung, und selbst wenn dann dürfe..." "Ach fast vergessen, ich hätte da noch was anderes zu entsorgen" (zückt 6er Trägerchen Bier). "Klar haben wir Laptop Akkus, da hinten stehen die Fässer, bedien Dich" Wieder rund 35 Akkus
WH4 in meiner Nähe steht noch aus, da schaue ich nächste Woche mal vorbei, wenn ich wieder genug Schrott zum Entsorgen zusammen habe.
Schlussendlich habe ich alle ein bis zwei Monate vier Wertstoffhöfe zum Abklappern und bei jedem gibt es immer rund 30 - 50 Akkus. Die Bezahlung ist gleich geblieben: 6er Pack Bier / 10€ in die Kasse / Fresspaket mit Süßkram & Chips für den, der weder Alk noch Geld annehmen will

Tipp:
es lohnt sich auch mal bissel Zeit für Recherche zu investieren, ob es in der Nähe einen Recyclinghof für Gewerbekunden gibt, also wo Firmen und Handelsketten ihren Elektroschrott abgeben. Wenn man dort Zugang bekommt kann man leicht 200 Laptopakkus pro Monat abholen. Hier auch auf jeden Fall persönlich vorbeifahren, wenn man anruft kommt man im Büro raus und das bringt nix, wenn dann muss man direkt mit den MA vor Ort schnacken.
Anleitung Laptopakkus zerlegen
Wie man Laptopakkus am besten öffnet und zerlegt findest Du hier als bebilderte Anleitung mitsamt Video
Hinweis:
Wieso ist das so schwierig, defekte Akkus aufzutreiben?
Ganz einfach, weil es gesetzlich nicht erlaubt ist. Nicht für Dich, der Akkus haben möchte, sondern die Batterieverordnung verbietet es Händler, Baumärkten, Wertstoffhöfe, Fahrradläden - egal wem - als defekt deklarierte Akkus irgendwem anders zu übergeben als einem zertifizierten Betrieb für Recycling. Das schließt auch den Versand mit ein, defekte AKkus dürfen nicht per Paket versendet werden.
Aus diesem Grund wird man im Internet auch keine Namen finden von Firmen, die doch mal ein paar Akkus rausgeben, damit diese keine negativen Folgen zu befürchten haben.
Ein wichtiger Punkt sollte daher auch sein, dass Du mit solchen Akkus auch verantwortungsvoll umgehst, sie nicht irgendwo hin in den Wald wirfst und die tatsächlich defekten Akkus wieder ordnungsgemäß zum Wertstoffhof bringst.
4. eBike-Akkus
Eine weitere Möglichkeit, gebrauchte Akkuzellen kostenlos zu erhalten sind aus eBike-Akkus

Drei Vorteile gegenüber Laptopakkus:
- pro eBike-Akkupack zwischen 40 und 60 Zellen auf einen Schlag
- die verbauten Zellen haben im Schnitt eine größere Kapazität als Laptopakkus
- oftmals sind nur ein oder zwei Zellen kaputt und der Rest noch in gutem Zustand, oder es ist sogar nur das BMS kaputt und alle Zellen sind noch gut
defekte eBike-Akkus kaufen:
Noch mehr als bei Laptopakkus ist ein Kauf allerdings viel zu teuer. Minimum 50€ eher 100€ wird für ein ungetestetes Akkupack auf eBay verlangt. Das entspricht einem Preis von bis zu 2€ je Zelle wobei hier auch die Möglichkeit besteht, dass das komplette Akkupack zerstört ist z.B. durch Wasserschaden, weil es schon sehr lange tiefenentladen gelagert wurde, oder die Zellen sind einfach durch Vielfahren ausgelutscht.
Daher würde ich eher vom Kauf defekter eBike-Akkupacks abraten.
alternativ:
Es lohnt sich auf jeden Fall, Fahrradläden in der näheren und auch weiteren Umgebung anzufragen, ob sie defekte Akkupacks haben und diese für ein Powerwall-Projekt hergeben würden.
Zwar ist es meiner Erfahrung nach noch schwerer, einen Laden zu finden der die Akkus auch bereit ist herzugeben (s. Batterieverordnung weiter oben) , allerdings wenn ein Bikeshop bereit dazu ist hat er in der Regel 10 oder mehr Akkus rumliegen, das sind schonmal Minimum 400 Zellen, eher mehr. So hat man mit einer einzigen Zusage und einem "Abholtermin" bereits die Hälfte der benötigten Zellen für eine 14s60p Powerwall mit rund 6 KWh zusammen.

Also: idealerweise die Fahrradläden in der Nähe abfahren und persönlich vorsprechen. Erklären, was man vor hat, ggf. Adresse / Namen als Sicherheit da lassen, versichern, dass man die Akkus nicht in den Wald wirft o.ä.
Zusätzlich Fahrradläden in der weiteren Umgebung abtelefonieren oder Mail schicken, so kann man auch sein geplantes Projekt kurz beschreiben, ggf. mit zwei, drei Bildern dazu.
Und gerade zu Corona-Zeiten fahren viele Leute enorm viel Fahrrad und kaufen sich auch neue eBikes, entsprechend hoch ist aktuell das Aufkommen defekter Akkus. Es lohnt sich also, einen guten Fahrradladen-Kontakt auch aufreht zu halten, mit ziemlicher Sicherheit kannst Du dann nach ein paar Monaten nochmal hinfahren und weitere defekte Akkus abholen.
Hier mal ein paar eBike-Akku-Eindrücke von meinem Projekt:

- KW16 - Solarakku - der Anfang
- KW17 - Solarakku - 18650 Zellen sammeln1
- KW18 - Solarakku - 18650 Zellen sammeln2
- KW19 - Solarakku & Fundament
- KW20 - Zellen sammeln fertig & Fundament
Anleitung eBike-Akku zerlegen
Hier findest Du noch eine bebilderte Anleitung zum Zerlegen von eBike-Akkus und zwar für über 20 verschiedene Modelle

eBike Akkus halb-zerlegt kaufen
Ich kenne eine einzige halbwegs preiswerte Quelle um gebrauchte / defekte eBike-Akkus zu kaufen, und zwar beim Akku-Repairservice DEA - Deutscher eBike Akkuservice
Das ist eine Firma, die ausgelutschte eBikeakkus wieder fit machen. Die ausgebauten Packs sind daher in der Regel eher so mittelprächtig von der Kapazität her und keine wo nur das BMS defekt, die Zellen aber noch super Kapazitäten haben, dafür bekommt man dort auch keine defekten / verrosteten / Kurzschlusszellen.
Die verkaufen entweder als 100er Pack zu 25€ oder mittlerweile eher sogar nur noch als 400er Pack für 100€
Über deren Shop und dann unter "Gebrauchtgeräte"
https://shop.deutscher-akkuservice.de/Gebrauchtgeraete/
Wenn dort keine Akkuzelllen eingestellt sind haben die gerade keine zu verkaufen. Die sammeln immer eine gewisse Menge bis es sich für rentiert, also muss man öfter mal rein schauen - und dann schnell sein.
So sieht dann eine Lieferung aus. Gemischt aus teilzerlegten eBikeakkus, teilweise auch schon fertig zerlegte Einzelzellen.
Umgerechnet 25 Cent / Zelle ist ein guter Preis dafür, dass man keine defekten dabei hat, wenn man mit Kapazitäten mit im Schnitt um 2.000 - 2.200mAh einverstanden ist.

Das waren sie, meine Informationen zu den Quellen rund um Akkuzellen.
Wenn man ein bisschen Zeit investiert und bereit dazu ist, ein paar Kilometer zu fahren dann hat man gute Chancen, sehr viele gute Akkuzellen vor der Schrottpresse zu retten und sich damit eine kostengünstige DIY 18650 Powerwall zu bauen.
Ohne Aufwand geht das leider nicht, es seidenn man ist bereit, die Zellen alle zu kaufen und dementsprechend sehr viel Geld auszugeben.
5. mehr Tipps
Falls Du noch mehr Infos brauchst, wo und wie man an gebrauchte / defekte Akkus kommt lies Dir diese beiden Threads in diesem deutschsprachigen Forum mit netter, kleiner Community aufmerksam durch - und beteilige Dich daran.
Inhaltsverzeichnis:
- 1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)
- 2 Idee + Plan
- 3 Akku-Arbeitsplatz
- 4 eBike Akku Komponenten
- 5 eBike Akku zerlegen
- 6 Laptop Akkus zerlegen
- 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte
- 8 neue Hülle für 18650
- 9 China-Akkutest
- 10 Werkzeuge + Messgeräte
- 11 Null-Watt Einspeisung
- 12 Modbus / RS485 Adapter
- 13 BMS + Balancer
- 14 aktiv Balancer BMS - JKBMS
- 15 Ladegeräte + Kapazitätstester
- 16 kpl. Akkupacks testen
- 17 Innenwiderstand Ri
- 18 Solar Laderegler
- 19 Wechselrichter, Inverter
- 20 Löten - Anleitung für Akkus
- 21 Schlüsselanhänger aus 18650
- 22 Sicherheitskonzept
- 23 Akkus Beschaffung - wie und wo?
- 24 WVC / SG / GMI / PVGS Mikroinverter
- 25 Schritt-für-Schritt zur 18650 Powerwall
- 26 ATS - Automatic Transfer Switch
- 27 Schottky Sperrdioden für Parallelschaltung
- 28 Balkonsolar & Balkonkraftwerk
- 29 Hybrid Wechselrichter einrichten
24 WVC / SG / GMI /PVGS Mikroinverter
Die hier beschriebenen Wechselrichter sind allesamt reine Netzwechselrichter / Einspeisewechselrichter / Grid Tie inverter / Modulwechselrichter - was alles das Geiche meint: ein Wechselrichter, der aus PV-Gleichspannung eine 230V Wechselspannung erzeugt und direkt in ein bestehendes Hausnetz einspeist, ohne die Möglichkeit einer Notstromversorgung oder Inselbetrieb.
Inhaltsverzeichnis:
1. WVC / SG Mikrowechselrichter
2. GMI Serie Grid Tie Micro Inverter
1. WVC / SG Mikrowechselrichter
Inhaltsverzeichnis:
1. WVC / SG Mikrowechselrichter
1.1 Kurzübersicht
1.2 Modelle
1.3 Zulassung
1.4 Händlerempfehlungen
1.5 Optimierungs-Modifikationen
1.5.1. Kühlkörper
1.5.2 Kondensatoren
1.6 Data-Box & Software
1.7 Downloads
1.8 mehr Infos
2. GMI Serie Grid Tie Micro Inverter
Eine sehr preisgünstige Variante für Grid tie inverter und Modulwechselrichter sind die Mikroinverter der WVC bzw. der SG Serie.
Hier auf dem Bild ein SG-Modell mit nur einem PV-Eingang (200 - 350W)

1.1 Kurzübersicht
Inhaltsverzeichnis:
1. WVC / SG Mikrowechselrichter
1.1 Kurzübersicht
1.2 Modelle
1.3 Zulassung
1.4 Händlerempfehlungen
1.5 Optimierungs-Modifikationen
1.5.1. Kühlkörper
1.5.2 Kondensatoren
1.6 Data-Box & Software
1.7 Downloads
1.8 mehr Infos
2. GMI Serie Grid Tie Micro Inverter
Die Geräte stammen alle aus China und es gibt keinen originären Hersteller, die Modelle werden von mehreren Fabriken gebaut, mit identischem Aufbau, nahezu identischen Preisen und dann direkt vertrieben. Ab und zu kommen auch neue Modelle hinzu, auch Weiterentwicklungen finden noch statt.
So ist die WVC-Serie die Grundserie, während die SG-Serie darauf aufbaut und nur minimale Verbesserungen gegenüber der WVC-Serie hat
- die WVC-Serie gibt es in verschiedenen Modellen von 300W bis 2.800W zu Preisen von 80€ - 250€ -> WVC 600+700 / WVC 1200+1400 auf Aliexpress
- die SG-Serie gibt es zwischen 200W und 1.400W zu Preisen zwischen 80€ und 250€ -> SG 700-1400 auf Aliexpress
Beim SG sind Schwachpunkte überarbeitet. Beispiel sind die MC4 Anschlüsse lose (Sie sind nun Wasserfest und können nicht abbrechen).Das Gehäuse ist besser gegen Nässe geschützt. Das Layout entspricht der neuesten Generation der WVC´s. Wobei ein SG 1000, ein 1200 und 1400 die gleichen Grundplatinen enthält. Nur die Powermosfett wurden ja nach Leistung besser gewählt.
Quelle: User "Carwie" @ photovoltaikforum.com
hier eines der Top-Modelle mit vier PV-EIngängen (1.000 - 1.400W)
Bei der SG-Serie gibt es auch eine optionale Drahtlosverbindung zum Monitoring der Inverter mittels PC-Software, wofür man allerdings die separate Databox benötigt für um 50€
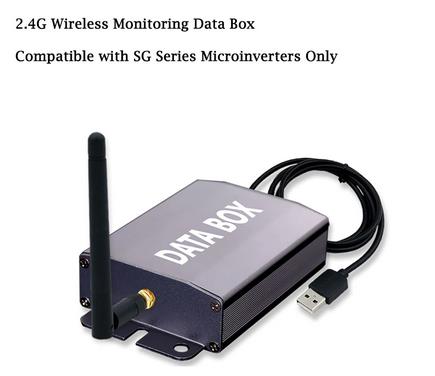
Data Box erhältlich auf:
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
Die verbindet sich per 2,4G zu den Invertern (eine Databox kann mehrere Inverter bedienen) und man muss sich dann per PC und USB mit der Databox verbinden, um diese per Software auszulesen,
das sieht dann so aus:

Praktisch: Kaskadierbarkeit
Bei den WVC wie auch den SG Modellen gibt es einen AC Ein- sowie einen Ausgang, sodass man mehrere Wechselrichter hintereinander schalten kann und bloss den ersten oder letzten Wechselrichter in der Reihe dann am Ende an das Stromnetz anschließen braucht.

Leider sind diese Stecker dann auch der Haupotgrund für die fehlende Zulassung der Mikro Wechselrichter in Deutschland, s. Punkt weiter unten "3.) Zulassung"
1.2 Modelle
Inhaltsverzeichnis:
1. WVC / SG Mikrowechselrichter
1.1 Kurzübersicht
1.2 Modelle
1.3 Zulassung
1.4 Händlerempfehlungen
1.5 Optimierungs-Modifikationen
1.5.1. Kühlkörper
1.5.2 Kondensatoren
1.6 Data-Box & Software
1.7 Downloads
1.8 mehr Infos
2. GMI Serie Grid Tie Micro Inverter
Bei der SG-Serie gibt es folgende Modelle:
- 200W
- 250W
- 300W
- 350W
- 400W
- 450W
- 500W
- 600W
- 700W
- 1000W
- 1200W
- 1400W
Wobei ein 1400W Modell (4x PV-Eingang) aus zwei 700W Modulen besteht, ebenso besteht ein 1200er aus zwei 600ern.
Hier das ist das Innere eines WVC 1200
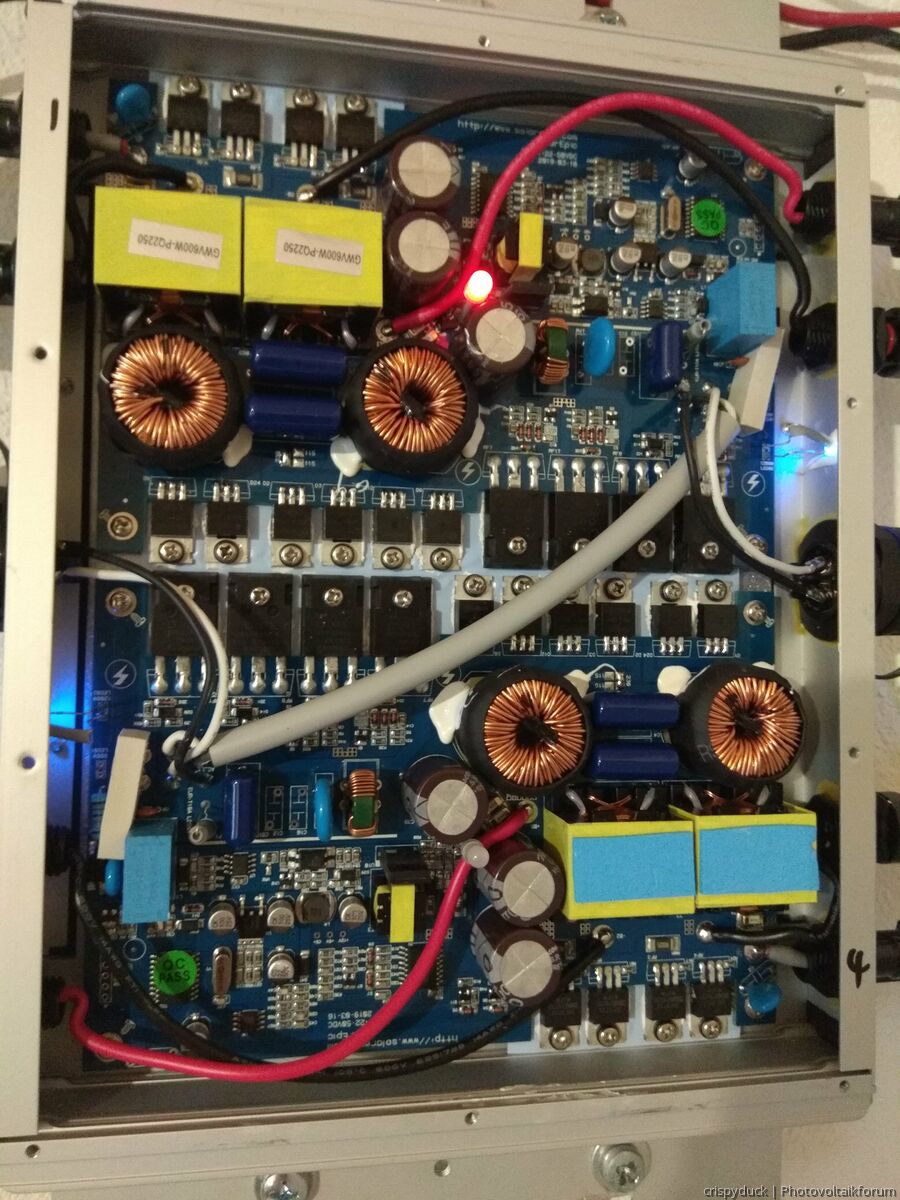
Bild: crispyduck @ PV-Forum
wobei es hier auch unterschiedliche Revisionen gibt, hier das ist auch ein WVC 1200

Bild: oOo @ PV-Forum
Hier das ist ein WVC 700

Bild: prekwos @PV-Forum
1.3 Zulassung
Inhaltsverzeichnis:
1. WVC / SG Mikrowechselrichter
1.1 Kurzübersicht
1.2 Modelle
1.3 Zulassung
1.4 Händlerempfehlungen
1.5 Optimierungs-Modifikationen
1.5.1. Kühlkörper
1.5.2 Kondensatoren
1.6 Data-Box & Software
1.7 Downloads
1.8 mehr Infos
2. GMI Serie Grid Tie Micro Inverter
Die Wechselrichter der WVC sowie der SG-Serie haben in Deutschland keine Zulassung, d.h. sie können weder als Balkonkraftwerk noch sonstwie offiziell angemeldet werden.
Dagegen sprechen hauptsächlich die beideitigen 230V-Anschlüsse, die zwar rundherum sehr gut isoliert sind, deren Pole man aber ungeschützt anfassen kann und dann dementsprechend einen Schlag bekommt, falls man das tut.
Zum anderen sind die Wechselrichter zwar angeblich IP65 wassergeschützt, aber das stimmt nicht, die sind allenfalls feuchtigkeitsgeschützt. Regen und Spritzwasser halten sie definitiv nicht aus also unbedingt so installieren, dass sie von Regen und Spritzwasser geschützt sind.
Anonsten arbeiten die Wechselrichter sehr gut und auch zuverlässig, tun dasselbe wie SMA und andere Modulwechselrichter und teilweise sogar mehr (WLan, Kaskadierbarkeit), nur eben zum halben Preis.
1.4 Händlerempfehlungen
Inhaltsverzeichnis:
1. WVC / SG Mikrowechselrichter
1.1 Kurzübersicht
1.2 Modelle
1.3 Zulassung
1.4 Händlerempfehlungen
1.5 Optimierungs-Modifikationen
1.5.1. Kühlkörper
1.5.2 Kondensatoren
1.6 Data-Box & Software
1.7 Downloads
1.8 mehr Infos
2. GMI Serie Grid Tie Micro Inverter
Die Mikrowechselrichter kann man zwar auch über eBay und Amazon kaufen, aber wie bei fast allen Elektroniksachen rund um den Photovoltaik- und Akku DIY-Bereich ist der Kauf über Aliexpress fast immer günstiger.
Da es bei ALiexpress einige schwarze Schafe gibt hier mal ein paar Händler, mit denen ich in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht habe.
Achtung: das ist keine Garantie, dass es bei jeder Bestellung gut läuft, aber zumindest bei mir hat alles gut geklappt, teilweise auch mehrfach
- Vesdas Store: die WVC-Serie gibt es in verschiedenen Modellen von 300W bis 2.800W zu Preisen von 80€ - 250€ -> WVC 600+700 oder WVC 1200+1400 auf Aliexpress
- Vesdas Store: die SG-Serie gibt es zwischen 200W und 1.400W zu Preisen zwischen 80€ und 250€ -> SG 700-1400 auf Aliexpress
- Jesudom Solar Store -> alles rund um Wechselrichter, sehr zuverlässig bei rund 10 unabhängigen Bestellungen bisher. Gute Kommunikation, per Kontaktformular bekommt man auch Fragen schnell geklärt und Handbücher zugeschickt. Bisher noch kein Reklamationsfall gehabt
- IC Gogogo -> alles rund um BMS, Balancer, Elektronik-Kleinbauteile. Ebenfalls gute Kommunikation mit fachlichen ANtworten bei technischen Fragen sowie Handbücher und Datenblätter per Mail. Bisher noch kein Reklamationsfall gehabt
Reklamationsfall:
- D.YU.K.B store bzw. auch als Dykbhuang Store -> nach dem Kauf von 7 Stück BMS (Einzelpreis um 60€) sehr unbefriedigende Reklamationsabwicklung zweier defekter BMS. Man muss die defekte Ware auf eigene Kosten zurück nach China schicken, kein ENtgegenkommen des Händlers, keine gute Kommunikation -> nicht zu empfehlen
1.5 Optimierungs-Modifikationen
Inhaltsverzeichnis:
1. WVC / SG Mikrowechselrichter
1.1 Kurzübersicht
1.2 Modelle
1.3 Zulassung
1.4 Händlerempfehlungen
1.5 Optimierungs-Modifikationen
1.5.1. Kühlkörper
1.5.2 Kondensatoren
1.6 Data-Box & Software
1.7 Downloads
1.8 mehr Infos
2. GMI Serie Grid Tie Micro Inverter
Bei den WVC sowie auch bei den SG Modellen kann bzw. je nach Gegebenheiten vor Ort sollte man zwei Modifikationen durchführen.
- Kühlkörper -> Verbesserung der Kühlung
- Kondensatoren -> Verbesserung bei Verschattung
Hier ein Übersichtsschema der beiden Modifikationen
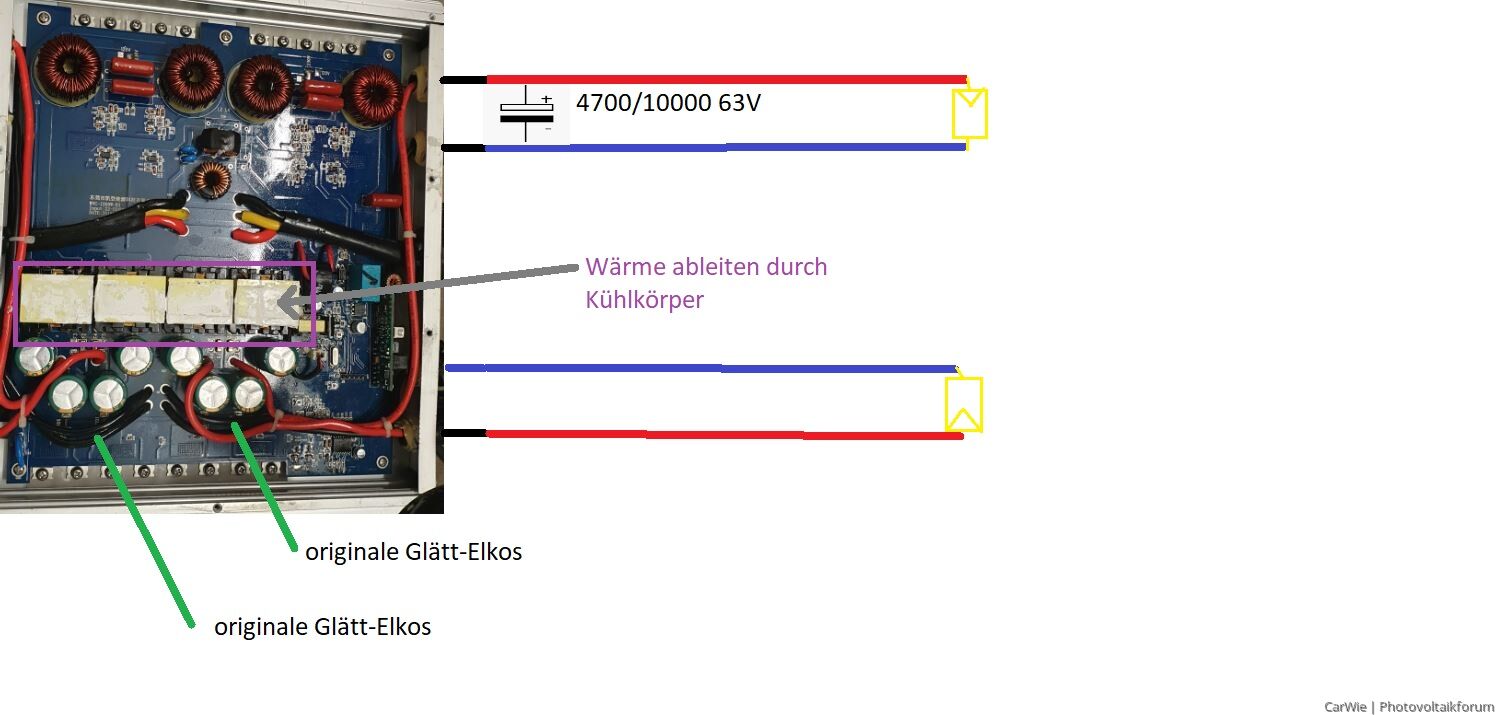
Bild: CarWie @ PV-Forum
1.5.1. Kühlkörper
Inhaltsverzeichnis:
1. WVC / SG Mikrowechselrichter
1.1 Kurzübersicht
1.2 Modelle
1.3 Zulassung
1.4 Händlerempfehlungen
1.5 Optimierungs-Modifikationen
1.5.1. Kühlkörper
1.5.2 Kondensatoren
1.6 Data-Box & Software
1.7 Downloads
1.8 mehr Infos
2. GMI Serie Grid Tie Micro Inverter
Die Mikrowechselrichter sind passiv gekühlt, kommen also ohne Lüfter daher. Das ist einerseits gut, weil sie dadurch geräuschlos sind - zudem kann dann auch kein Lüfter kaputt gehen.
Schlecht ist das jedoch, wenn der Wechselrichter oft auf Anschlag läuft oder / und an einem warmen Ort (Dachboden, direkte Sonneneinstrahlung, südliches Klima) installiert wird.
Hier empfiehlt es sich, zusätzliche Kühlkörper zu montieren, um die Abwärme besser abtransportieren zu können.

die unbehandelte Aluseite des Micro Inverters gibt die meiste Wärme ab, also sollte hier ein zusätzlicher Kühlkörper angebracht werden. Zuerst alle Aufkleber abfummeln und gründlich reinigen.

Achtung: den Aufkleber auf der schmalen Kante (der mit dem Strichcode) auf keinen Fall abfummeln, dort ist die ID des Micro Inverters aufgedruckt die man zwingend benötigt, um eine WLan-Verbindung zur Data Box herstellen zu können. Ohne diese ID ist eine Verbindung nicht möglich.
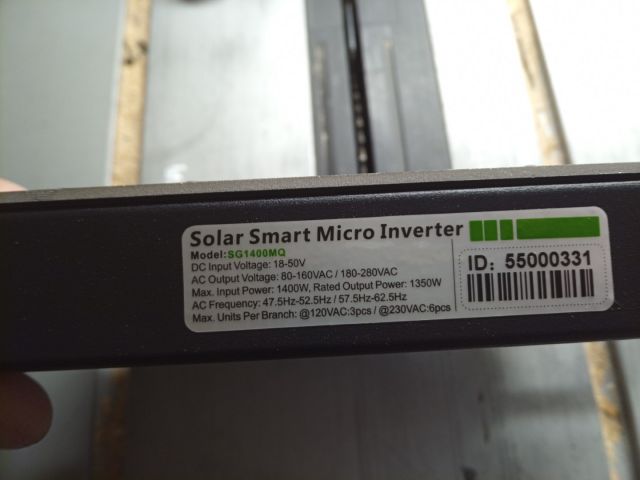
als Kühlkörper empfiehlt sich einer mit möglichst großer Fläche und groben Kühlrippen, damit er passiv funktioniert (feine, enge Kühlrippen wie bei einem CPU-Lüfter am PC eignen sich nur in Verbindung mit einem Lüfter).
Ich selbst nutze hier Aluminium Kühlkörper in den Maßen 90x90x15mm
Die gibt es recht preiswert entweder
Hier am Beispiel des SG700 musste ich ein Loch in den Kühlkörper bohren, da er ansonsten auf einer der Schrauben aufgelegen hätte

wie nun befestigen?
Entweder komplett mit Wärmeleitkleber oder, so habe ich es gemacht, mit einer Kombination aus Wärmeleitkleber und Wärmeleitpaste
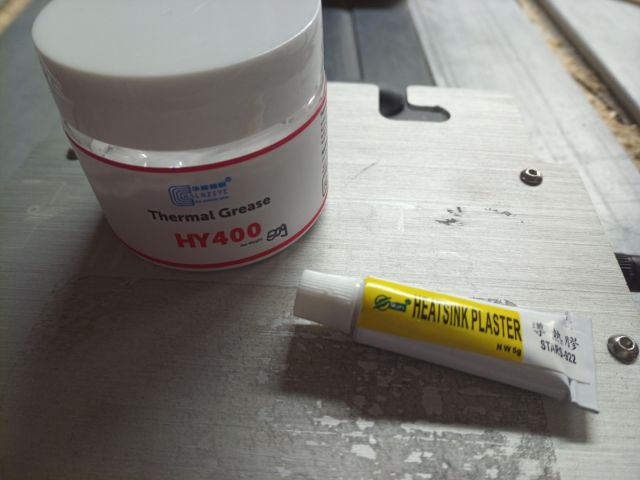
da Wärmeleitpaste sehr billig ist, Wärmeleitkleber aber sehr teuer habe ich nur fünf Kleckse des Klebers auf den Kühlkörper aufgetragen und...
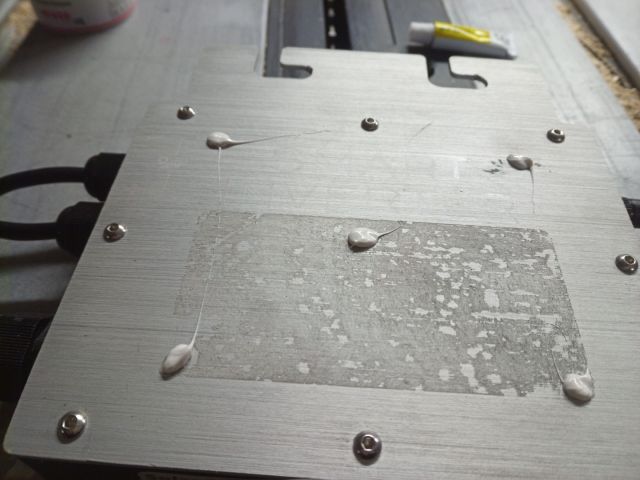
den Rest der Fläche dann mit Wärmeleitpaste bestrichen

Kühlkörper von Hand anpressen
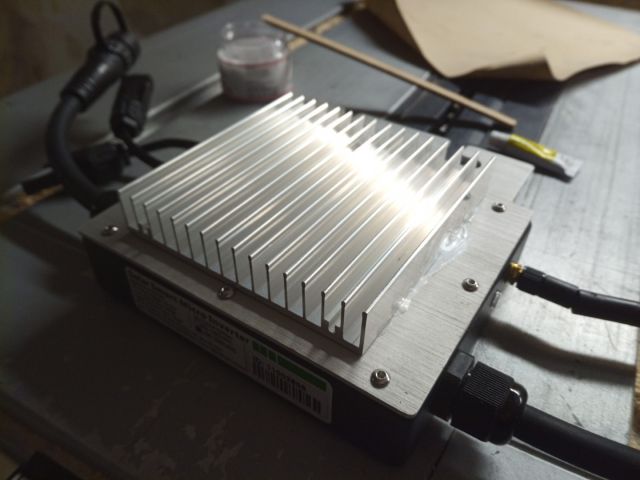
idealerweise auf der anderen Seite des Gehäuses dasselbe nochmal.
Achtung:
darauf achten, wie rum Du den Wechselrichter nachher montieren willst. Idealerweise senkrecht an der Wand hängend und dann so, dass die Kühlrippen ebenfalls senkrecht stehen, damit sie mittels Kamineffekt die Abwärme auch gut an die Umgebungsluft abgeben können. Das musst Du Dir also vorher schon überlegen, bevor Du die Kühlkörper anklebst

in meinem Fall sind dann später die Kabel seitlich links und rechts, die Kühlrippen stehen also senkrecht und können so die Wärme optimal abgeben

damit das Ganze auch hält die beiden Kühlkörper mittels Schraubzwingen über Nacht oder besser für 24 Stunden zusammenpressen.
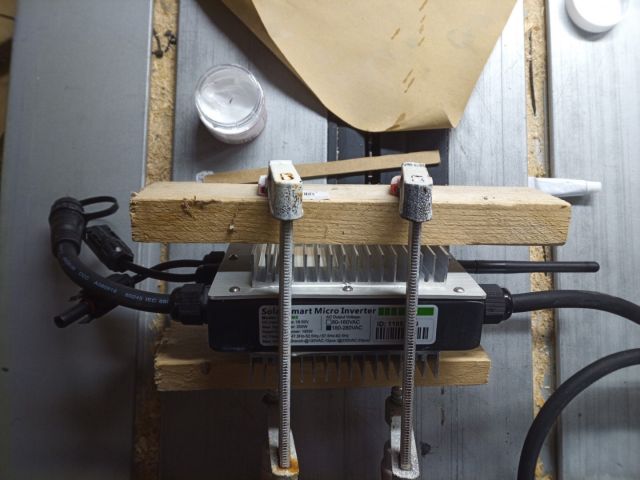
Brettchen unterlegen, damit die Kühlrippen nicht verbogen werden

beim großen SG 1400 dasselbe Spiel
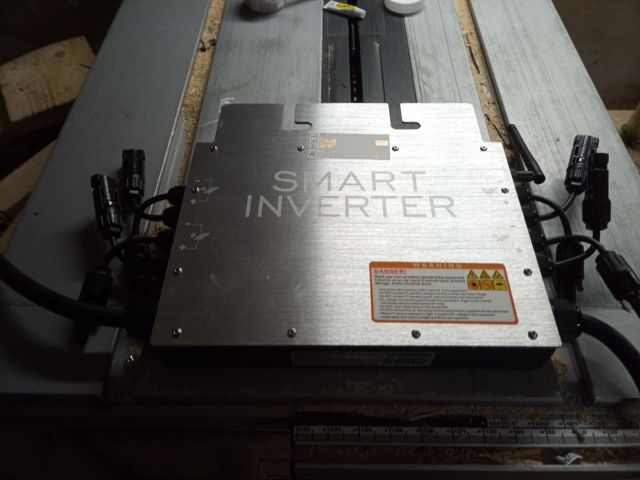
da der SG1400 im Grunde zwei SG700 in einem großen Gehäuse ist benötigt man auch dementsprechend vier Kühlkörper

wie bereits beschrieben mittels Wärmeleitkleber + Wärmeleitpaste anbringen. Auf jeden Fall auf der Aluseite des Gehäuses...

...und idealerweise auf der Rückseite ebenfalls


unbedingt mit Schraubzwingen anpressen, nur von Hand oder mit ein bisschen Gewicht a la 5 Bücher drauflegen wird das auf Dauer nicht halten.
Zudem wird es keinen guten Kontakt zwischen Kühlkörper und Gehäuse geben und dadurch wird auch kein guter Wärmetransport möglich sein.

CPU-Kühler am PC sind auch angepresst und nicht bloss halbherzig draufgedrückt

Montage:
Durch die Kühlkörper haben wir ggf. erstmal Schwierigkeiten, den Wechselrichter zu montieren, da nun der Abstand zwischen den Montagelaschen und der Wand zu groß ist.
Aber das ist kein Problem, hier brauchen wir nur einen Abstandshalter. Hierzu habe ich ein Stück 60x40mm Vierkantholt genommen

idealerweise hätte ich den Wechselrichter "auf dem Kopf stehend" montiert, also um 180° gedreht, sodass das Holzstückchen unten ist und die warme Luft besser nach oben weg kann, aber hier hatte ich zu spät daran gedacht und die Verkabelung drumherum bereits so gelegt, dass ich den WR nicht mehr drehen konnte.
Beachte das bei der Montage also auch.

beim SG700 ist bei 60mm Abstand noch ausreichend Platz zur dahinterliegenden Wand

der SG1400 sitzt dann press auf

fertig. So werden die Wechselrichter auch im Sommer und bei hoher Belastung zur Mittagszeit besser gekühlt

Achtung:
trotzdem brauchen die Wechselrichter auch weiterhin Frischluft für eine ausreichende Kühlung, also bitte auf keinen Fall in eine geschlossene Box / Kiste stecken, oder einen kleinen Gartenschuppen, der in der Sonne steht und sich aufheizt sondern immer dafür sorgen, dass auch Frischluft ran kann

1.5.2 Kondensatoren
Inhaltsverzeichnis:
1. WVC / SG Mikrowechselrichter
1.1 Kurzübersicht
1.2 Modelle
1.3 Zulassung
1.4 Händlerempfehlungen
1.5 Optimierungs-Modifikationen
1.5.1. Kühlkörper
1.5.2 Kondensatoren
1.6 Data-Box & Software
1.7 Downloads
1.8 mehr Infos
2. GMI Serie Grid Tie Micro Inverter
Die WVC und SG Mikro Wechselrichter haben ein Problem bei Verschattung.
Zwar besitzen sie einen guten MPPT Tracker, der permanent den optimalen Leistungspunkt der angeschlossenen PV Panels sucht und das tun sie auch bei Verschattung z.B. durch Wolken,
allerdings ist der MPPT-Tracker sehr langsam, sodass auch bei einer kleinen Schäfchenwolke die Leistung erstmal komplett einbricht und auch wenn die Wolke schon weg ist rund zwei Minuten braucht um sich wieder "zu erholen".
Das ist erstmal nicht besonders schlimm und wohl dem Gesamtpreis der Wechselrichter geschuldet, teurere Modelle arbeiten an dieser Stelle einfach schneller.
Aber es gibt eine Möglichkeit, diesem Effekt bei kurzen Verschattungen entgegen zu wirken, und zwar indem man einen Kondensator am PV-Eingang parallel anschließt.
Effekt:
Bei einer Wolke sinkt die Spannung vom PV-Modul, der MPPT-Tracker würde hier erstmal auf 0 Watt schalten und einen neuen Leistungspunkt suchen. Aber: bei einem parallel geschalteten Kondensator puffert dieser nun den Spannungsabfall am PV-Eingang ab und der langsame MPPT-Tracker bekommt von der Schäfchenwolke quasi gar nichts mit, arbeitet also mit voller Leistung ganz normal weiter.
Hierzu benötigen wir:
Einen Elektrolytkondensator mit mind. 10.000yF und mind. 50V (besser 63V) sowie zwei MC4 Y-Kabel und zwar je Eingang

Die Kondensatoren kosten um 4€ pro Stück und gibt es auch etwas preiswerter im 5er Pack

Natürlich passen auch Modelle mit 100V und größerer Kapazität z.B. 15.000yF und sie müssen auch nicht speziell für Audiozweck sein
zuerst die beiden Füßchen des Kondensators mit Lötdraht vorverzinnen

dann am Y-Kabel einer der beiden Stecker abschneiden, abisolieren und ebenfalls vorverzinnen

Schrumpfschlauch über das Kabel drüberstülpen und danach festlöten

dabei unbedingt auf die richtige Polung achten, so wie hier im Bild muss das dann aussehen.
Seitlich am Kondensator ist der Minuspol gekennzeichnet, hier mit einem goldenen Streifen, in dem lauter Minuszeichen drin sind. Oft ist das Ganze auch in Silber oder Weiß gehalten.
In meinem Fall kommt der rechte Teil an den Wechselrichter dran und der linke Teil an die PV-Module

falls Du keinen farbig passenden Schrumpfschlauch zur Hand hast dann markier Dir die Kabelenden irgendwie mit farbigem Klebeband o.ä. passend, damit Du diesen Adapter später nicht falsch herum einbaust und der Kondensator damit verpolt ist und platzt


die beiden Kabelenden am Kondensator kann man noch mit zwei Kabelbindern fixieren, damit die Füßchen nicht abgeknickt werden während der Montage der Kabelstrippen

Halterung:
damit die Kondensatoren später nicht blöd rumbaumeln habe ich mir eine ganz einfache Halterung beuat, aus einem Brett-Abfallstückchen
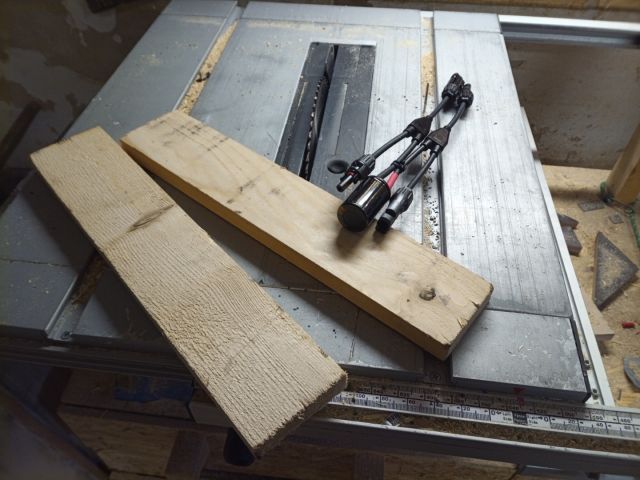
die 10.000yF Kondensatoren haben genau 30mm Durchmesser. Also habe ich mit einem 30mm Forstnerbohrer (ein Set kostet unter 15€ auf eBay, in jedem Baumarkt) passend dazu ein Loch in das Brett gebohrt



passt genau rein, ohne dass der Kondensator wieder von alleine rausfällt

mittels Winkelchen seitlich montiert

Tadaa



Fertig 😀
Hier geht es übrigens zu dem Beitrag mit dem kompletten Umbau der Wechselrichter und der Installation der Photovoltaikanlage -> 2021 - KW11 - PV Holzunterstand klein
1.6 Data-Box & Software
Inhaltsverzeichnis:
1. WVC / SG Mikrowechselrichter
1.1 Kurzübersicht
1.2 Modelle
1.3 Zulassung
1.4 Händlerempfehlungen
1.5 Optimierungs-Modifikationen
1.5.1. Kühlkörper
1.5.2 Kondensatoren
1.6 Data-Box & Software
1.7 Downloads
1.8 mehr Infos
2. GMI Serie Grid Tie Micro Inverter
Die neueren Modelle der WVC und SG Serie haben beide eine wireless Verbindung integriert. Allerdings kann man nicht direkt per WLan darauf zugreifen sondern benötigt immer ein zusätzliches Gerät..
Beim WVC ist das das "WVC Modem", bei der SG Serie heißt das dann "Data Box".
Die Geräte sind untereinander nicht kompatibel, d.h. mit dem WVC Modem kann man nicht auf die SG-Serie zugreifen und umgekehrt.
Für die WVC Micro Inverter gibt es sogar zwei unterschiedliche Modems.
WVC Modem 433MHz + RS232

Dieses Gerät kommuniziert mittels 433MHz Funktechnik mit einem oder mehreren WVC Wechselrichtern, man muss es dann mittels einem Cmm-Kabel / RS232 Schnittstelle an einen PC anschließen um darauf zu zugreifen.
Manchmal hat dieses Modem auch noch eine Antenne hinten angeschraubt.
Charakteristisch für das RS232 Modem ist die aufgedruckte Bezeichnung "TXD" und "RXD"
Das Gerät kostet rund 70€ auf
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
WVC Modem 433MHz +Wifi
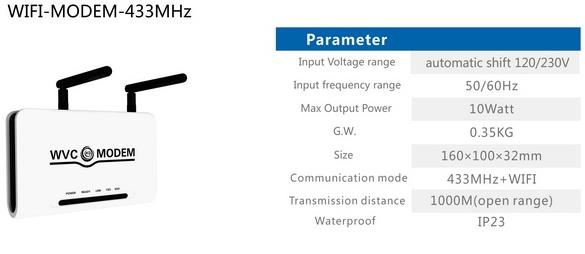
Die zweite Variante kommuniziert ebenfalls mit 433MHz mit einem oder mehreren Wechselrichtern, aber anstatt der RS232 Schnittstelle hat es Wifi, also WLan integriert und man kann direkt per Laptop darauf zugreifen
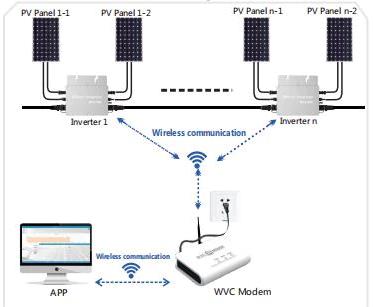
Dieses Gerät kostet um 90€
SG-Serie Data Box
Bei den SG-Wechselrichtern benötigt man zwingend die sog. Data Box
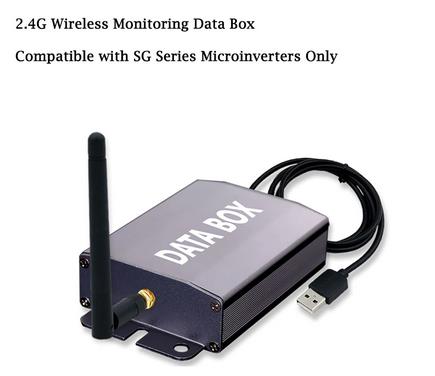
Ähnlich wie bei den WVC kommuniziert die Data Box mit einem oder mehreren Wechselrichtern mittels 433MHz. Die Box selbst wird dann per USB an einen PC angeschlossen um Zugriff darauf zu haben.
Die SG-Serie Data Box kostet um 40€
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
Im Innern sieht die Data Box übrigens so aus:
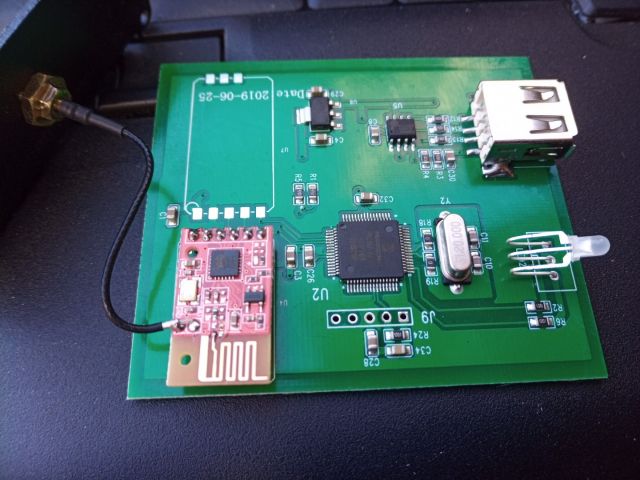
SG-Serie Wechselrichter mit Data Box & Software verbinden
Vorab: man benötigt im Grunde weder Data Box noch Software zum Betrieb der Wechselrichter. Die Software erlaubt es nur, verschiedene Werte anzeigen zu lassen.
Es ist eine reine Monitoring Software, d.h. man kann auch nichts an den Wechselrichtern verändern.
Ein großes Manko ist zudem, dass es lediglich eine Echtzeitausgabe gibt, d.h. man kann nur die Daten einsehen, seitdem die Software gestartet wurde, nicht aber Daten aus der Vergangenheit. Möchte man also eine Langzeitaufzeichnung z.B. für statistische Auswertung oder einen Verlauf des Ertrags sehen, muss man permanent einen PC mit der Software laufen haben.
Zum Betrieb brauchst Du dann:
- USB-Treiber
- Monitoring Software
Beides findest Du zum Downloaden auch im nächsten Kapitel weiter unten.
- USB Treiber installieren
- Data Box mit USB Kabel mit dem PC verbinden
- etwas warten, nun sollte die Data Box erkannt und automatisch installiert werden
- die Monitoring Software "NETMS 6.2" installieren und starten
Der Startbildschirm sieht dann immer so aus:

nun im Menü oben auf "Stations" klicken.
In diesem Tab muss man nun zuerst manuel den / die Wechselrichter eintragen, damit sie von der Software gefunden werden.
Dazu rechts oben im Feld "New Inverter" bei "Inv. ID" nun die Nummer eintragen, die...
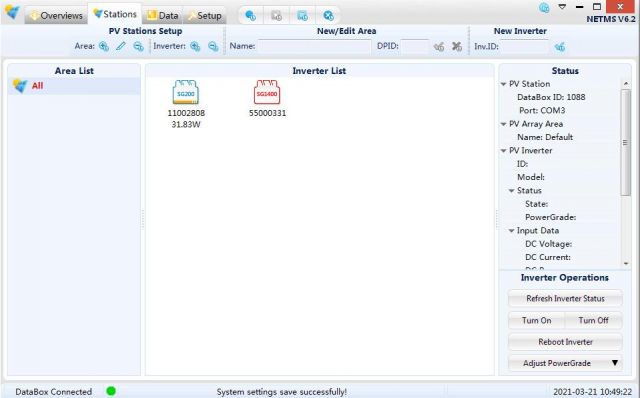
...am Wechselrichter auf dem Aufkleber steht, hier im Beispiel also die 55000331
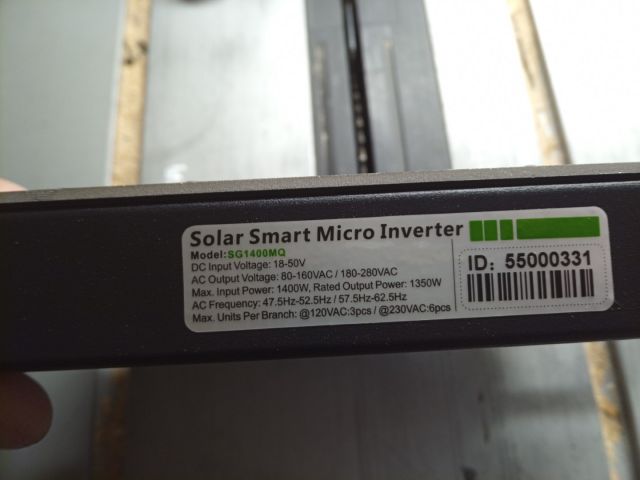
dann speichern und es sollte der Wechselrichter gefunden werden. Das war's.
Bei mehreren Wechselrichtern dann nochmal genau dasselbe Vorgehen.
1.7 Downloads
Inhaltsverzeichnis:
1. WVC / SG Mikrowechselrichter
1.1 Kurzübersicht
1.2 Modelle
1.3 Zulassung
1.4 Händlerempfehlungen
1.5 Optimierungs-Modifikationen
1.5.1. Kühlkörper
1.5.2 Kondensatoren
1.6 Data-Box & Software
1.7 Downloads
1.8 mehr Infos
2. GMI Serie Grid Tie Micro Inverter
Handbücher:
{phocadownload view=file|id=38|target=b}
{phocadownload view=file|id=37|target=b}
{phocadownload view=file|id=39|target=b}
{phocadownload view=file|id=47|target=b}
Software & Treiber für Databox:
{phocadownload view=file|id=36|target=b}
|
Du findest unsere Beiträge hilfreich und möchtest uns unterstützen?  Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten und zwar ganz ohne, dass es Dich etwas kostet (hier klicken) |
1.8 mehr Infos
Inhaltsverzeichnis:
1. WVC / SG Mikrowechselrichter
1.1 Kurzübersicht
1.2 Modelle
1.3 Zulassung
1.4 Händlerempfehlungen
1.5 Optimierungs-Modifikationen
1.5.1. Kühlkörper
1.5.2 Kondensatoren
1.6 Data-Box & Software
1.7 Downloads
1.8 mehr Infos
2. GMI Serie Grid Tie Micro Inverter
Hier noch ein paar Diskussionsthreads im Photovoltaik-Forum zu den WVC und SG Mikrowechselrichtern
Nachtrag vom 23.10.2021:
Youtuber VoltAmpereLux hat in einem Video uA einen SG 600 und einen GMI 300 auf die Stromqualutät hin überprüft und die Sinuskurve gemessen, sehr aufschlussreich
2. GMI Serie Grid Tie Micro Inverter
Inhaltsverzeichnis:
1. WVC / SG Mikrowechselrichter
2. GMI Serie Grid Tie Micro Inverter
2.1 Modelle
2.2 Preise
2.3 technische Daten & Ausstattung
2.4 Handbuch / Datenblatt
2.5 Wasserdicht
2.6 Überhitzung
2.6.1 Nachtrag: erste Erfahrungen im laufenden Betrieb
2.6.2 mein Fazit zur Temperatur
2.7 Erfahrungsberichte / Tests
2.7.1 großer Test mit 4 unterschiedlichen GMI
2.7.2 weitere Tests
2.8 GMI 500 / 600 / 700
2.8.1 passiver Aluminium-Kühlkörper anbringen
2.8.2 Lüfter, DC-DC-Wandler & Belüftungslöcher
2.9 Fehlerdiagnose & Reparaturanleitung MosFETs tauschen
2.9.1 die Status-LED leuchtet dauerhaft rot
2.9.2 die Status-LED leuchtet dauerhaft garnicht
Der GMI ist der günstigste Einspeisewechselrichter, den es aktuell gibt.


Es ist ein Mikroinverter oder auch Modulwechselrichter, er ist also dafür ausgelegt, um ein Modul zu bedienen.
2.1 Modelle
Inhaltsverzeichnis:
1. WVC / SG Mikrowechselrichter
2. GMI Serie Grid Tie Micro Inverter
2.1 Modelle
2.2 Preise
2.3 technische Daten & Ausstattung
2.4 Handbuch / Datenblatt
2.5 Wasserdicht
2.6 Überhitzung
2.6.1 Nachtrag: erste Erfahrungen im laufenden Betrieb
2.6.2 mein Fazit zur Temperatur
2.7 Erfahrungsberichte / Tests
2.7.1 großer Test mit 4 unterschiedlichen GMI
2.7.2 weitere Tests
2.8 GMI 500 / 600 / 700
2.8.1 passiver Aluminium-Kühlkörper anbringen
2.8.2 Lüfter, DC-DC-Wandler & Belüftungslöcher
2.9 Fehlerdiagnose & Reparaturanleitung MosFETs tauschen
2.9.1 die Status-LED leuchtet dauerhaft rot
2.9.2 die Status-LED leuchtet dauerhaft garnicht
Die GMI Wechselrichter sind erhältlich in folgenden Varianten:
- GMI 120 / 150 / 180 -> baugleich, 150W Dauerleistung
- GMI 260 / 300 / 350 -> baugleich, 300W Dauerleistung
- GMI 500 / 600 / 700 -> baugleich, 600W Dauerleistung
Baulich sind die Geräte von außen fast komplett identisch,lediglich die Größe des Gehäuses ist unterschiedlich bei den drei Leistungsklassen.
Allen Modellen gleich ist, dass sie immer nur ein MC4 Paar zum Anschluss eines Panels besitzen.
Die GMI Inverter sind daher ideal als Mikrowechselrichter / Modulwechselrichter oder als Balkonsolar / Balkonkraftwerk.
Es sind reine Einspeisewechselrichter, können also nicht im Inselbetrieb mit Batterie / Akku genutzt werden.
2.2 Preise
Inhaltsverzeichnis:
1. WVC / SG Mikrowechselrichter
2. GMI Serie Grid Tie Micro Inverter
2.1 Modelle
2.2 Preise
2.3 technische Daten & Ausstattung
2.4 Handbuch / Datenblatt
2.5 Wasserdicht
2.6 Überhitzung
2.6.1 Nachtrag: erste Erfahrungen im laufenden Betrieb
2.6.2 mein Fazit zur Temperatur
2.7 Erfahrungsberichte / Tests
2.7.1 großer Test mit 4 unterschiedlichen GMI
2.7.2 weitere Tests
2.8 GMI 500 / 600 / 700
2.8.1 passiver Aluminium-Kühlkörper anbringen
2.8.2 Lüfter, DC-DC-Wandler & Belüftungslöcher
2.9 Fehlerdiagnose & Reparaturanleitung MosFETs tauschen
2.9.1 die Status-LED leuchtet dauerhaft rot
2.9.2 die Status-LED leuchtet dauerhaft garnicht
Hier meine Bezugsquellen für die Modelle:
- 120W / 150W / 180W Modelle auf Aliexpress / Amazon / eBay
- 260W / 300W / 350W Modelle auf Aliexpress / Amazon / eBay
- 500W / 600W / 700W Modelle auf Aliexpress / Amazon / eBay
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
2.3 technische Daten & Ausstattung
Inhaltsverzeichnis:
1. WVC / SG Mikrowechselrichter
2. GMI Serie Grid Tie Micro Inverter
2.1 Modelle
2.2 Preise
2.3 technische Daten & Ausstattung
2.4 Handbuch / Datenblatt
2.5 Wasserdicht
2.6 Überhitzung
2.6.1 Nachtrag: erste Erfahrungen im laufenden Betrieb
2.6.2 mein Fazit zur Temperatur
2.7 Erfahrungsberichte / Tests
2.7.1 großer Test mit 4 unterschiedlichen GMI
2.7.2 weitere Tests
2.8 GMI 500 / 600 / 700
2.8.1 passiver Aluminium-Kühlkörper anbringen
2.8.2 Lüfter, DC-DC-Wandler & Belüftungslöcher
2.9 Fehlerdiagnose & Reparaturanleitung MosFETs tauschen
2.9.1 die Status-LED leuchtet dauerhaft rot
2.9.2 die Status-LED leuchtet dauerhaft garnicht
Der GMI hat im Grunde absolut keine Ausstattung
- kein WLan / Bluetooth / RS485 -> keinerlei externe Schnittstelle zum Auslesen von Daten
- kein Display
- keine Knopfe / Buttons / Einstellmöglichkeiten
Man kann ihn lediglich
- mit dem PV-Modul verbinden
- in die 230V Steckdose einstecken
- fertig
Das hält den Preis niedrig und senkt auch die Fehleranfälligkeit, man kann bei der Installation und Bedienung faktisch nichts falsch machen.
Das spiegelt sich dann wieder bei den technischen Daten, die ebenfalls sehr überschaubar sind
- PV-Eingangsspannung GMI 260 - 700: 18V - 50V
- PV-Eingangsspannung GMI 120 - 180: 10,8V - 30V
- echter MPPT Tracker
- Ausgangsspannung 110-120V oder 220-240V -> muss man beim Kauf im Auswahlmenü vorher angeben. Das 110-120V Modell ist z.B. für USA
- Ausgangsleistung 260W - 700W -> zur Leistung den Test samt Video am Ende dieses Kapitels beachten
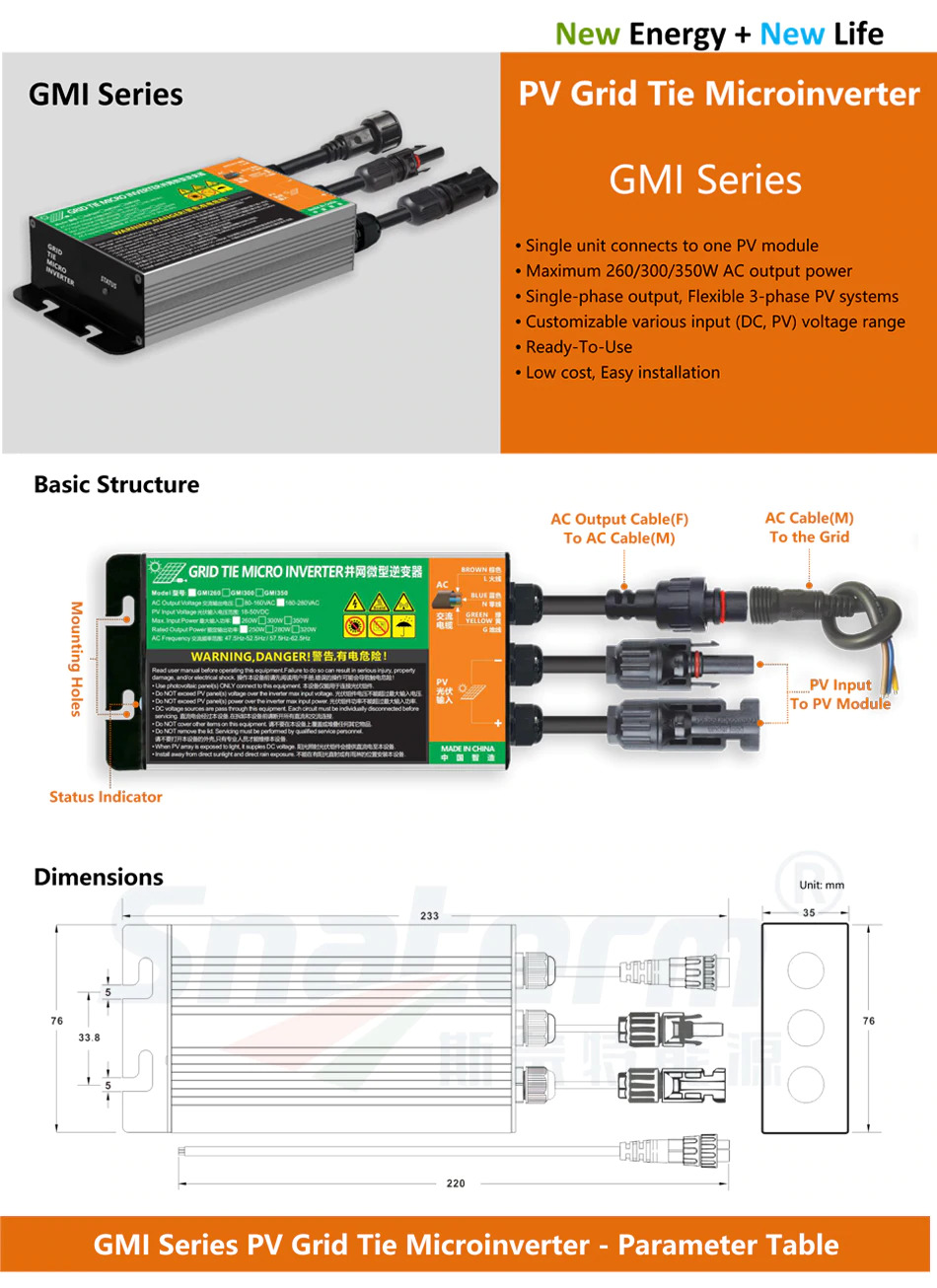
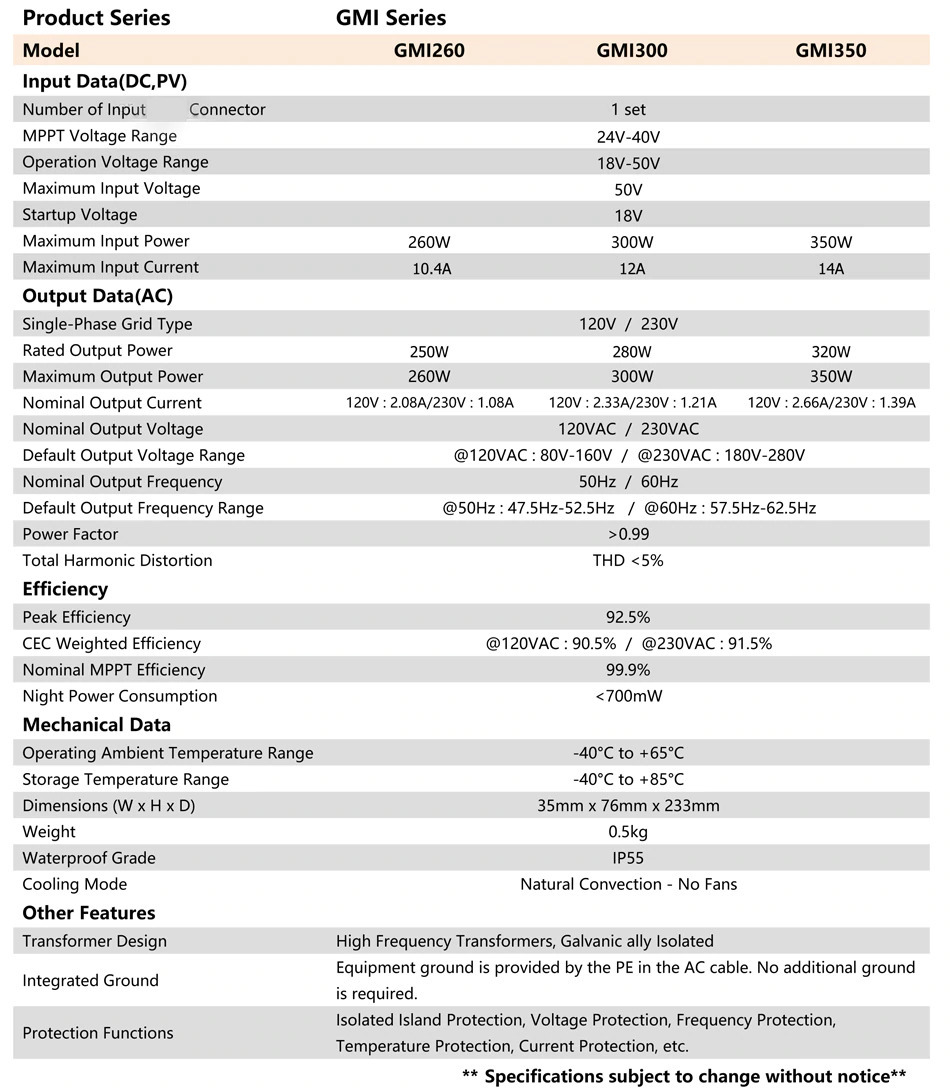
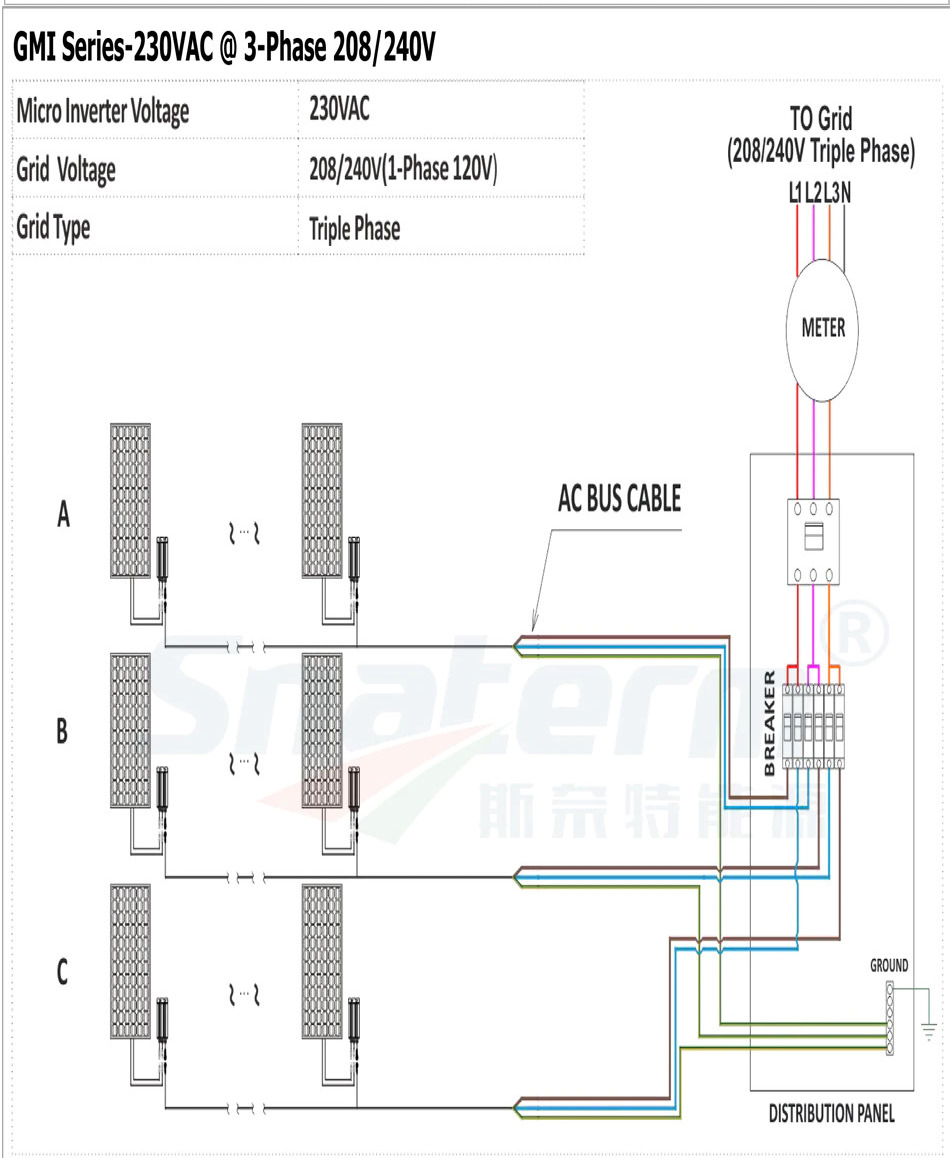
Hier ein paar Bilder vom Innern:

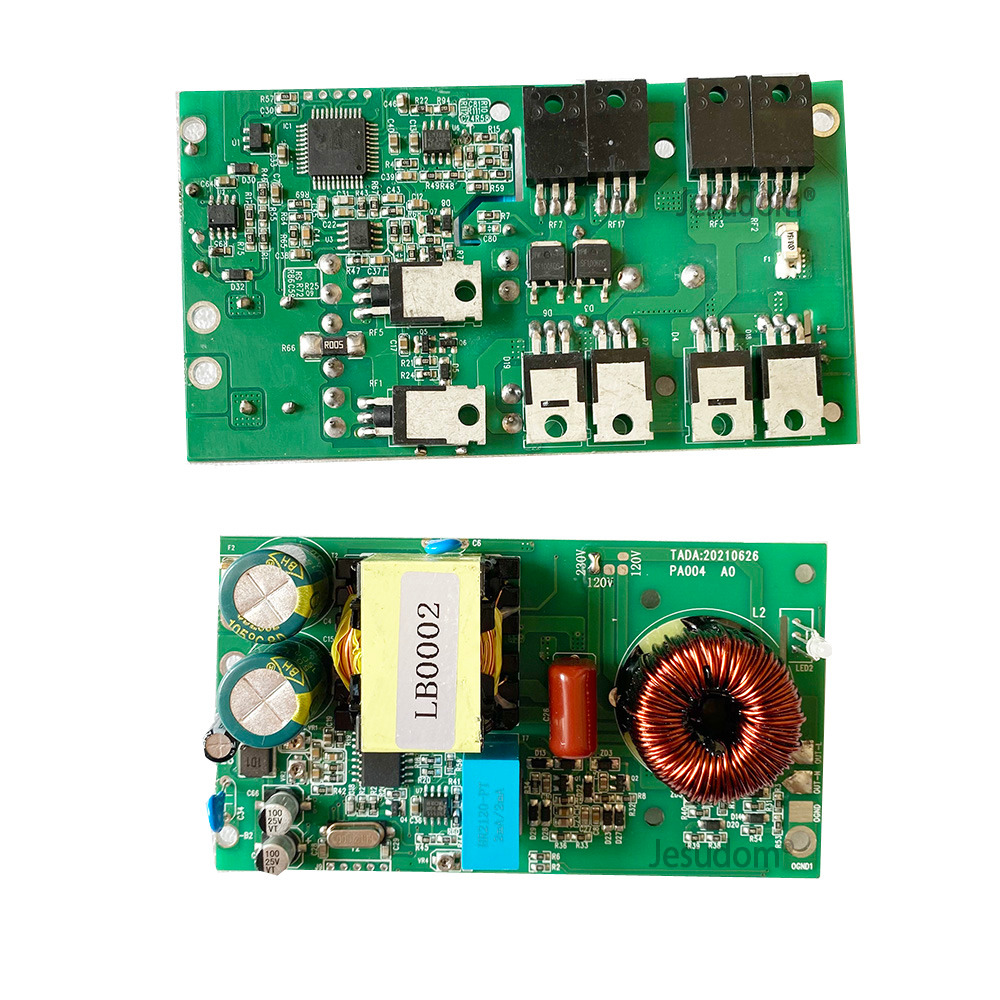


2.4 Handbuch / Datenblatt
Inhaltsverzeichnis:
1. WVC / SG Mikrowechselrichter
2. GMI Serie Grid Tie Micro Inverter
2.1 Modelle
2.2 Preise
2.3 technische Daten & Ausstattung
2.4 Handbuch / Datenblatt
2.5 Wasserdicht
2.6 Überhitzung
2.6.1 Nachtrag: erste Erfahrungen im laufenden Betrieb
2.6.2 mein Fazit zur Temperatur
2.7 Erfahrungsberichte / Tests
2.7.1 großer Test mit 4 unterschiedlichen GMI
2.7.2 weitere Tests
2.8 GMI 500 / 600 / 700
2.8.1 passiver Aluminium-Kühlkörper anbringen
2.8.2 Lüfter, DC-DC-Wandler & Belüftungslöcher
2.9 Fehlerdiagnose & Reparaturanleitung MosFETs tauschen
2.9.1 die Status-LED leuchtet dauerhaft rot
2.9.2 die Status-LED leuchtet dauerhaft garnicht
Beides hier als Download direkt von mir
{phocadownload view=file|id=17|target=b}
{phocadownload view=file|id=16|target=b}
2.5 Wasserdicht
Inhaltsverzeichnis:
1. WVC / SG Mikrowechselrichter
2. GMI Serie Grid Tie Micro Inverter
2.1 Modelle
2.2 Preise
2.3 technische Daten & Ausstattung
2.4 Handbuch / Datenblatt
2.5 Wasserdicht
2.6 Überhitzung
2.6.1 Nachtrag: erste Erfahrungen im laufenden Betrieb
2.6.2 mein Fazit zur Temperatur
2.7 Erfahrungsberichte / Tests
2.7.1 großer Test mit 4 unterschiedlichen GMI
2.7.2 weitere Tests
2.8 GMI 500 / 600 / 700
2.8.1 passiver Aluminium-Kühlkörper anbringen
2.8.2 Lüfter, DC-DC-Wandler & Belüftungslöcher
2.9 Fehlerdiagnose & Reparaturanleitung MosFETs tauschen
2.9.1 die Status-LED leuchtet dauerhaft rot
2.9.2 die Status-LED leuchtet dauerhaft garnicht
Laut Herstellerangaben ist der Wechselrichter wasserdicht. Wie grundsätzlich alle Elektrogeräte aus China...
Und wie grundsätzlich bei all diesen Geräten gilt: sie sind es natürlich nicht
Der GMI besitzt keinerlei Dichtungen, ist also absolut und in keinster Weise wasserdicht. Also bitte ausschließlich regen- und spritzwassergeschützt verwenden.
Man kann ihn ruhig draussen montieren, z.B. unterhalb der Solarmodule oder unter einer Überdachung, im Gartenhaus o.ä.
2.6 Überhitzung
Inhaltsverzeichnis:
1. WVC / SG Mikrowechselrichter
2. GMI Serie Grid Tie Micro Inverter
2.1 Modelle
2.2 Preise
2.3 technische Daten & Ausstattung
2.4 Handbuch / Datenblatt
2.5 Wasserdicht
2.6 Überhitzung
2.6.1 Nachtrag: erste Erfahrungen im laufenden Betrieb
2.6.2 mein Fazit zur Temperatur
2.7 Erfahrungsberichte / Tests
2.7.1 großer Test mit 4 unterschiedlichen GMI
2.7.2 weitere Tests
2.8 GMI 500 / 600 / 700
2.8.1 passiver Aluminium-Kühlkörper anbringen
2.8.2 Lüfter, DC-DC-Wandler & Belüftungslöcher
2.9 Fehlerdiagnose & Reparaturanleitung MosFETs tauschen
2.9.1 die Status-LED leuchtet dauerhaft rot
2.9.2 die Status-LED leuchtet dauerhaft garnicht
Ebenfalls typisch für Elektrogeräte mit Leistungselektronik aus China ist, dass sie thermisch eine Katastrophe sind, d.h. es wurde an der Kühlung gespart.
So auch hier beim GMI. Er verfügt weder über Lüfter noch über gescheite Kühlrippen, um die Abwärme an die Umgebungsluft abgeben zu können.
Das führt dazu, dass er unter Last schnell überhitzt und dann die Leistung drosselt.
So schafft z.B. der GMI 260 / 300 / 350 ohne Zusatzkühlung dauerhaft etwa 200W.
Abhilfe:
- Installation an einem dauerhaft kühlen Ort z.B. Keller
- mit einem Lüfter anpusten
- zusätzliche Kühlkörper installieren
Wie beim SG-Serie oberhalb auch habe ich meine beiden GMI mit zusätzlichen Kühlkörpern aus Aluminium ausgestattet

die Kühlkörper idealerweise so groß wie die Gehäusefläche wählen, Maße s. Skizze weiter oben

das Gehäuse des GMI ist nicht komplett glatt. Das ist nicht optimal für einen Kühlkörper, aber es geht

auf der Vorderseite ist ein Aufkleber, der die Wärmeabfuhr sogar stark verschlechtert, da er einen zusätzlichen Wärmeübergang schafft

also erstmal den Aufkleber ab, das geht zum Glück easy und rückstandsfrei

dann brauchen wir wie beim SG-Wechselrichter auch Wärmeleitkleber und Wärmeleitpaste. Den Wärmeleitkleber trage ich in der Mitte auf dem schmalen, glatten Steg auf. Die Rillen bestreiche ich großzügig mit Wärmeleitpaste, damit diese beim Andrücken des Kühlkörpers möglichst ausgefüllt werden und die Wärme gut wandern kann

Kühlkörper ausrichten und andrücken. Das Ganze auf beiden Seiten

dann über Nacht mit Schraubzwingen (und Holzbrettchen zum Schutz der Kühlrippen) verspannen.
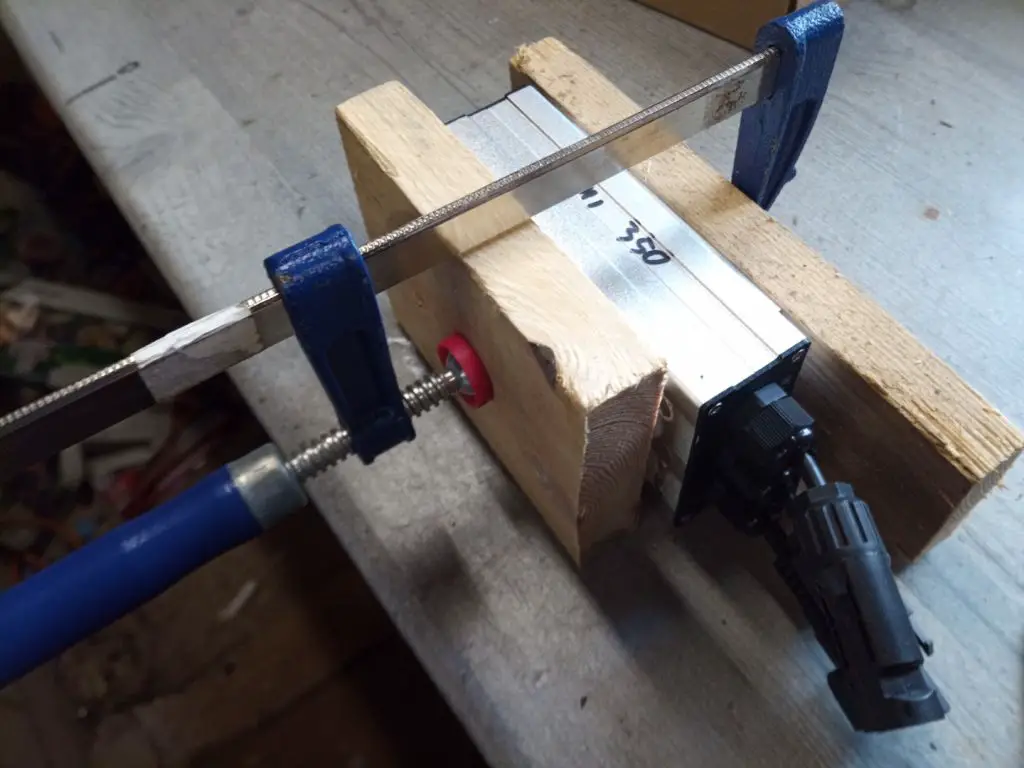
Achtung: beim Festziehen verrutschen die Kühlkörper gerne mal, also nachkontrollieren und ggf. wieder gerade rücken
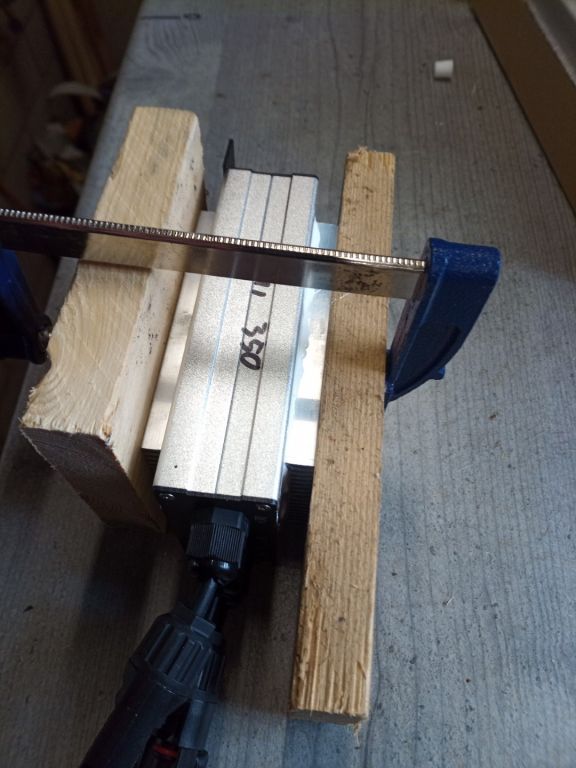
fertig sieht er dann so aus

bei der Montage später dann darauf achten, dass er senkrecht ist, also die Anschlusskabel nach oben oder nach unten zeigen, sodass die Luft optimal an den Finnen des Kühlkörpers vorbei nach oben steigen und die Wärme mitnehmen kann

PS: die Status-LED die hier zu sehen ist stellt die einzige Anzeige dar.
- Rot = Fehler / keine Sonneneinstrahlung / kein 230V Netz angeschlossen
- Rot blinkend = wird synchronisiert mit dem 230V Netz (dauert etwa 30 Sekunden)
- Grün = alles OK

|
Du findest unsere Beiträge hilfreich und möchtest uns unterstützen?  Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten und zwar ganz ohne, dass es Dich etwas kostet (hier klicken) |
2.6.1 Nachtrag: erste Erfahrungen im laufenden Betrieb
Die Kühlkörper alleine sind nicht ausreichend, um den GMI ausreichend zu kühlen.
Ich habebei meinen GMI 300 nach einer Stunde Dauerlast, während er auch die Leistung gedrosselt hat, die obere Gehäusehälfte abgenommen (4 Schrauben) und die Temperaturen im Innern gemessen.
Das heißeste Bauteil ist die Hochfrequenzspule. Nachdem das Alugehäuse noch 30°C hatte lag die Temperatur an der Spule noch immer bei 60°C

Zumindest bei meinem Modell besteht bei der Spule kein guter Wärmekontakt zum Alugehäuse, weswegen sie ihre Hitze also nicht gescheit loswerden kann. Bei mir klebt da ein etwa 8mm dicker Schaumgummi zwischen Spule und Gehäuse. Ich hab noch nie was von "Wärmeleitschaumgummi" gehört, deswegen funktioniert das wohl auch nicht so gut.
Lösung:

Lüftungslöcher seitlich in die obere Gehäusehälfte bohren (8mm Löcher) und einen kleinen Step-Down Spannungswandler...
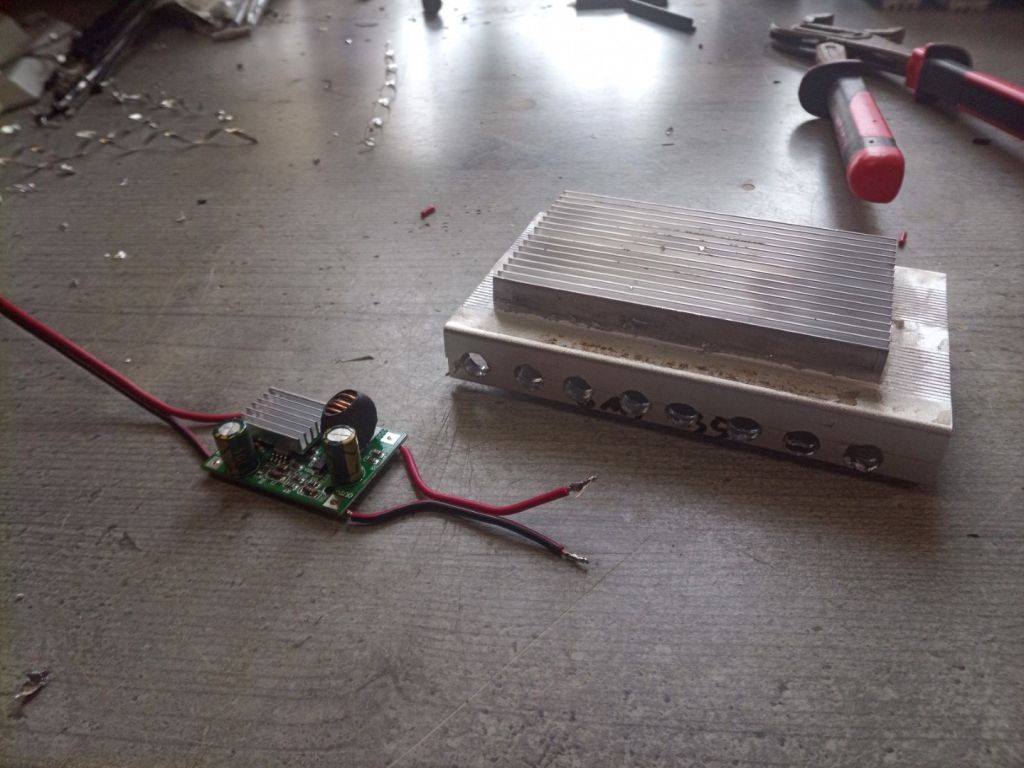
... an den PV-Eingang anschließen um damit einen Lüfter zu versorgen

sobald nun die Sonne scheint und Spannung von den PV-Modulen ankommt schaltet sich der Lüfter automatisch ein. Geht die Sonne weg, ist der Lüfter aus

Zur Anzeige der produzierten Leistung benutze ich übrigens ein kleines Wattmeter (Aliexpress / Amazon / eBay)

nun mit Kühlkörper und Lüfter bleibt der GMI auch unter Volllast eisig kalt. Rund 20°C auf der Vorderseite

und 30°C auf der heißeren Rückseite, wo die...

...Leistungstransistoren angeklebt sind

auch ein möglicher Umbau, den ich im Netz gefunden habe:

wobei hier die Unterseite mit den Transistoren durch den Lüfter nicht mitgekühlt wird
Video von den den drei Tagen Testung und Umbau des GMI:
2.6.2 mein Fazit zur Temperatur
Inhaltsverzeichnis:
1. WVC / SG Mikrowechselrichter
2. GMI Serie Grid Tie Micro Inverter
2.1 Modelle
2.2 Preise
2.3 technische Daten & Ausstattung
2.4 Handbuch / Datenblatt
2.5 Wasserdicht
2.6 Überhitzung
2.6.1 Nachtrag: erste Erfahrungen im laufenden Betrieb
2.6.2 mein Fazit zur Temperatur
2.7 Erfahrungsberichte / Tests
2.7.1 großer Test mit 4 unterschiedlichen GMI
2.7.2 weitere Tests
2.8 GMI 500 / 600 / 700
2.8.1 passiver Aluminium-Kühlkörper anbringen
2.8.2 Lüfter, DC-DC-Wandler & Belüftungslöcher
2.9 Fehlerdiagnose & Reparaturanleitung MosFETs tauschen
2.9.1 die Status-LED leuchtet dauerhaft rot
2.9.2 die Status-LED leuchtet dauerhaft garnicht
- der GMI ist thermaltechnisch eine Katastrophe, er hat weder Kühlkörper noch eine aktive Lüftung und überhitzt daher schnell
- bei Überhitzung drosselt er seine Ausgangsleistung. Das geschieht bei etwa 50°C Gehäusetemperatur, was geschätzt 100°C an der Hochfrequenzspule entspricht
- im Originalzustand, ohne Kühlkörper, ohne Lüfter drosselt er die Leistung auf ca. 150 Watt wobei die Temperatur von 50°C / 100°C dann dauerhaft bleibt
- mit aufgeklebten Kühlkörpern beidseitig, ohne Lüfter schafft er dann zumindest ca. 250 Watt wobei auch hier die Temperatur s.o. bleibt
- mit aufgeklebten Kühlkörpern beidseitig, mit Luftlöchern beidseitlich und mit Lüfter hat er die volle Leistung ohne zu drosseln und bleibt dabei unter 30°C
Ich würde deswegen dringend davon abraten, den kleinen GMI Wechselrichter ohne zusätzliche Kühlung zu betreiben, da er auch dann, wenn er sich selbst in der Leistung drosselt, noch immer sehr ungesunde Temperaturen hat und so nicht lange leben wird.
Mit ein wenig Umbaumaßnahmen zur besseren Kühlung jedoch ist das ein sehr günstiger Wechselrichter, der seine Arbeit gut macht.
2.7 Erfahrungsberichte / Tests
2.7.1 großer Test mit 4 unterschiedlichen GMI
Inhaltsverzeichnis:
1. WVC / SG Mikrowechselrichter
2. GMI Serie Grid Tie Micro Inverter
2.1 Modelle
2.2 Preise
2.3 technische Daten & Ausstattung
2.4 Handbuch / Datenblatt
2.5 Wasserdicht
2.6 Überhitzung
2.6.1 Nachtrag: erste Erfahrungen im laufenden Betrieb
2.6.2 mein Fazit zur Temperatur
2.7 Erfahrungsberichte / Tests
2.7.1 großer Test mit 4 unterschiedlichen GMI
2.7.2 weitere Tests
2.8 GMI 500 / 600 / 700
2.8.1 passiver Aluminium-Kühlkörper anbringen
2.8.2 Lüfter, DC-DC-Wandler & Belüftungslöcher
2.9 Fehlerdiagnose & Reparaturanleitung MosFETs tauschen
2.9.1 die Status-LED leuchtet dauerhaft rot
2.9.2 die Status-LED leuchtet dauerhaft garnicht
Hier ist ein Test von mir mit vier unterschiedlichen GMI Modellen mit besonderem Augenmerk auf die tatsächliche Ausgangsleistung sowie Wärmeentwicklung.
Getestet wurden
- GMI 260
- GMI 350 -> zwei Modelle
- GMI 700
Zum Testen der kleineren GMI 260 und 350 habe ich zwei PV-Module JA-Solar mit je 380Wp benutzt und parallel geschaltet, später um dann den GMI 700 voll auszulasten dann ein drittes Modul dazu geklemmt, ebenfalls parallel



zum Testen habe ich die PV-Module parallel angeschlossen, da die EIngangsspannung der GMI maximal 50V betragen darf.
Das Verlängerungskabel dient zur Einspeisung in das 230V Hausnetz

was ich mit diesem Test herausfinden möchte sind hauptsächlich zwei Dinge:
- wie hoch ist die maximale Leistung der unterschiedlichen Wechselrichter
- wie ist dabei die Temperaturentwicklung ohne zus. Aktivkühlung / Lüfter
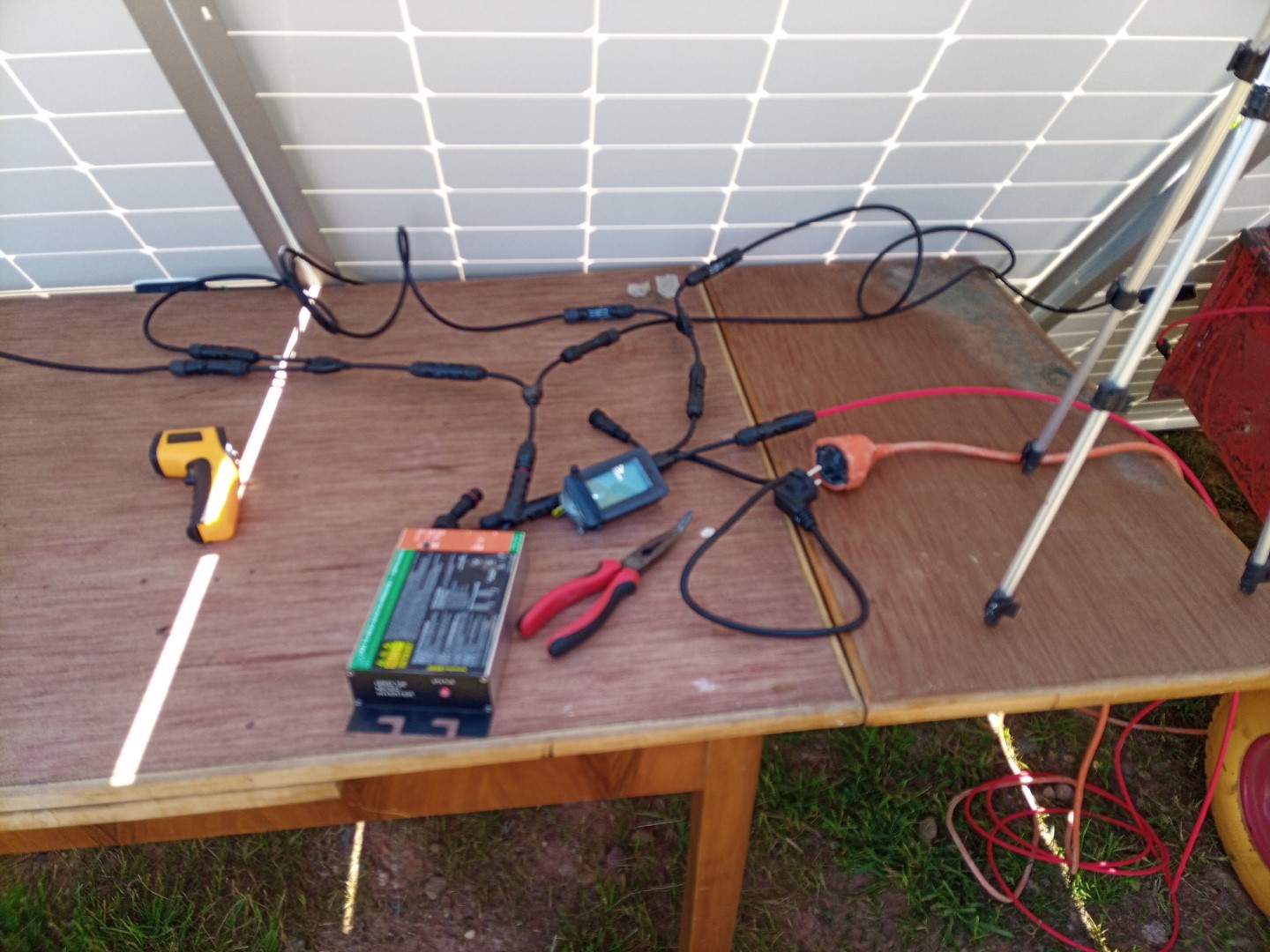
zum Messen der Leistung benutze ich diese einfache Wattmeter (Aliexpress / Amazon / eBay). Die funktioniert über AC, d.h. die Einspeiseseite des WR wird an das Display angeschlossen und daran dann ein Schuko-Stecker

von diesen Wattmetern gibt es einige unterschiedliche Modelle auf Aliexpress, die alle ähnlich aussehen. Bei diesem hier wird im Grunde der N (Nullleiter) durch das Gerät durchgeschleift und dabei die Leistung in Watt ermittelt. Ich habe auch andere Wattmeter, da wird der L (also Phase) durchgeschleift zum Messen, also Datenblatt beachten

preislich liegt so eine Anzeige bei etwa 10 - 12€ inkl. Versand (Aliexpress / Amazon / eBay)

Hier nun mein Test als Video
nach beendetem Test habe ich alle Wechselrichter mal aufgeschraubt um das Innere zu vergleichen


GMI 260
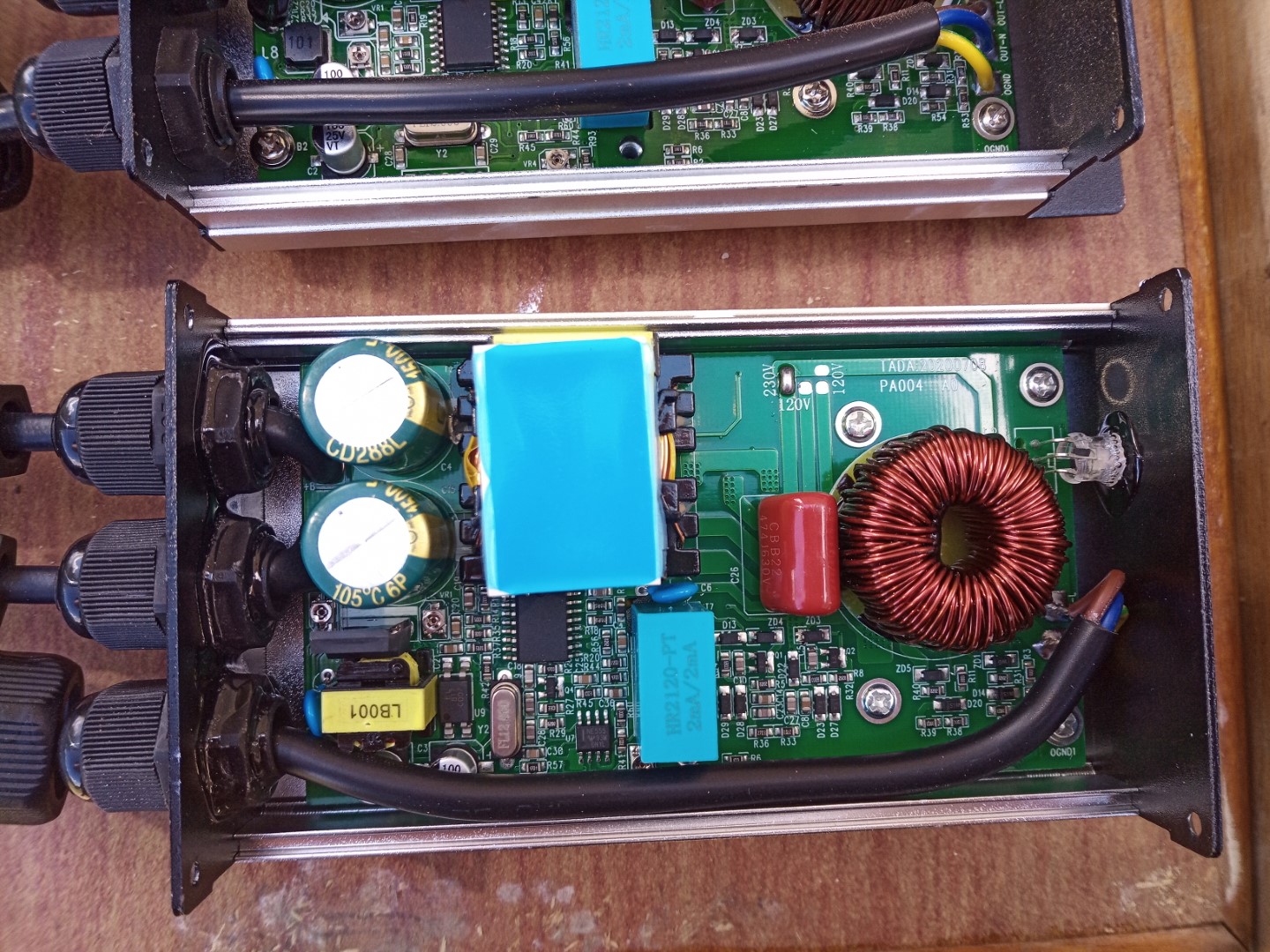
GMI 350 Nr. 1

GMI 350 Nr. 2
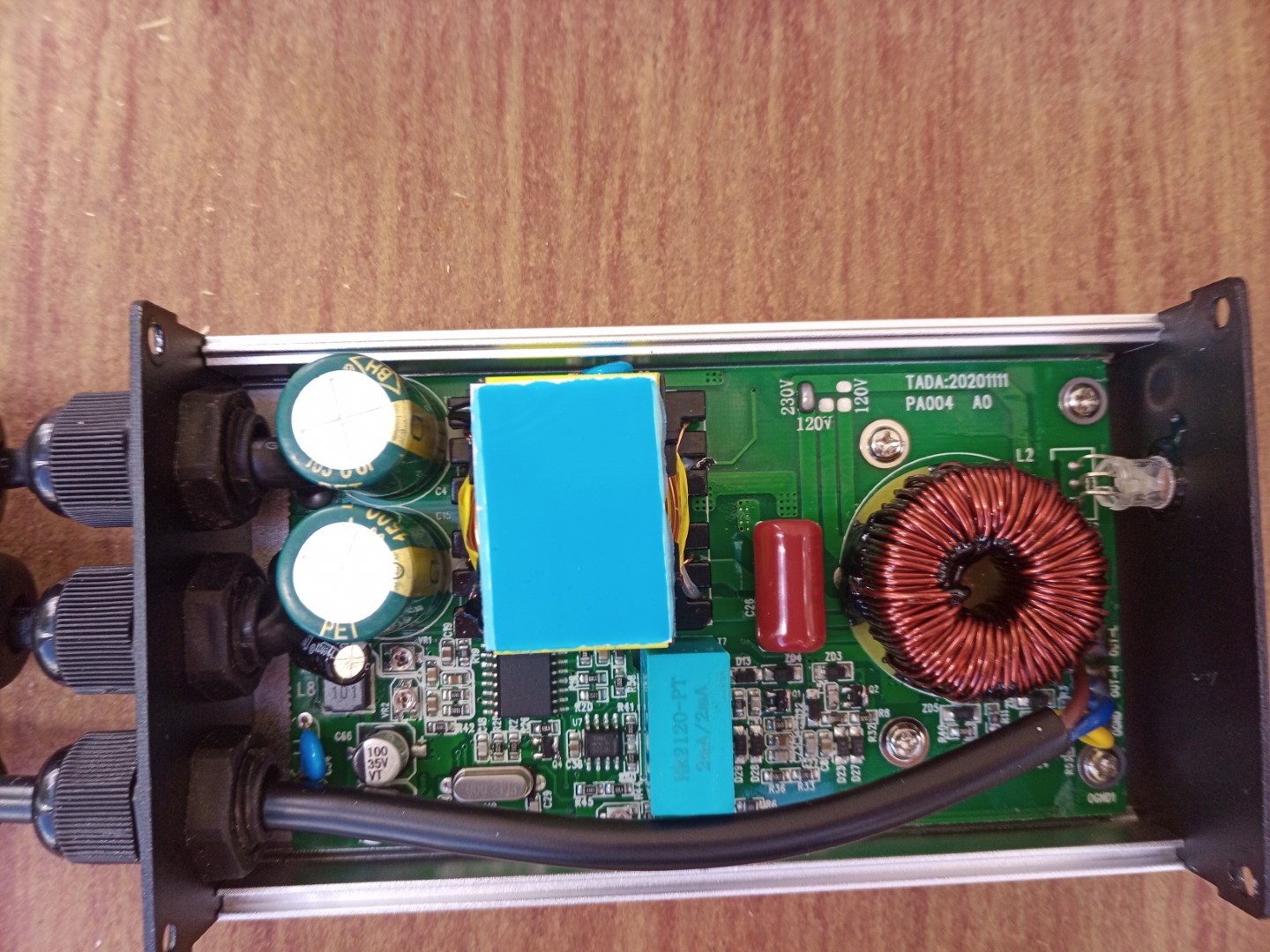
GMI 700


mein Fazit zur Leistung:
Die kleineren GMI 260, 300 und 350 sind intern allesamt identisch aufgebaut und leisten dauerhaft 300 Watt, vorausgesetzt die Kühlung ist so, dass sie die 50°C nicht überschreiten.
Der Kauf des teuren GMI 350 lohnt nicht da er die angegebene Leistung nicht bringt und ich empfehle hier, den günstigen GMI 260 zu kaufen.
Der große GMI 700 bringt die angegebene Leistung von 700W ebenfalls nicht sondern nur rund 600W.
Ich vermute, dass die größeren Modelle GMI 500, 600 und 700 ebenfalls intern identisch aufgebaut sind und einfach nur die doppelten Leistungskomponenten der kleineren GMI haben. Somit kommen dann auch die 600W tatsächliche Leistung zustande.
Deswegen auch hier: ich würde tippen, dass der GMI 500 bei den großen Modellen das beste bei P/L ist.
Falls jemand ein GMI 500 und / oder 600 mal in Händen hat und die Leistung gemessen hat würde ich mich über eine Rückmeldung per Mail freuen 😀
Nachtrag 03.2022: ich habe mittlerweile selbst einen GMI 500 sowie auch einen verwandten PVGS 500 s. nachfolgend ab Punkt 2.8 und es ist tatsächlich so: die Leistung beträgt 600W bei den GMI 500, 600 sowie 700W
2.7.2 weitere Tests
Inhaltsverzeichnis:
1. WVC / SG Mikrowechselrichter
2. GMI Serie Grid Tie Micro Inverter
2.1 Modelle
2.2 Preise
2.3 technische Daten & Ausstattung
2.4 Handbuch / Datenblatt
2.5 Wasserdicht
2.6 Überhitzung
2.6.1 Nachtrag: erste Erfahrungen im laufenden Betrieb
2.6.2 mein Fazit zur Temperatur
2.7 Erfahrungsberichte / Tests
2.7.1 großer Test mit 4 unterschiedlichen GMI
2.7.2 weitere Tests
2.8 GMI 500 / 600 / 700
2.8.1 passiver Aluminium-Kühlkörper anbringen
2.8.2 Lüfter, DC-DC-Wandler & Belüftungslöcher
2.9 Fehlerdiagnose & Reparaturanleitung MosFETs tauschen
2.9.1 die Status-LED leuchtet dauerhaft rot
2.9.2 die Status-LED leuchtet dauerhaft garnicht
Youtuber VoltAmpereLux hat in einem Video uA einen SG 600 und einen GMI 300 auf die Stromqualutät hin überprüft und die Sinuskurve gemessen, sehr aufschlussreich
2.8 GMI 500 / 600 / 700
Inhaltsverzeichnis:
1. WVC / SG Mikrowechselrichter
2. GMI Serie Grid Tie Micro Inverter
2.1 Modelle
2.2 Preise
2.3 technische Daten & Ausstattung
2.4 Handbuch / Datenblatt
2.5 Wasserdicht
2.6 Überhitzung
2.6.1 Nachtrag: erste Erfahrungen im laufenden Betrieb
2.6.2 mein Fazit zur Temperatur
2.7 Erfahrungsberichte / Tests
2.7.1 großer Test mit 4 unterschiedlichen GMI
2.7.2 weitere Tests
2.8 GMI 500 / 600 / 700
2.8.1 passiver Aluminium-Kühlkörper anbringen
2.8.2 Lüfter, DC-DC-Wandler & Belüftungslöcher
2.9 Fehlerdiagnose & Reparaturanleitung MosFETs tauschen
2.9.1 die Status-LED leuchtet dauerhaft rot
2.9.2 die Status-LED leuchtet dauerhaft garnicht
Hier soll es nun einerseits um die größeren Modelle GMI 500 / 600 und 700 gehen und zwar hauptsächlich um Leistungsdaten und den Umbau mit Kühlkörper und aktivem Zusatzlüfter


Problem bei allen Modellen der GMI Serie ist, dass sie keine ausreichende Kühlung besitzen und im Betrieb sehr schnell (innerhalb weniger Minuten) überhitzen, dadurch einerseits die Leistung reduziert wird und andererseits bei regelmäßiger Überhitzung die Geräte frühzeitig sterben.
Mittlerweile habe ich nun einen GMI 500, der laut Datenblatt 500W Leistung bringen soll, in der Praxis dann aber 600W liefert da die Modelle 500 / 600 und 700 komplett identisch sind.
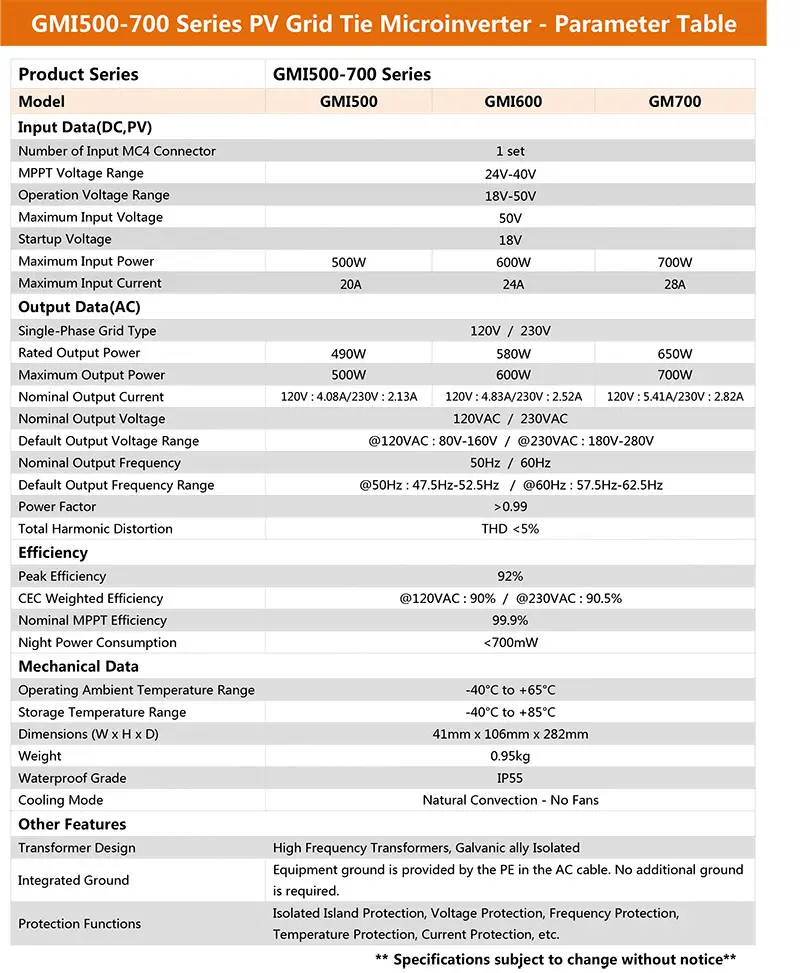
Zu kaufen gibt es die hier:
- 500W / 600W / 700W Modelle auf Aliexpress / Amazon / eBay
MwSt ist mittlerweile bei Aliexpress bereits im Verkaufspreis inbegriffen, Zoll kommt unterhalb 150€ keiner mehr dazu, d.h. selbst bei Versand aus China ist der effektive Endpreis genau der, den ihr an der Kasse zahlt.
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
so kommt er an

wie bei den kleineren Modellen mit 300W auch ist das einzige Zubehör das ANschlusskabel-Stück für den 230V Netzanschluss

die Anschlüsse sind ebenfalls identisch zu den 300W Modellen. MC4-Stecker für ein Modul. Mittels Y-Adaptern kann man dann auch mehrere Module anschließen


am anderen Ende sind die Befestigungslaschen zur Montage sowie die Status-LED. Blink- und Farbcodes sind im Handbuch hinterlegt, das auf ENglisch beigefügt ist.
Am Ende werde ich auch nochmal das Handbuch als Download verlinken.

praktisch: die wichtigsten technischen Daten sind bereits aufgedruckt
Wichtig hier zu wissen: die maximale PV-Eingangsspannung beträgt 50V, die Leistung der angeschlossenen PV-Module (in Watt bzw. Wp) darf ruhig höher liegen, der Wechselrichter regelt dann bei 600W ab, aber die Spannung darf 50V nicht überschreiten und gerade bei niedrigen Temperaturen steigt die PV-Spannung an.
Deswegen ist es super, dass es neuerdings (seit dem Jahreswechsel 2021/2022) die PVGS Serie gibt, denn der Hauptunterschied ist, dass die Modelle bis 60V Eingangsspannung vertragen
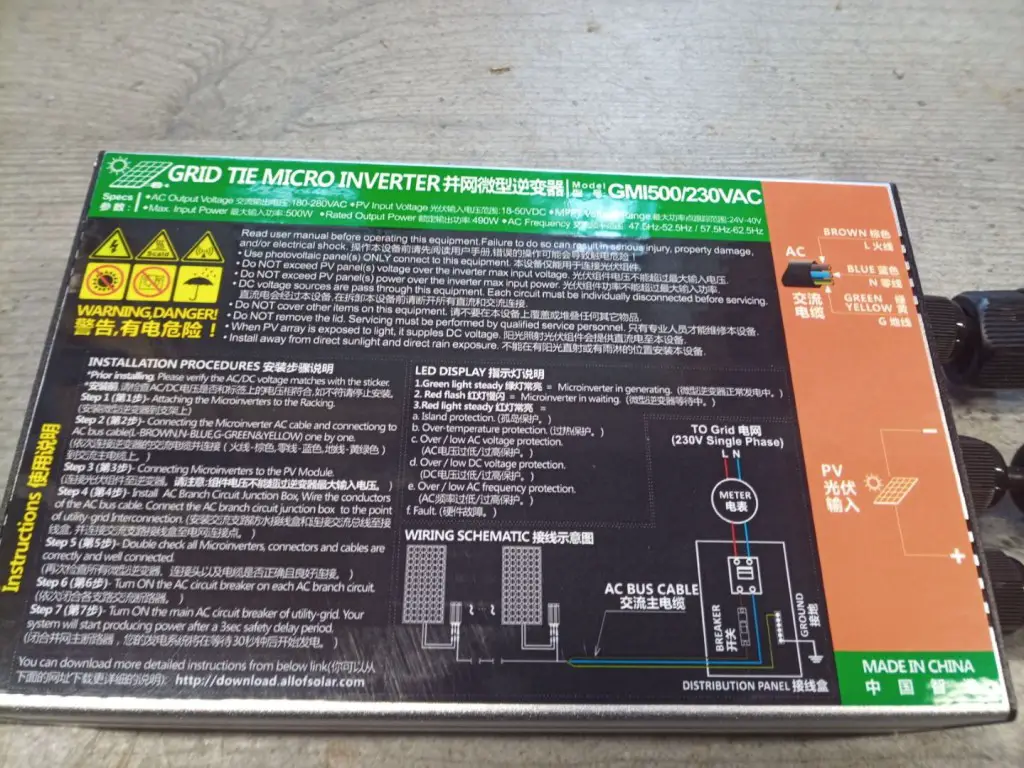
ähnliche Bauform wie bei den kleineren Modelle nur etwas dicker

hier die Maße
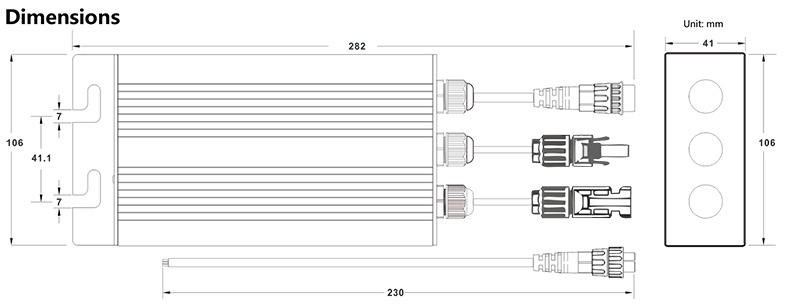
die Unterseite ist frei von Aufklebern und eignet sich auch perfekt, um einen passiven Kühlkörper an zu bringen, da dort auch die MosFETs anliegen
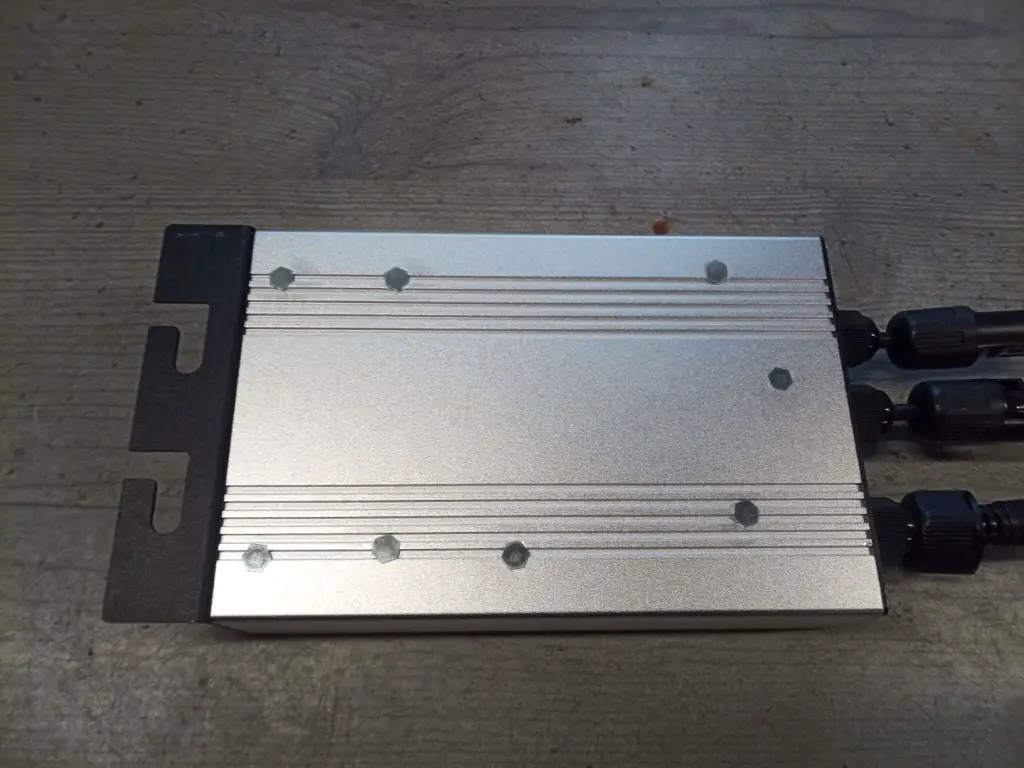
Schauen wir doch mal rein.
Zum Aufschrauben reicht es, wenn man beidseitig die zwei oberen Schräubchen rausdreht
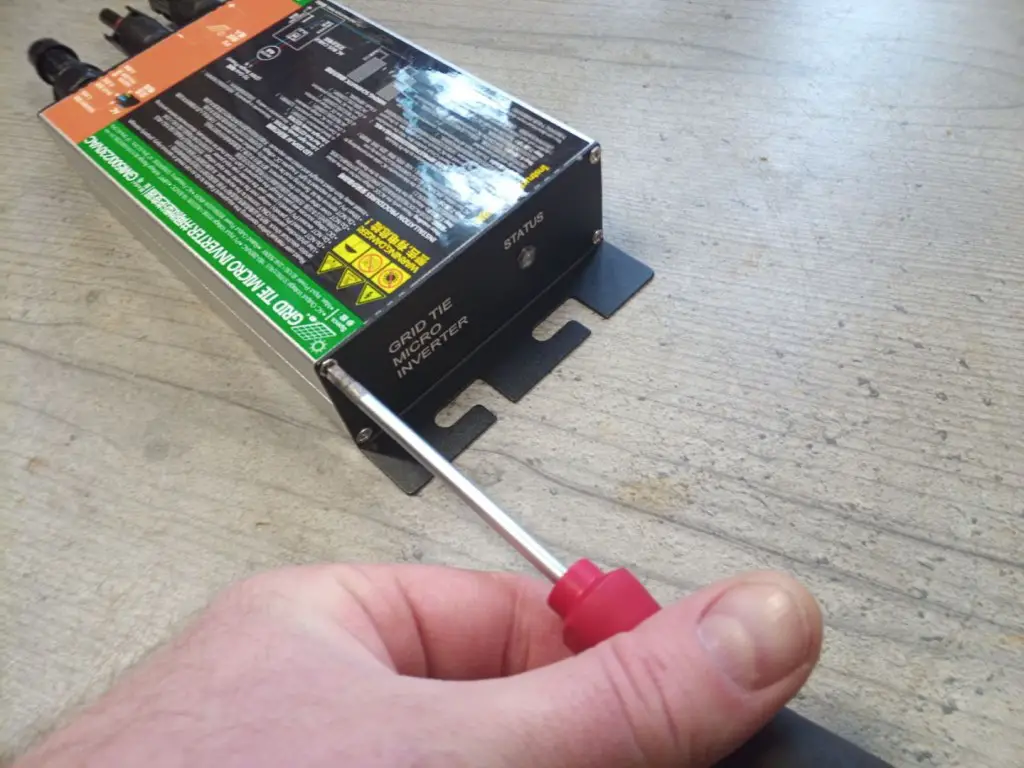
übersichtliches Inneres mit wenigen Bauteilen.
Die Leistungstransistoren sind wie gesagt an der Unterseite der Platine angebracht und liegen an der unteren Gehäusehälfte an. Das ist auch gleichzeitig die Haupt-Wärmequelle.
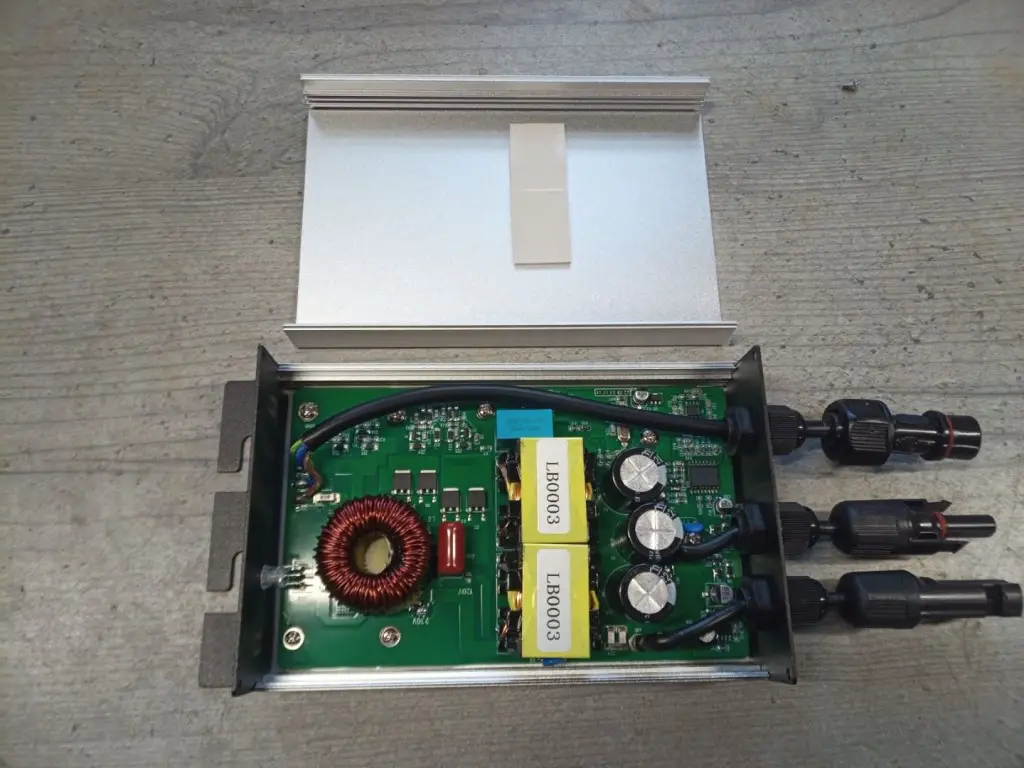
Die anderen Wärmequellen sind die drei Spulen hier


Zur Verbesserung der Kühlung werde ich zwei Dinge tun:
- passiver Kühlkörper an der Unterseite des Gehäuses anbringen zur besseren Kühlung der MosFETs
- aktiver Lüfter in der Gehäuseoberseite zur Kühlung der Spulen
2.8.1 passiver Aluminium-Kühlkörper anbringen
Hier kann man sicher unterschiedliche Modelle benutzen, ich habe mich für ein gängiges und daher recht günstiges Maßentschieden in 100 x 100 x 18mm
Kostet auf Aliexpress zwischen 3 und 4€ je nach Händler

um den Kühlkörper an zu bringen benutze ich eine Kombination aus Wärmeleitpaste und Wärmeleitkleber
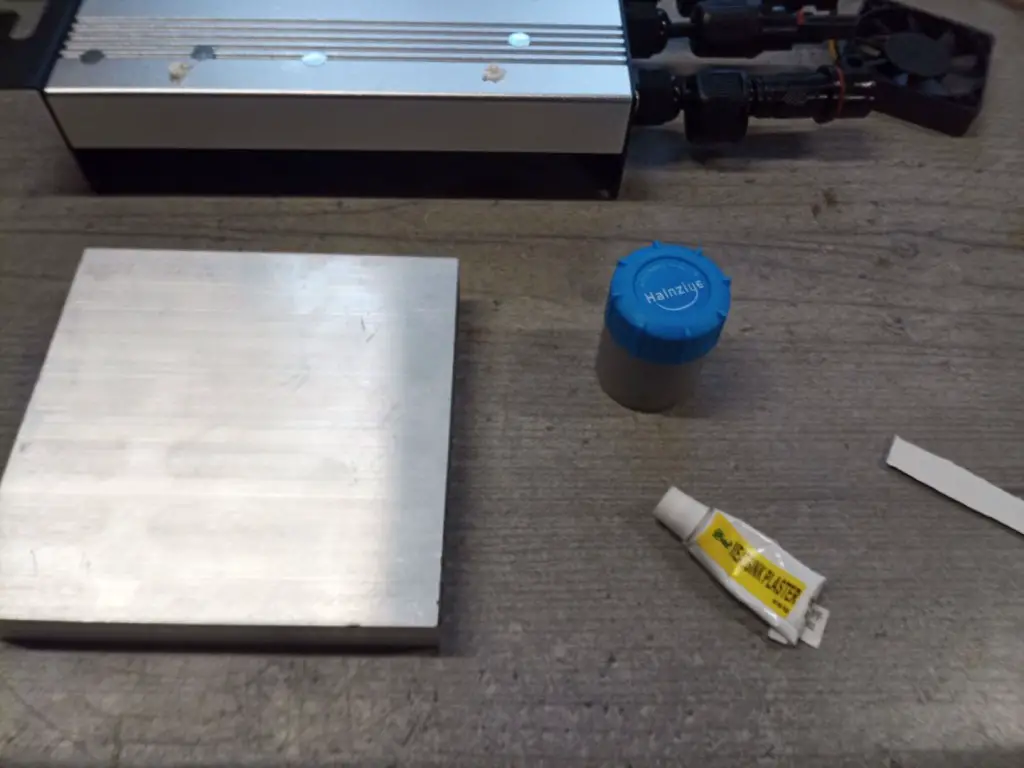
einige wenige Kleckse Wärmeleitkleber in den Ecken + Mitte reicht aus, den Rest mit Wärmeleitpaste bestreichen (das bekommst Du sicherlich ordentlicher hin als ich)

Kühlkörper drauf, zart andrücken...
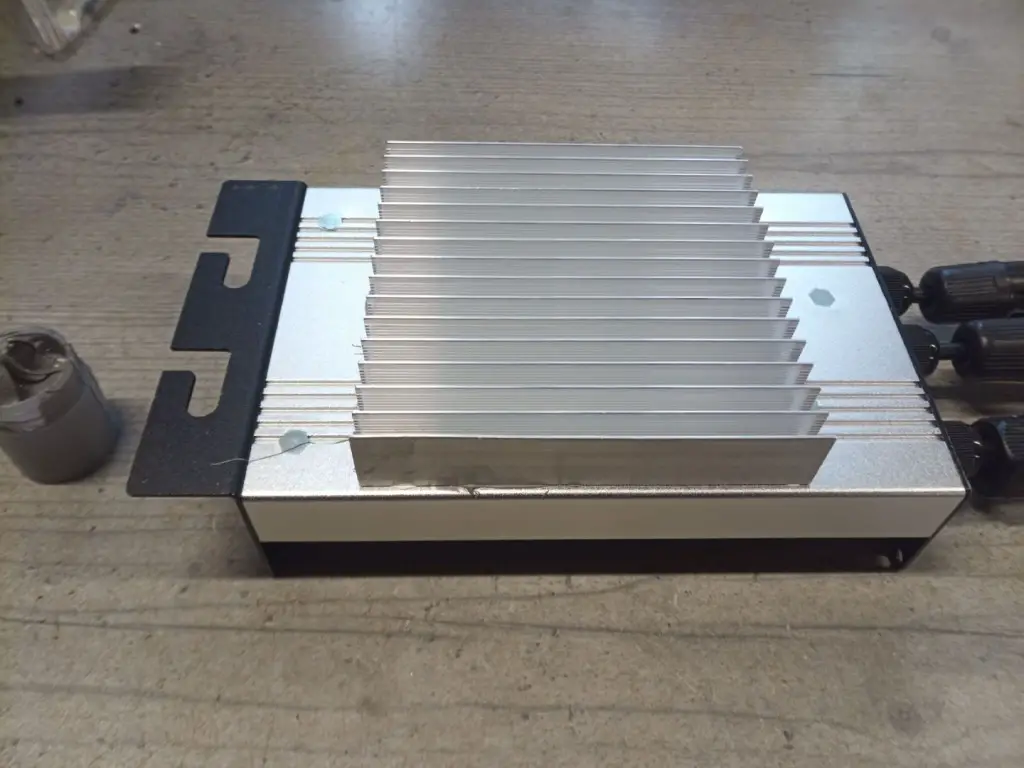
...Holzbrettchen drauf, damit die Finnen nicht verbiegen und dann ordentlich beschweren + über Nacht durchhärten lassen

2.8.2 Lüfter, DC-DC-Wandler & Belüftungslöcher
Während der Wärmeleitkleber trocknet können wir in Ruhe den Lüfter montieren
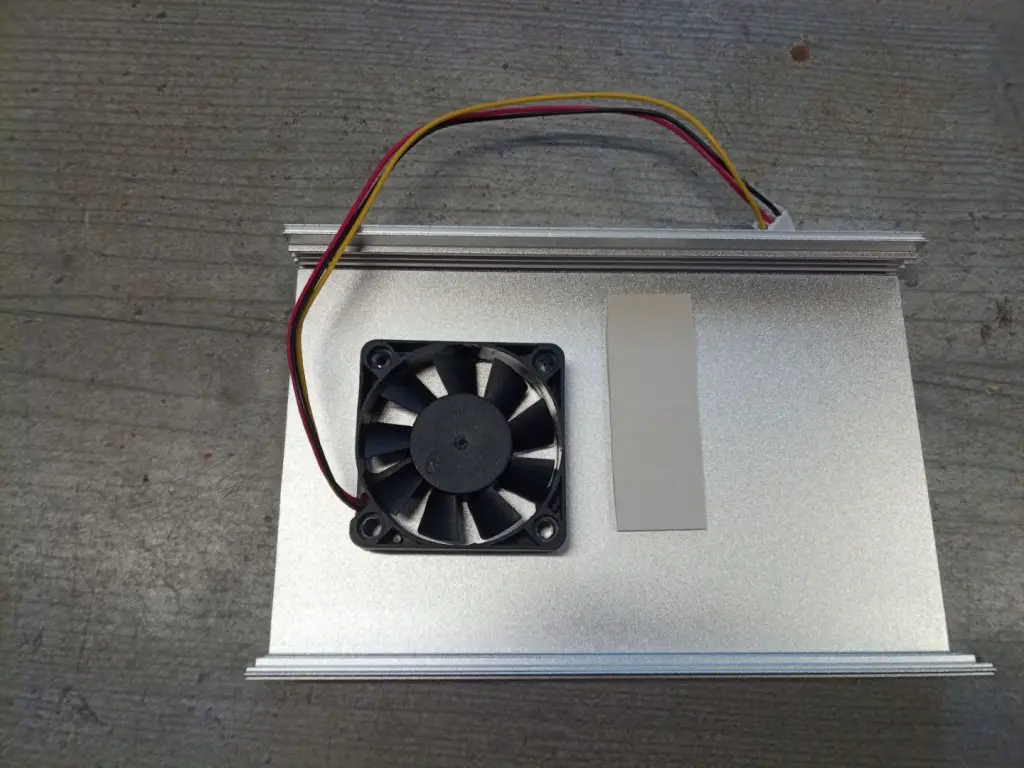
Dazu benötigen wir einen standardmäßigen 50mm Lüfter. Nichts besonderes, lediglich darauf achten, dass es eine flache Bauform mit etwa 10mm Dicke.
Hier mal ein Beispiellink mit 10 Stück im Set, da sich einzelne Lüfter kaum lohnen (es gibt auch 5er Sets). Passende Lüftungsgitter hier

was brauchen wir noch? Eine 50mm Bohrkrone. Diese hier ist nix besonderes, war ein Set aus dem Lidl gibt's aber auch auf eBay. Die sind oftmals als "HSS Bohrkrone" für alle Materialien gekennzeichnet. Das ist natürlich Quatsch, denn die sind im Grundenur für Holz oder Kuntstoff geeignet. Aber da das Gehäuse des GMI Wechselrichters aus dünnem Aluminium ist, welches zudem relativ weich ist geht das hier auch problemlos.
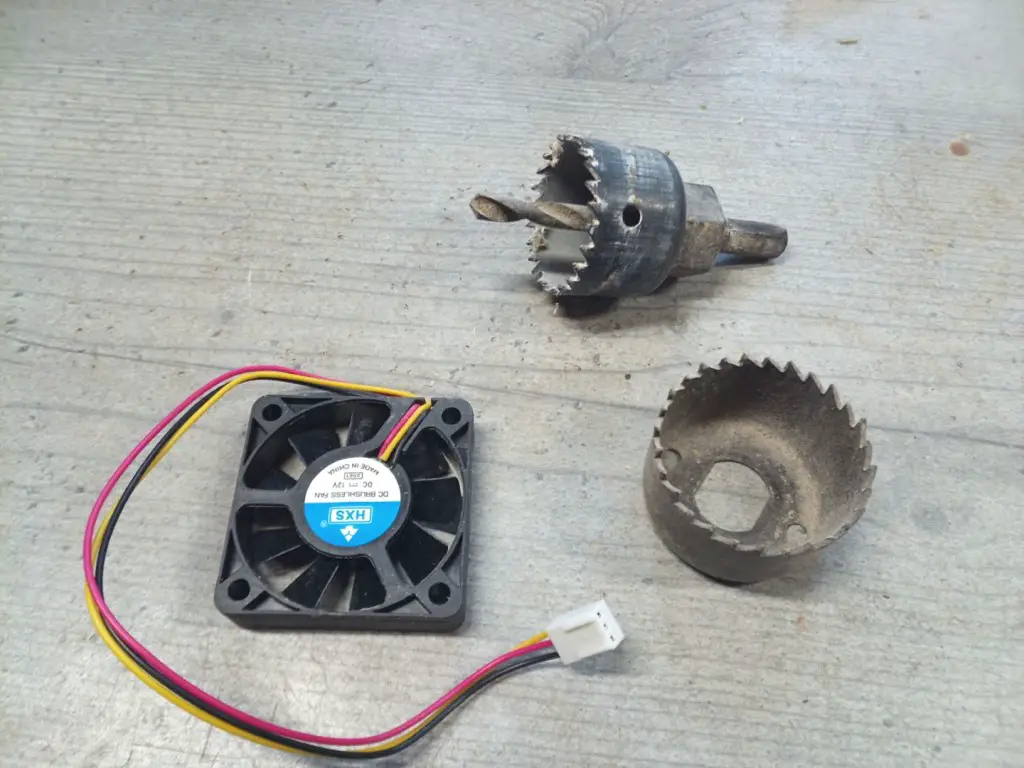
idealerweise ankörnen, wo Du bohren willst. Ideal ist mittig im Bereich der großen Spule da hier am meisten Platz ist

idealerweise mit einer Tischbohrmaschine auf langsamster Geschwindigkeit sachte bohren

den Gehäusedeckel dabei verkeilen oder einklemmen


mittlerweile habe ich drei Wechselrichtergehäuse gebohrt und die Bohrkrone ist noch immer scharf

dann den Lüfter auflegen, die vier Befestigungslöcher mit einem Stift markieren und die Montagelöcher vorbohren
Tipp: am besten "viel zu große" 6mm Löcher bohren denn da der Gehäusedeckel obenauf minimale Kühlrippen hat schafft man es nie, exakt zu bohren und durch die größeren Löcher gleicht sich das dann wieder aus, sodass die Bohrlöcher dann hinterher auch zum Lüfter passen
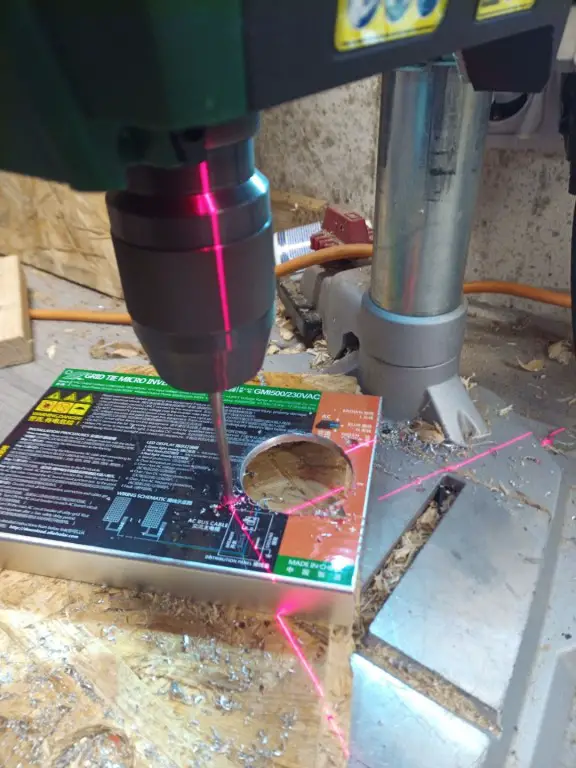
wenn wir schon am Bohren sind: seitlich im Vorderen Bereich jeweils vier Löcher mit dem 8mm Bohrer reinbohren. Dabei aufpassen, dass man nicht zu nah an die Kante kommt und die Führungsnut versaut, die die beiden Gehäusehälften zusammen hält
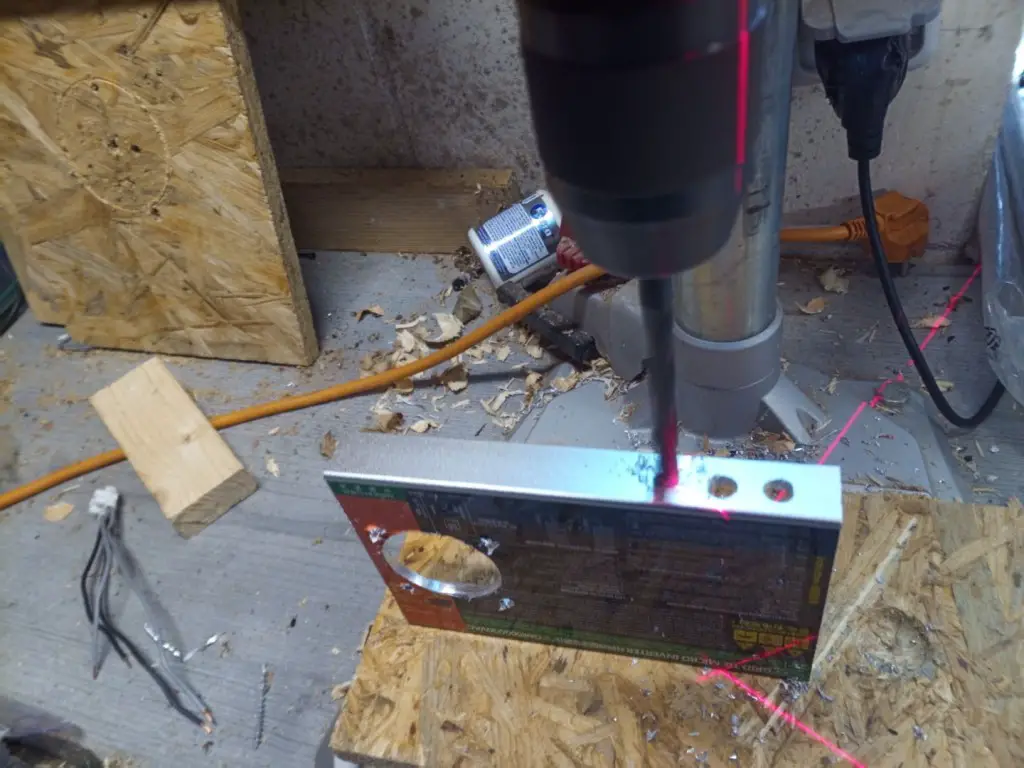
achja, an dieser Stelle nochmal der generelle Hinweis: auch ohne die eben gebohrten Zusatzlöcher sind die Wechselrichter der GMI-Serie in keinster Weise wasserdicht, auch wenn der Hersteller IP54 angibt. Er hat keinerlei Dichtungen oder sonstigen Feuchtigkeitsschutz. Überdacht oder unter den PV-Modulen montiert kann er im AUßenbereich eingesetzt werden, aber er muss sicher und Regen- sowie Spritzwassergeschützt montiert werden.
Daher machen ein paar extra Luftlöcher nun auch keinen Unterschied
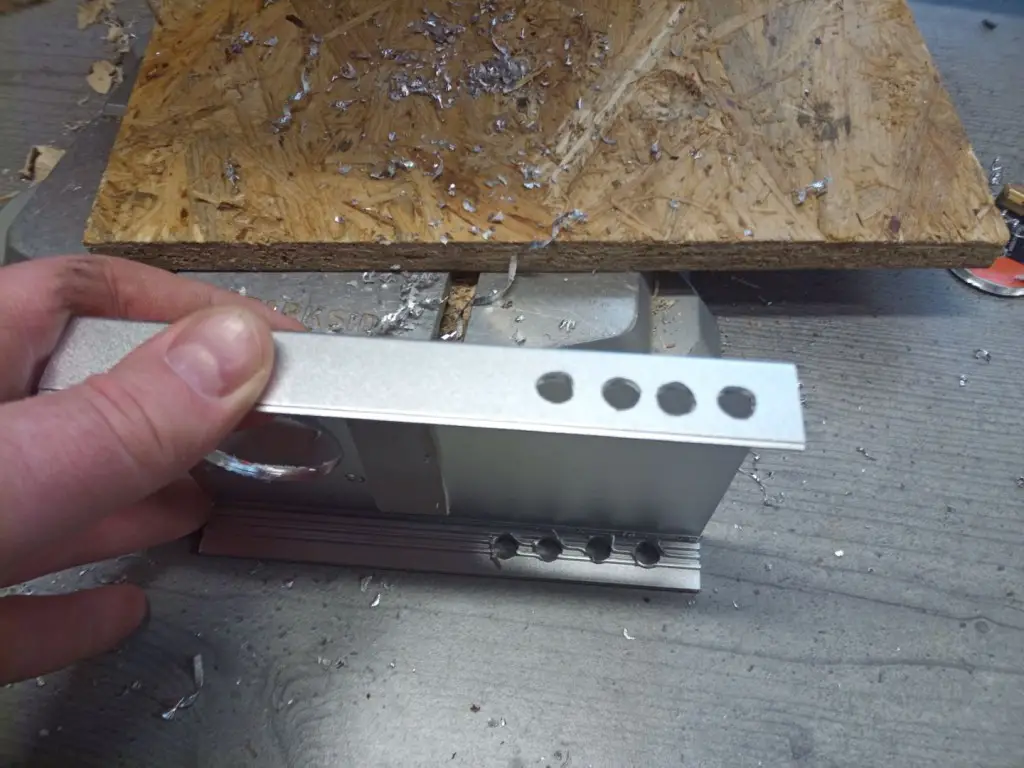
den Grat etwas glattfeilen

als Schrauben passen M5 x 20mm, ob Inbus / Seckskant / Kreuz ist egal
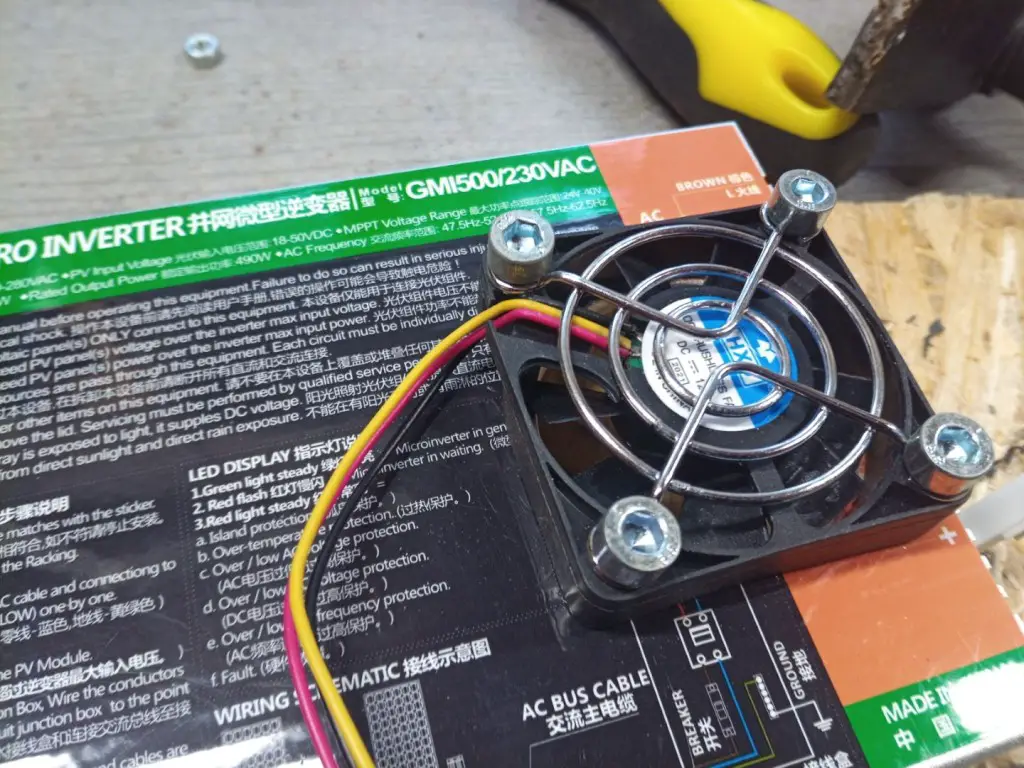
ich hatte nur diese M5 x 15mm zur Hand und die sind zu kurz, um noch Unterlegscheiben zu benutzen
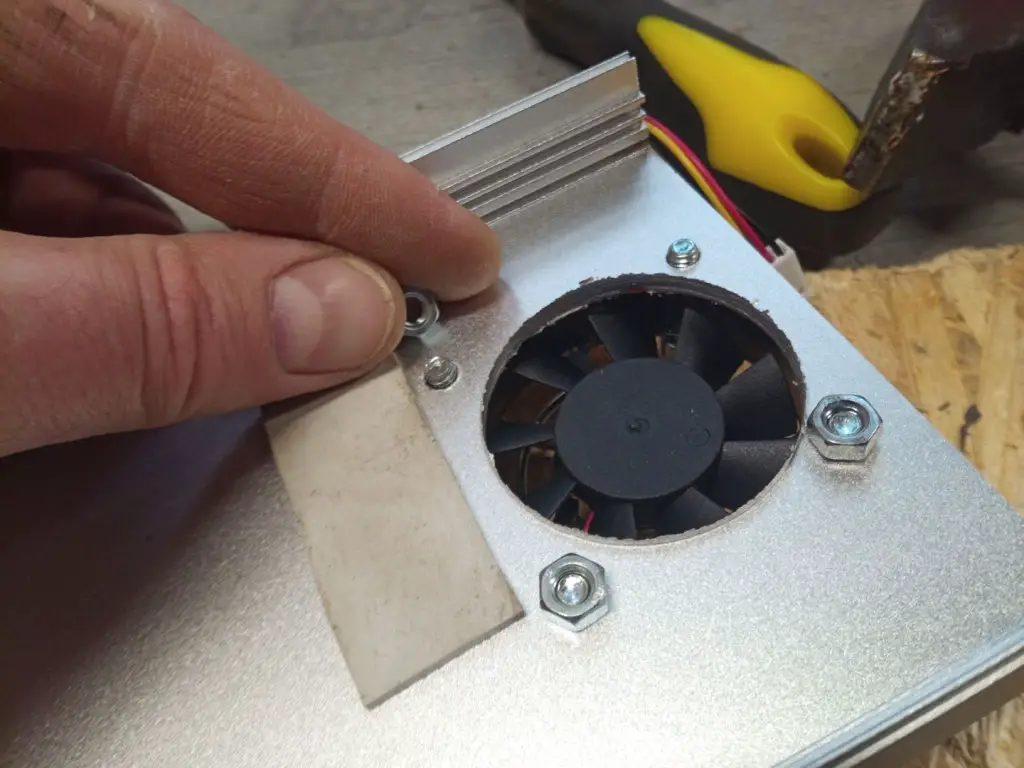
habe ich hier beim ersten Versuch nicht gemacht aber kann ich nur empfehlen: ein separates 6mm Loch um das Lüfterkabel nach innen zu führen
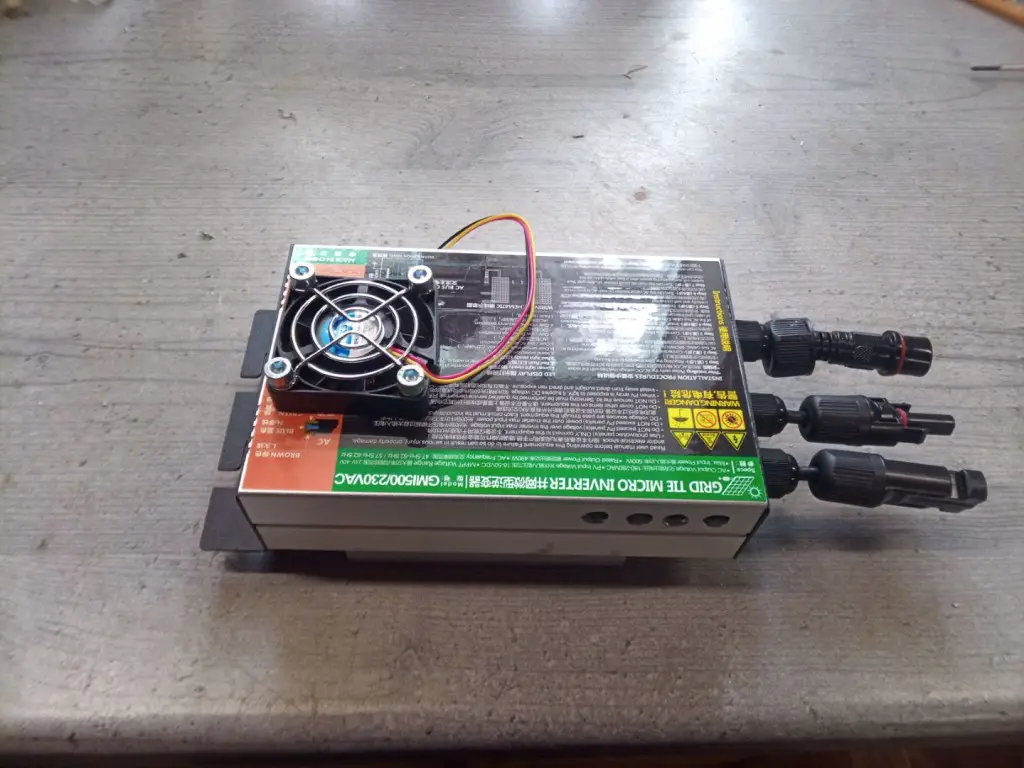
damit der 12V Lüfter nun mit Strom versorgt wird habe ich einfach einen kleinen DC-DC-Wandler gekauft. Den gibt's mit festen 12V oder 5V
wenn Du vor hast den GMI Wechselrichter
- voll aus zu lasten
- nicht an einem kühlen Ort wie z.B. Keller auf zu hängen
dann brauchst Du die Variante mit 12V, damit der Lüfter normal = auf voller Leistung dreht
Wenn Du den GMI kühl aufhängst und / oder nicht permanent voll belastest dann reicht der DC-DC-Wandler mit 5V, dann dreht der Lüfter langsamer
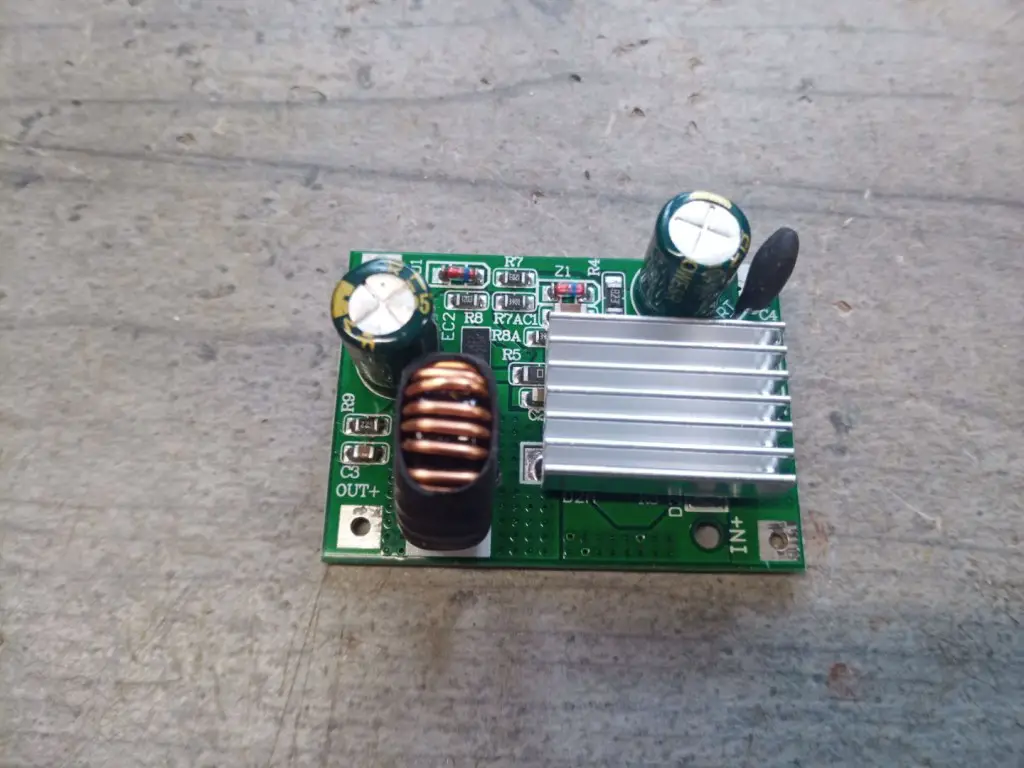
als Spannungsversorgung habe ich die beiden PV-Eingangskabel genommen und an den Knicken mit dem Cuttermesser ein Stückchen abisoliert sowie anschließend einen Tropfen Lötdraht aufgetragen
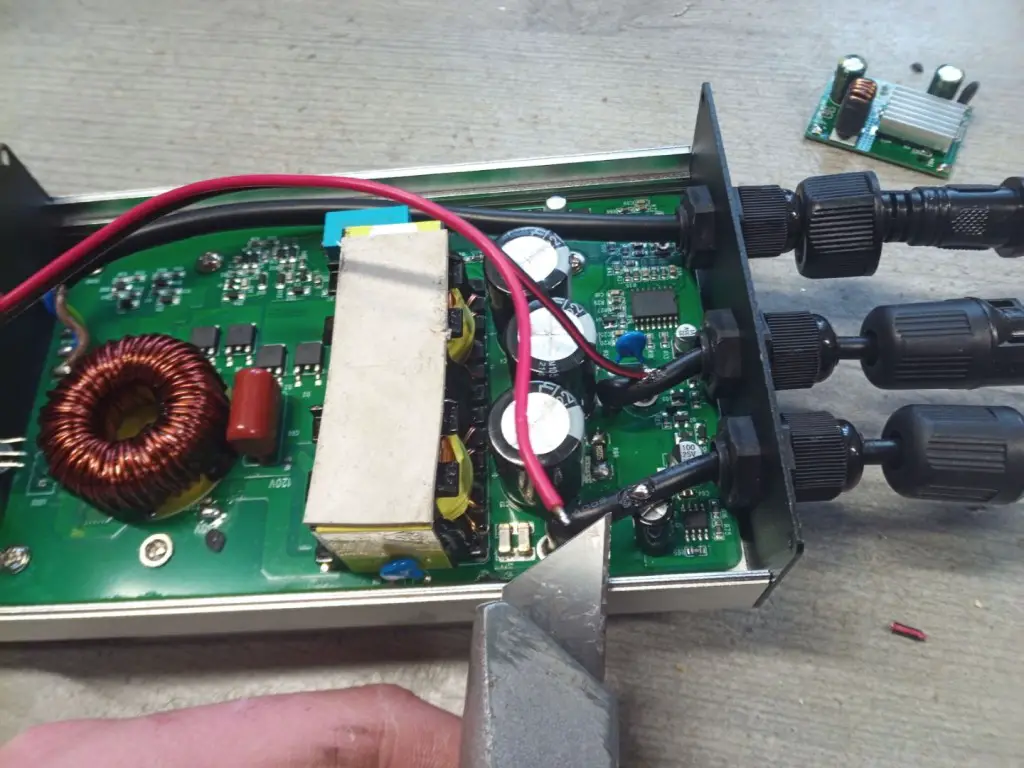
dann ein Stück Litzenkabel (2x 0,5 oder 0,75mm²) aufgelötet
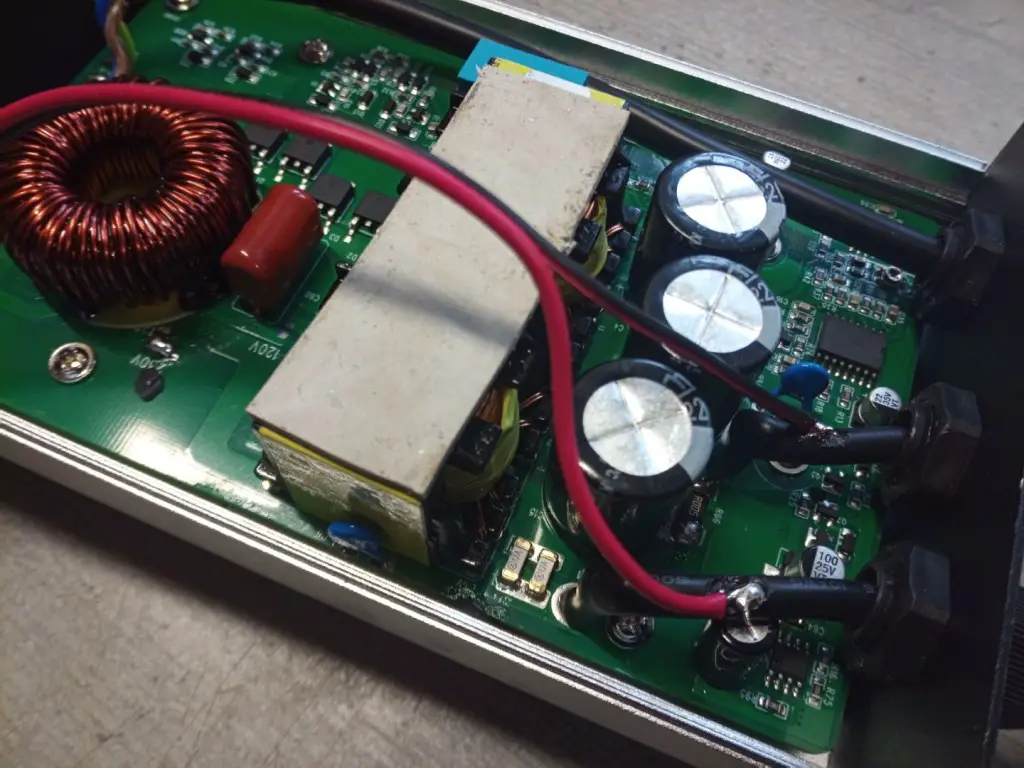
von da aus an den Eingang des DC-DC-Wandlers (Tipp: die Kabel etwas kürzer halten als auf diesem Bild, dann sind sie später leichter im Gehäuse zu verstauen)
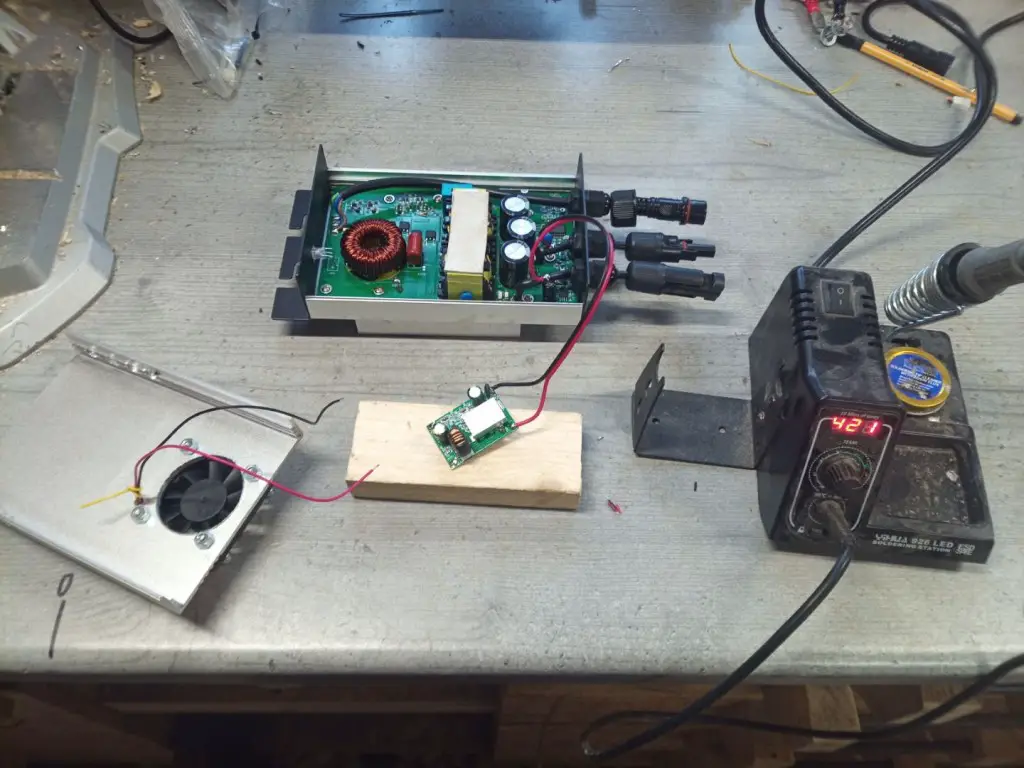
den Ausgang an den Lüfter und auf die Unterseite des DC-DC-Wandlers habe ich einfach einen ordentlichen Klecks Acryl (Silikon geht auch) aufgetragen
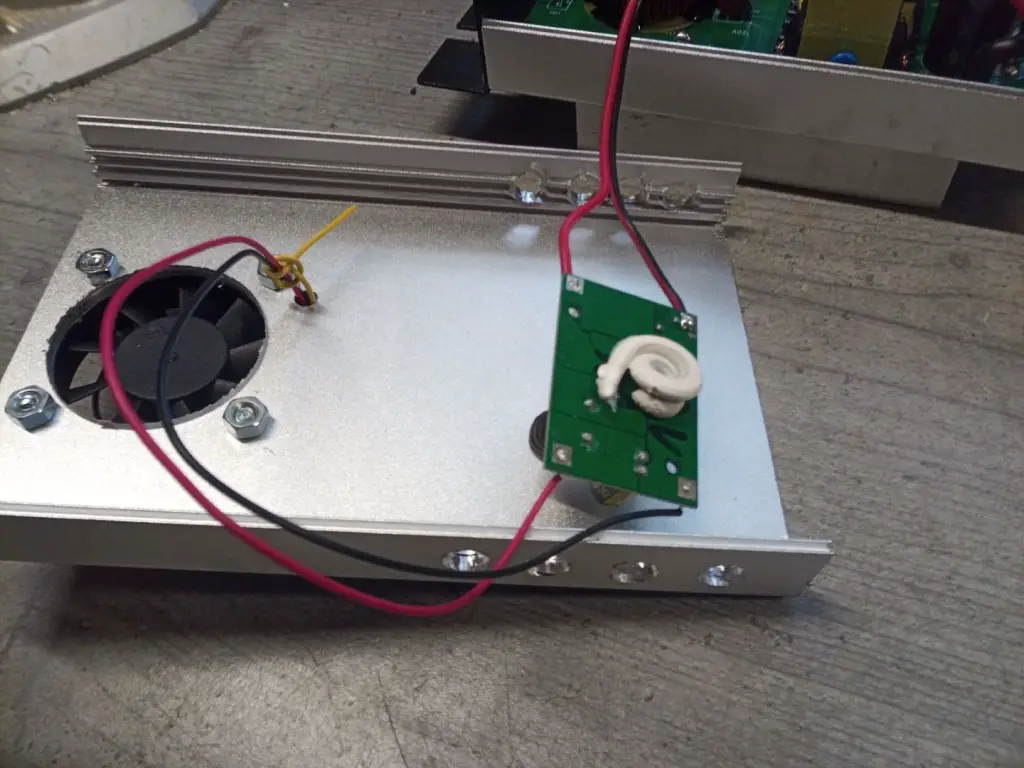
ins Eck so wie auf dem Bild, dabei nicht allzu fest andrücken, damit die Unterseite der Platine keinen Kontakt zum Alugehäuse hat. Dann ebenfalls über Nacht durchhärten lassen
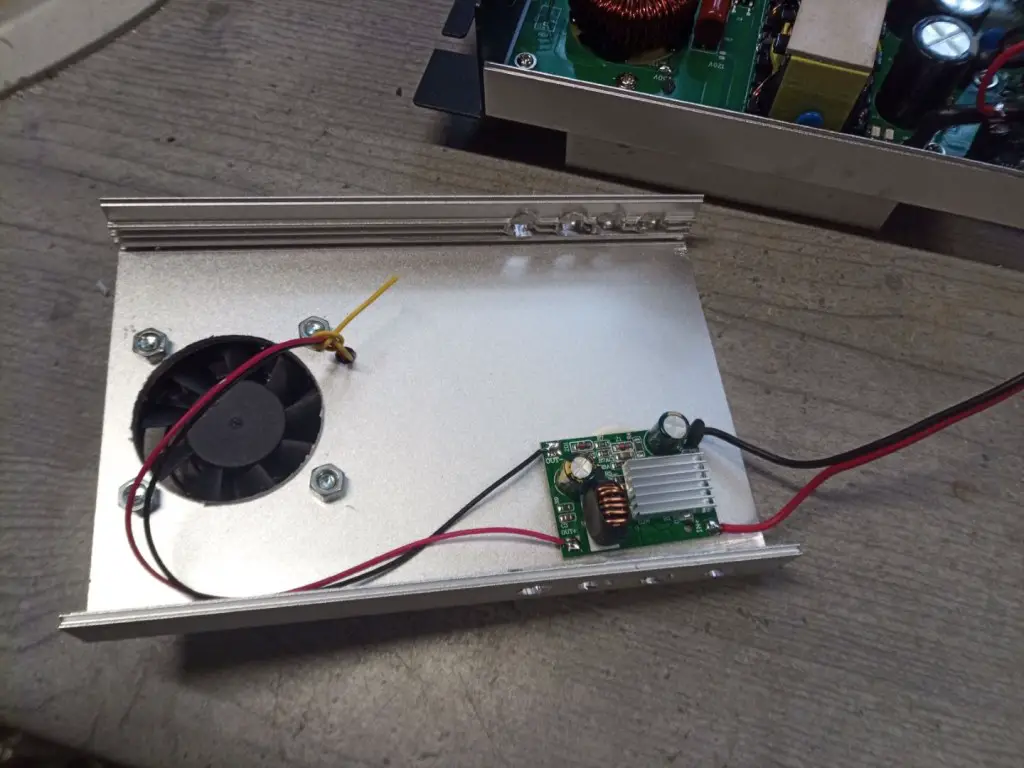
wenn alles durchgehärtet ist sieht das dann so aus. Hier erkennt man auch gut, dass idh cid Kabel (hier mein erster Versuch) zu lange gelassen habe und die nun stören, deswegen: kürzer abschneiden

Deckel drauf - passt

ob der Lüfter nun die warme Luft raus saugt (so wie hier auf dem Bild) oder andersrum montiert ist und frische Luft rein bläst sollte bei dieser Einbauart relativ egal sein

Bei der Montage darauf achten, dass genügend Abstand zur dahinterliegenden Wand ist, sodass der Kühlkörper auch ausreichend Frischluft ab bekommt. Dazu am besten ein Stück Dachlatte / Brett / ein Holzklotz unter die Montagelaschen packen.
2.9 Fehlerdiagnose & Reparaturanleitung MosFETs tauschen
Inhaltsverzeichnis:
1. WVC / SG Mikrowechselrichter
2. GMI Serie Grid Tie Micro Inverter
2.1 Modelle
2.2 Preise
2.3 technische Daten & Ausstattung
2.4 Handbuch / Datenblatt
2.5 Wasserdicht
2.6 Überhitzung
2.6.1 Nachtrag: erste Erfahrungen im laufenden Betrieb
2.6.2 mein Fazit zur Temperatur
2.7 Erfahrungsberichte / Tests
2.7.1 großer Test mit 4 unterschiedlichen GMI
2.7.2 weitere Tests
2.8 GMI 500 / 600 / 700
2.8.1 passiver Aluminium-Kühlkörper anbringen
2.8.2 Lüfter, DC-DC-Wandler & Belüftungslöcher
2.9 Fehlerdiagnose & Reparaturanleitung MosFETs tauschen
2.9.1 die Status-LED leuchtet dauerhaft rot
2.9.2 die Status-LED leuchtet dauerhaft garnicht
Wenn die GMI Wechselrichter einmal kaputt gehen dann ist meistens einer der Leistungstranistoren defekt.
Pro:
- man benötigt kein Spezialwerkzeug zum Testen, anhand der Status-LED kann man den defekten Tranistor ausfindig machen
- man kann die Tranistoren (MosFETs) selbst tauschen und somit den GMI reparieren
- es gibt Ersatzteile dafür und diese sind sehr preiswert
Contra:
- etwas fummelig, ein wenig Geschick oder Geduld muss man mitbringen
Fehlerdiagnose:
Die GMI haben, wie jeder Solar-Wechselrichter, MosFETs auf der DC-Seite = am Eingang der PV-Module sowie andere MosFETs auf der AC-Seite = am 230V Spannungsausgang zum Netz hin.
Beide Arten können mal kaputt gehen und es gibt unterschiedliche LED-Codes der Status-LED dafür.

2.9.1 die Status-LED leuchtet dauerhaft rot
Inhaltsverzeichnis:
1. WVC / SG Mikrowechselrichter
2. GMI Serie Grid Tie Micro Inverter
2.1 Modelle
2.2 Preise
2.3 technische Daten & Ausstattung
2.4 Handbuch / Datenblatt
2.5 Wasserdicht
2.6 Überhitzung
2.6.1 Nachtrag: erste Erfahrungen im laufenden Betrieb
2.6.2 mein Fazit zur Temperatur
2.7 Erfahrungsberichte / Tests
2.7.1 großer Test mit 4 unterschiedlichen GMI
2.7.2 weitere Tests
2.8 GMI 500 / 600 / 700
2.8.1 passiver Aluminium-Kühlkörper anbringen
2.8.2 Lüfter, DC-DC-Wandler & Belüftungslöcher
2.9 Fehlerdiagnose & Reparaturanleitung MosFETs tauschen
2.9.1 die Status-LED leuchtet dauerhaft rot
2.9.2 die Status-LED leuchtet dauerhaft garnicht
Dann sind die AC-MosFETs defekt und müssen ausgetauscht werden. Wenn Du möchtest kannst Du das auch zusätzlich überprüfen, indem Du den GMI vom Netz und von den PV-Modulen trennst und dann mit einem Multimeter den Widerstand am 230V AUsgang des GMI zwischen L und N misst. Dieser sollte, wenn der Wechselrichter in Ordnung ist, annähernd unendlich groß sein.
Bei einem Defekt an den AC-MosFETs schalten diese durch, es ist dann ein dauerhafter Kurzschluss und der Widerstand ist dementsprechend annähernd Null Ohm.also sehr, sehr klein.
Ersatz-MosFETs:
Diese MosFETs gibt es passend für alle GMI Modelle als Ersatz im Set mit der dazugehörigen Sicherung auf Aliexpress.
entweder bei Y&H Yong Hui oder bei Jesudom
Hier habe ich mal bei einem GMI 260 / 300 / 350 als Übersicht einskizziert, wo die MosFETs sitzen
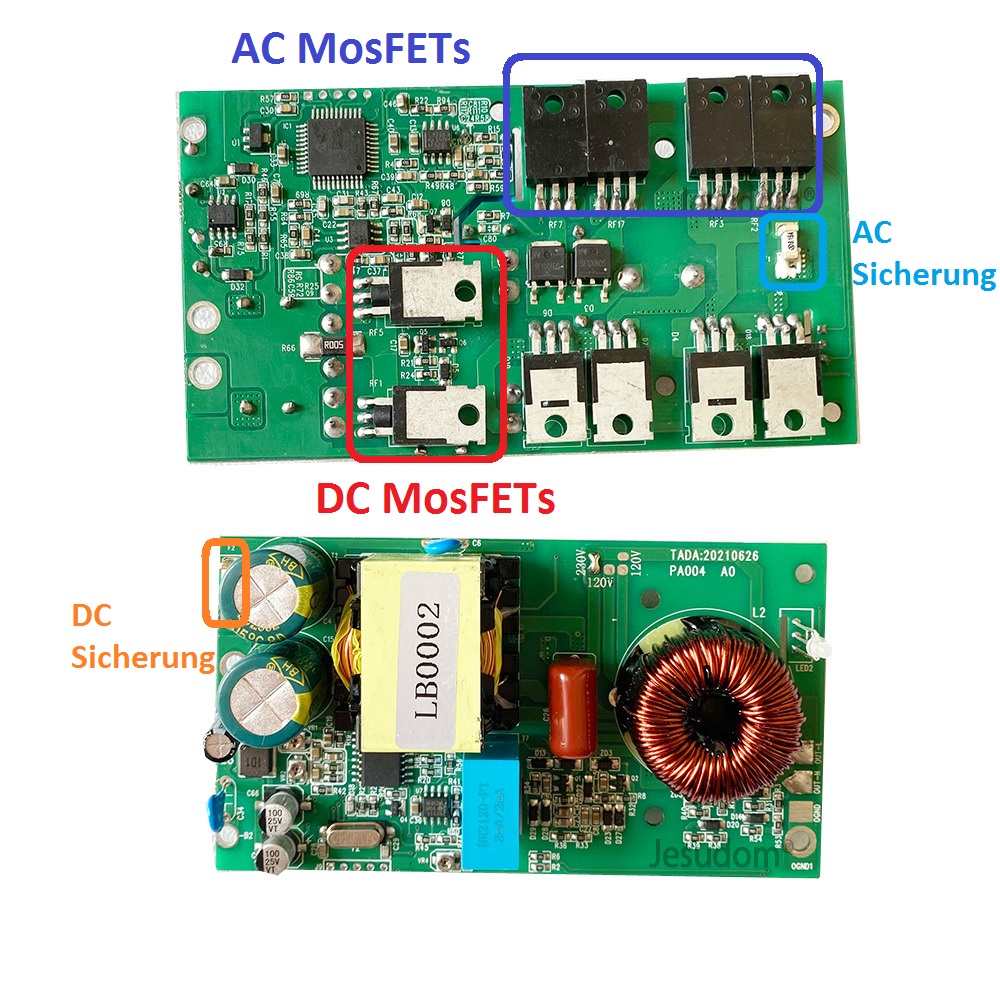
Benötigtes Werkzeug:
Hier das empfohlene Werkzeug für die Lötarbeiten, das ich selbst auch benutze (falls Du sowas nicht bereits hast):
60 Watt Lötstation auf Aliexpress / Amazon / eBay

Lötabsaugung / Rauchabzug auf eBay oder Aliexpress

Löthilfe / Dritte Hand (auf schraubbare Klemme achten) auf Aliexpress / Amazon / eBay
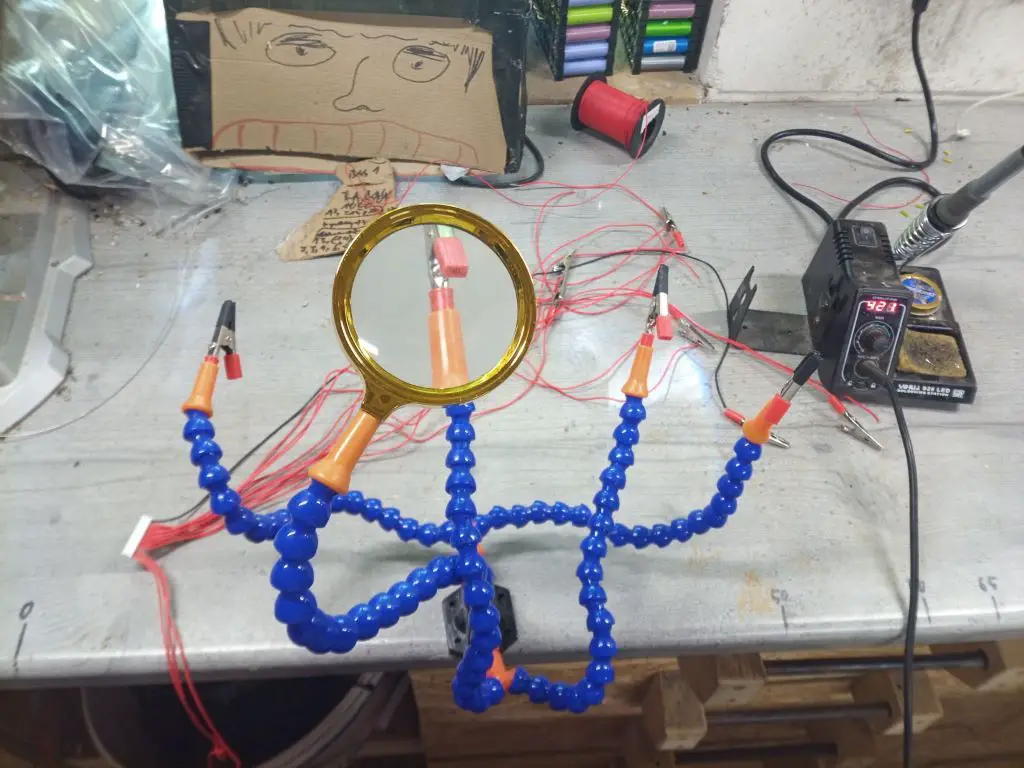
abgewinkelte Spitzzange (= Telefonzange) mit 180 oder 200mm auf Amazon / eBay

Entlötpumpe ideal um MosFETs auszulöten auf eBay / Amazon / Aliexpress

Reparaturanleitung als Video:
Es gibt auch zu jedem der GMI Modelle eine Reparaturanleitung als Video in meiner Playlist auf Youtube
Falls der Wechselrichter nicht mehr zu reparieren sein sollte:
Hier meine Bezugsquellen für die verschiedenen GMI Micro Inverter
- 120W / 150W / 180W Modelle auf Aliexpress / Amazon / eBay
- 260W / 300W / 350W Modelle auf Aliexpress / Amazon / eBay
- 500W / 600W / 700W Modelle auf Aliexpress / Amazon / eBay
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
2.9.2 die Status-LED leuchtet dauerhaft garnicht
Inhaltsverzeichnis:
1. WVC / SG Mikrowechselrichter
2. GMI Serie Grid Tie Micro Inverter
2.1 Modelle
2.2 Preise
2.3 technische Daten & Ausstattung
2.4 Handbuch / Datenblatt
2.5 Wasserdicht
2.6 Überhitzung
2.6.1 Nachtrag: erste Erfahrungen im laufenden Betrieb
2.6.2 mein Fazit zur Temperatur
2.7 Erfahrungsberichte / Tests
2.7.1 großer Test mit 4 unterschiedlichen GMI
2.7.2 weitere Tests
2.8 GMI 500 / 600 / 700
2.8.1 passiver Aluminium-Kühlkörper anbringen
2.8.2 Lüfter, DC-DC-Wandler & Belüftungslöcher
2.9 Fehlerdiagnose & Reparaturanleitung MosFETs tauschen
2.9.1 die Status-LED leuchtet dauerhaft rot
2.9.2 die Status-LED leuchtet dauerhaft garnicht
Dann sind die DC-MosFETs defekt und müssen ausgetauscht werden. Wenn Du möchtest kannst Du das auch zusätzlich überprüfen, indem Du den GMI vom Netz und von den PV-Modulen trennst und dann mit einem Multimeter den Widerstand am PV-Eingang des GMI zwischen + und - misst. Dieser sollte, wenn der Wechselrichter in Ordnung ist, annähernd unendlich groß sein.
Bei einem Defekt an den DC-MosFETs schalten diese durch, es ist dann ein dauerhafter Kurzschluss und der Widerstand ist dementsprechend annähernd Null Ohm also sehr, sehr klein.
Ersatz-MosFETs:
Diese MosFETs gibt es passend für alle GMI Modelle als Ersatz im Set mit der dazugehörigen Sicherung auf Aliexpress.
entweder bei Y&H Yong Hui oder bei Jesudom
Hier habe ich mal bei einem GMI 260 / 300 / 350 als Übersicht einskizziert, wo die MosFETs sitzen
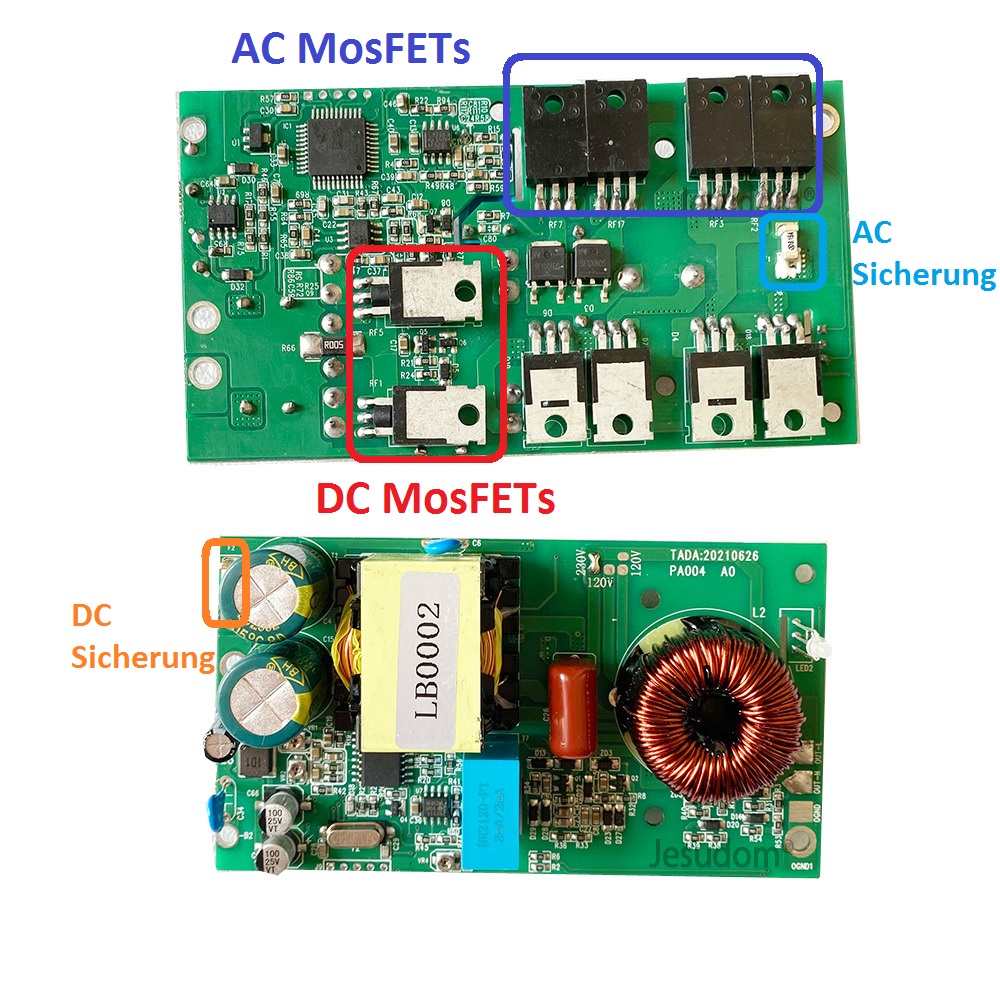
Benötigtes Werkzeug:
Hier das empfohlene Werkzeug für die Lötarbeiten, das ich selbst auch benutze (falls Du sowas nicht bereits hast):
60 Watt Lötstation auf Aliexpress / Amazon / eBay

Lötabsaugung / Rauchabzug auf eBay oder Aliexpress

Löthilfe / Dritte Hand (auf schraubbare Klemme achten) auf Aliexpress / Amazon / eBay
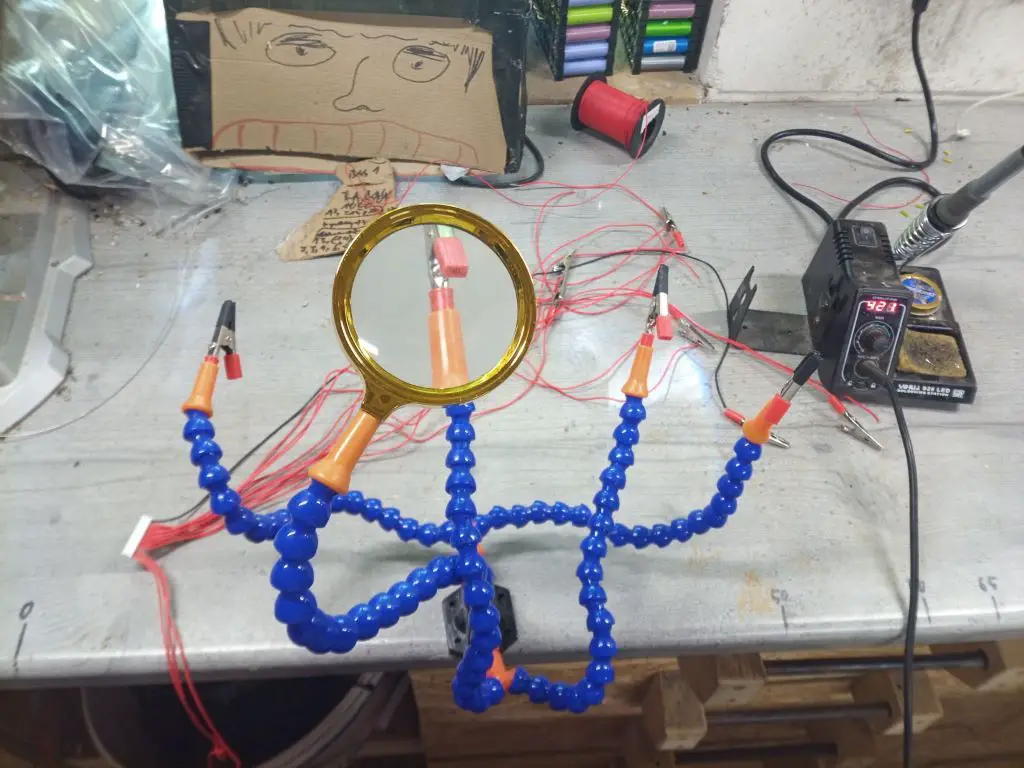
abgewinkelte Spitzzange (= Telefonzange) mit 180 oder 200mm auf Amazon / eBay

Entlötpumpe ideal um MosFETs auszulöten auf eBay / Amazon / Aliexpress

Reparaturanleitung als Video:
Es gibt auch zu jedem der GMI Modelle eine Reparaturanleitung als Video in meiner Playlist auf Youtube
Falls der Wechselrichter nicht mehr zu reparieren sein sollte:
Hier meine Bezugsquellen für die verschiedenen GMI Micro Inverter
- 120W / 150W / 180W Modelle auf Aliexpress / Amazon / eBay
- 260W / 300W / 350W Modelle auf Aliexpress / Amazon / eBay
- 500W / 600W / 700W Modelle auf Aliexpress / Amazon / eBay
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
3 PVGS Serie
Inhaltsverzeichnis:
1. WVC / SG Mikrowechselrichter
2. GMI Serie Grid Tie Micro Inverter
3. PVGS Serie
3.1. Lüfter
3.2. Fazit
3.3. Handbücher
Die Mikrowechselrichter der PVGS Serie sind verwandt mit der GMI Serie (s. weiter oben)

Der größte Unterschied zur GMI-Serie ist, dass die PVGS eine höhere PV-Eingangsspannung vertragen, nämlich maximal 60V anstatt der 50V bei der GMI Serie.
Die restlichen technischen Daten sind identisch, der innere Aufbau auch, ebenso die thermischen Probleme im Auslieferungszustand.
Von den PVGS gibt es drei Versionsreihen:
- 120 / 150 / 180 = 150W Leistung auf Aliexpress / eBay
- 260 / 300 / 350 = 300W Leistung auf Aliexpress / eBay
- 500 / 500 / 700 = 600W Leistung auf Aliexpress / eBay
Die ganz kleinen haben einen kleineren PV-Eingangsspannungsbereich von 10,5 -30V
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
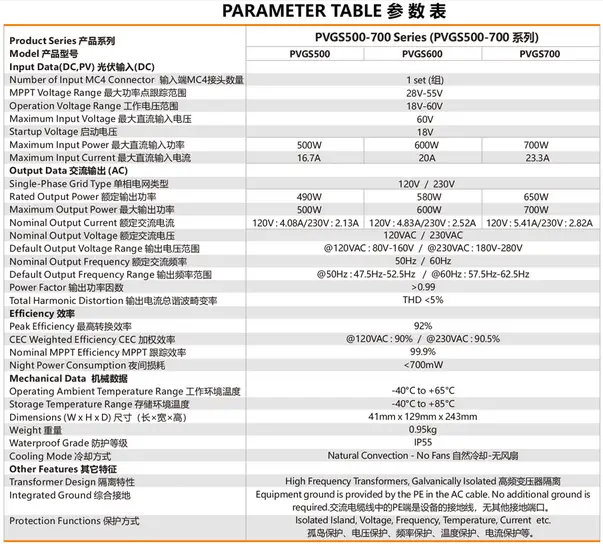
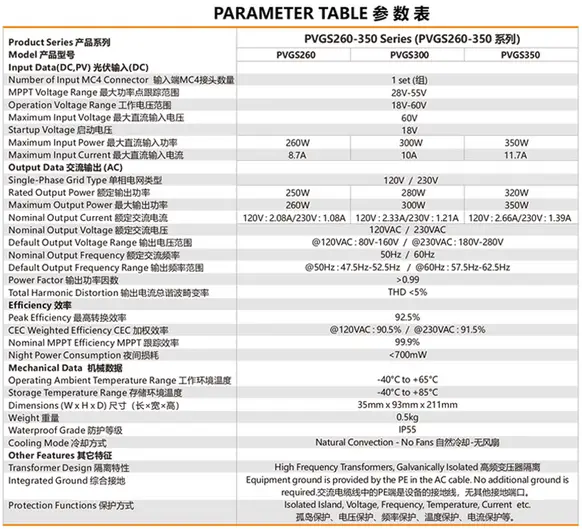
Von den PVGS 500 habe ich mittlerweile nun auch zwei im Einsatz, geliefert werden sie so

wie bei den GMI auch sind die technischen Daten obenauf geklebt
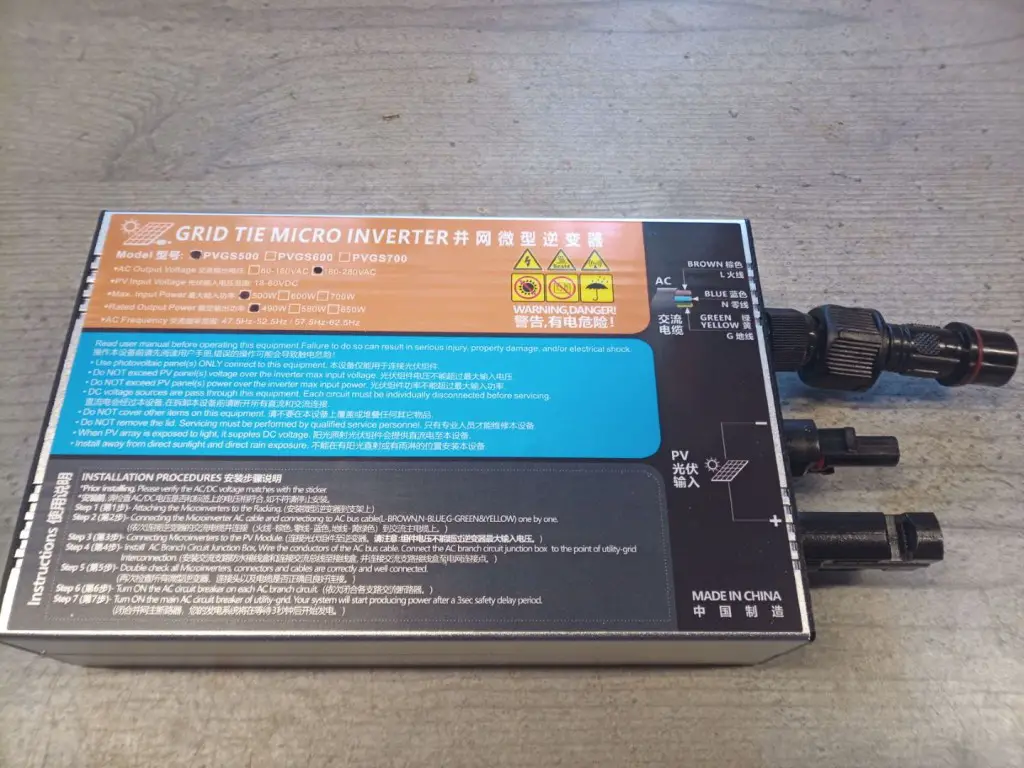
hier sieht man den zweiten Unterschied zu den GMI: die Befestigungslasche ist seitlich und nicht mehr bei den Anschlüssen - was nun eine einfachere Montage ermöglicht

dritter und letzter Unterschied: die MC4-Anschlüsse sind nun fest verschraubt und ohne Kabelstummel - was nicht so toll ist da die sehr eng sitzen und ein ABziehen der MC4-Kabel nun arg fummelig wird

die äußeren ABmaße sind ansonsten identisch zu den GMI Modellen

Status LED

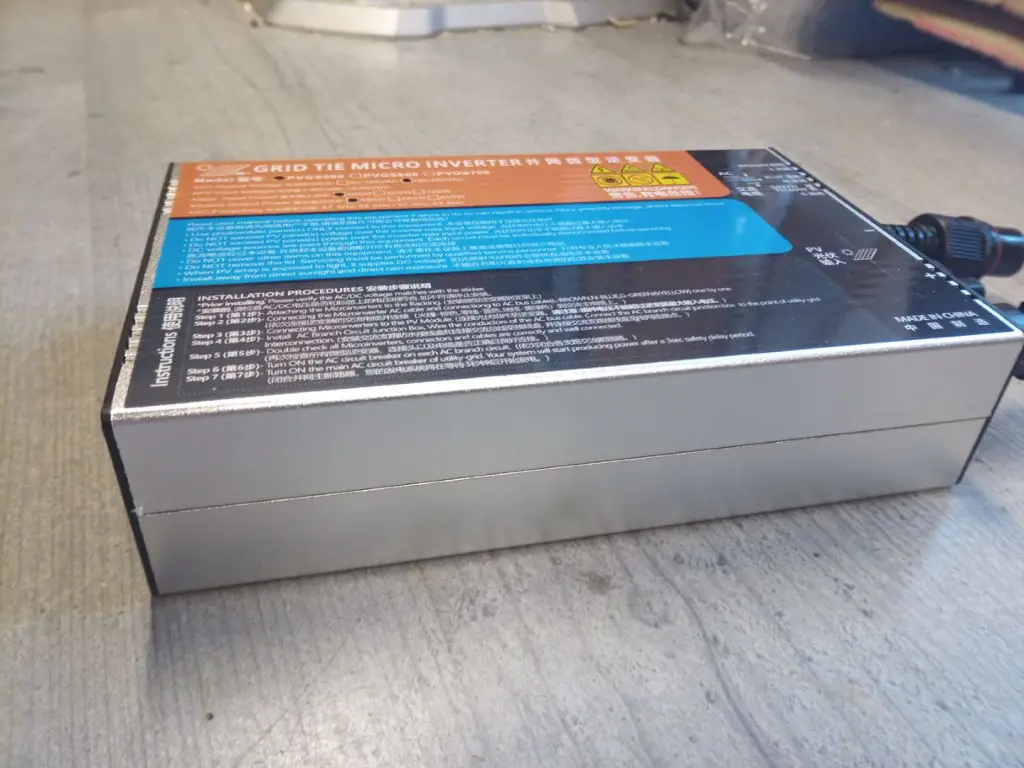
Unterseite
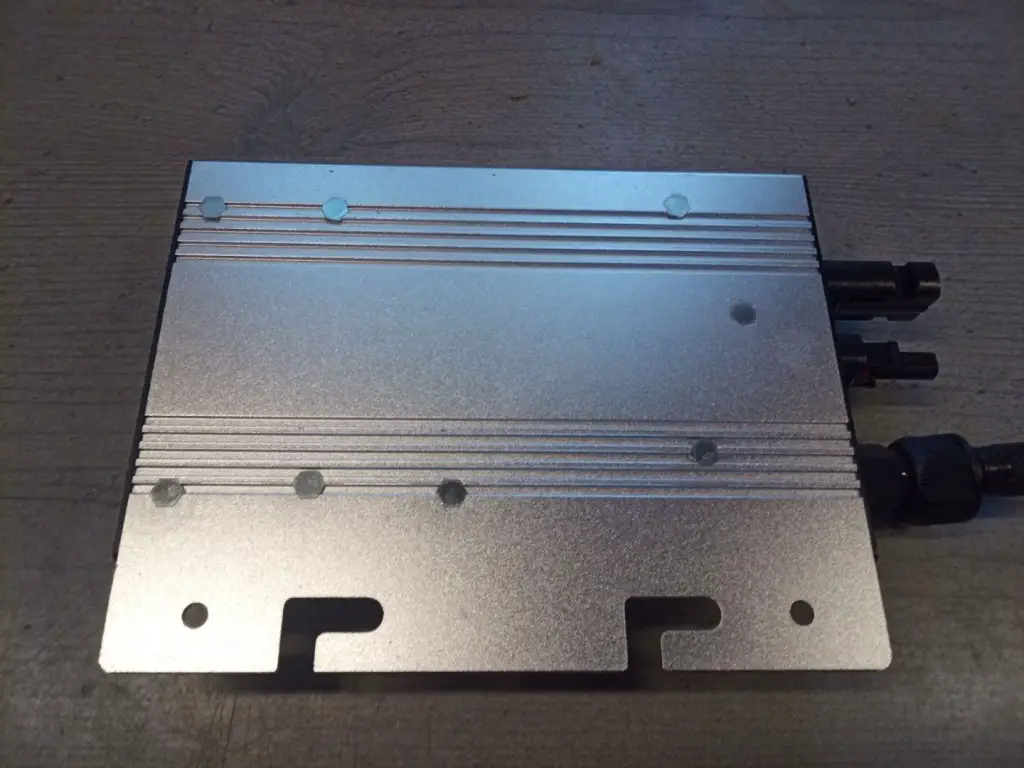
auch hier: zum Reinschrauben auf beiden seiten je die zwei oberen Schrauben lösen, dann kann man den Deckel abheben

das Innere ist identisch aufgebaut wie beim GMI

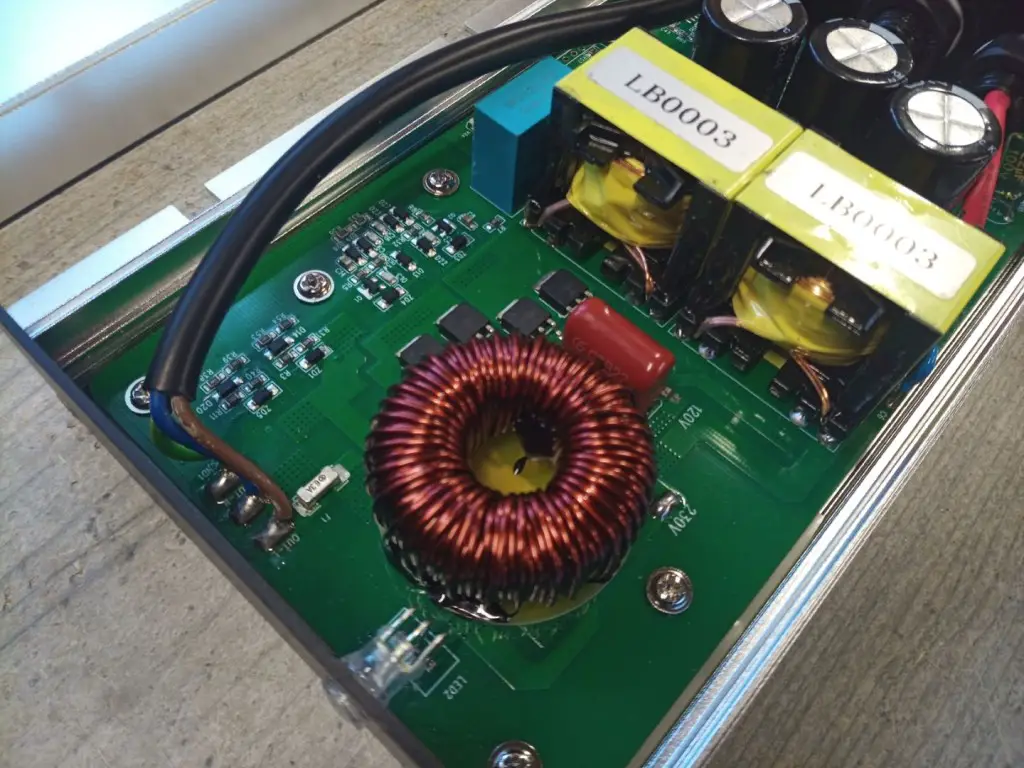
sogar die Eingangsspannungskondensatoren sind lediglich bis 50V spezifiziert.
Ich als Laie kann also nicht erkennen, wo genau die technischen Unterschiede liegen. Aber da ich ein paar gebrauchte PV-Module habe, die mit 35V MPPT Spannung gekennzeichnet sind und bei kühlen 5°C Außentemperatur bereits 58V Leerlaufspannung haben - und dadurch bereits zwei meiner SoyoSource 600W Wechselrichter gekillt haben hab ich nun diesen PVGS Wechselrichter gekauft, der die 60V EIngangsspannung aushalten soll. Falls nicht, wird er getauscht aber bislang hält er mal gut durch

3.1 Lüfter
Inhaltsverzeichnis:
1. WVC / SG Mikrowechselrichter
2. GMI Serie Grid Tie Micro Inverter
3. PVGS Serie
3.1. Lüfter
3.2. Fazit
3.3. Handbücher
Zwar habe ich beim PVGS auch einen passiven Kühlkörper aufgeklebt, aber davon habe ich keine Bilder gemacht. Da es aber dasselbe Prozedere ist wie beim GMI kannst Du einfach hier nachschauen.
Hier nochmal die Anleitung, wie man einen aktiven Lüfter nachrüstet, damit der Wechselrichter auch dauerhaft auf voller Leistung laufen kann ohne, dass er überhitzt.
Dieses Mal zuerst mit einem 8mm Bohrer je vier Löcher seitlich in die obere Gehäusehälfte bohren, und zwar im vorderen Bereich wo die Anschlüsse sitzen

dann brauchen wir an Material:
- 50mm Lüfter mit 10mm Bauhöhe
- Lüftungsgitter
- 50mm HSS Bohrkrone
- DC-DC-Wandler mit festen 12V oder 5V
- je 4 Schrauben M5 x 20mm / Unterlegscheiben / Muttern
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
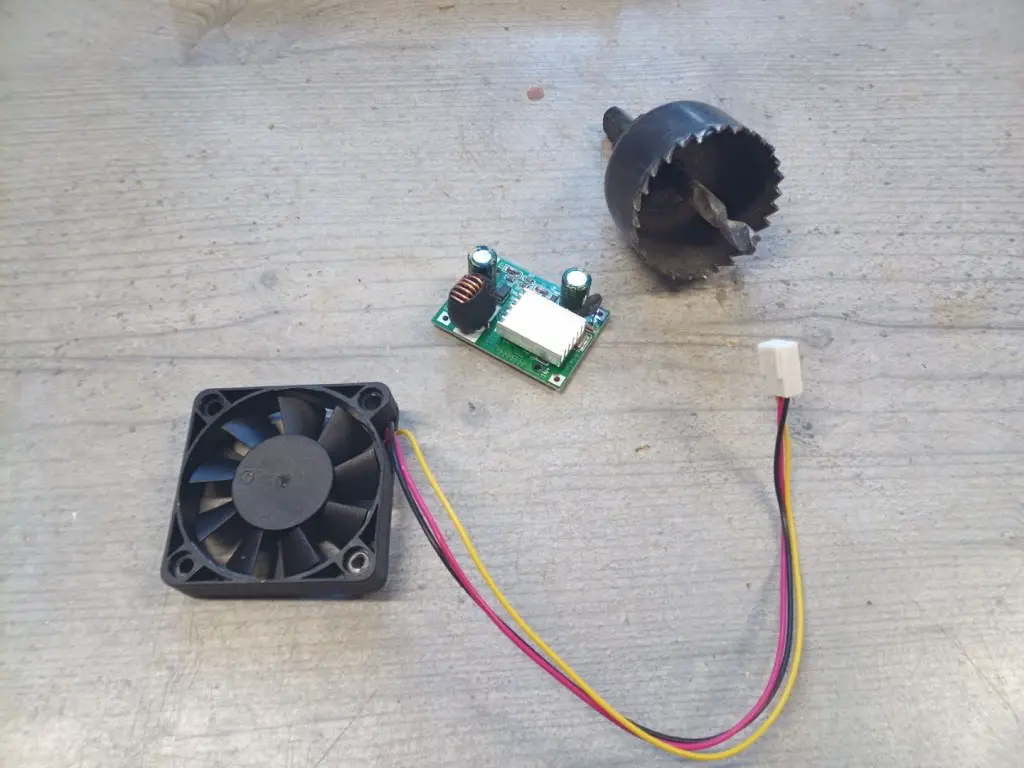
beim Bohren des 50mm Lochs den Gehäusedeckel verkeilen oder gut festhalten & die Bohrmaschine auf niedrigste Umdrehung einstellen



Tipp1: das Lüfterkabel nicht wie hier durch das große Loch führen = Lüfterblätter können daran schleifen, sondern ein extra Loch bohren und das Kabel dort durch ziehen
Tipp2: die Löcher für die Lüftergitterbefestigung nicht mit 5mmsondern mit 6mm bohren, dadurch hat man etwas Spiel, um ein ungenaues Bohren bedingt durch die Kühlrippen aus zu gleichen
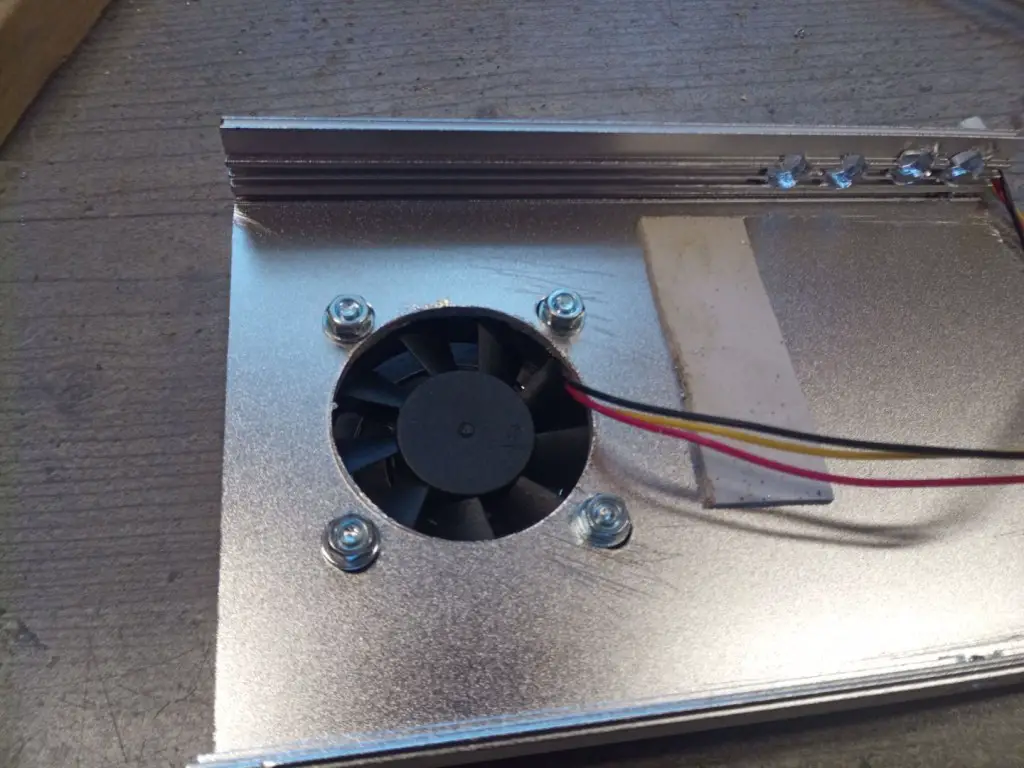
mit dem Teppichmesser die beiden PV-Eingangskabel oberhalb etwas abisolieren

einen Lötklecks drauf
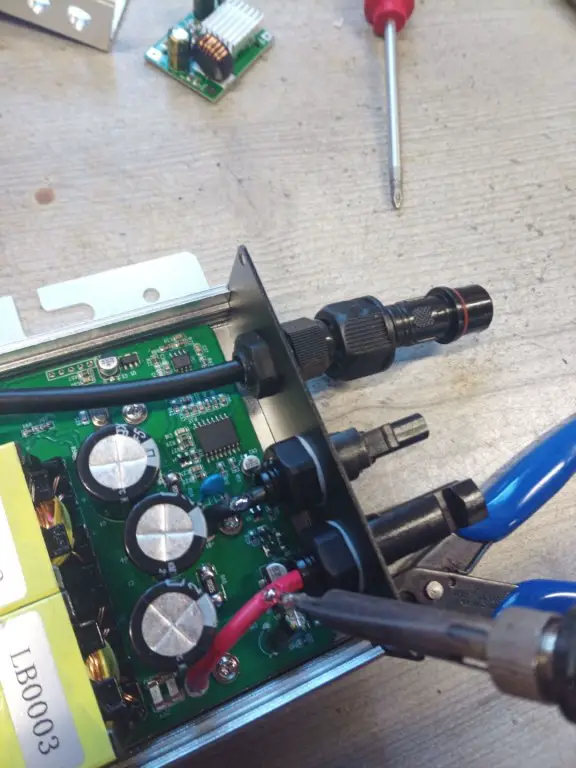
halbwegs kurze Kabel benutzen, damit diese später beim Zusammenbau nicht stören
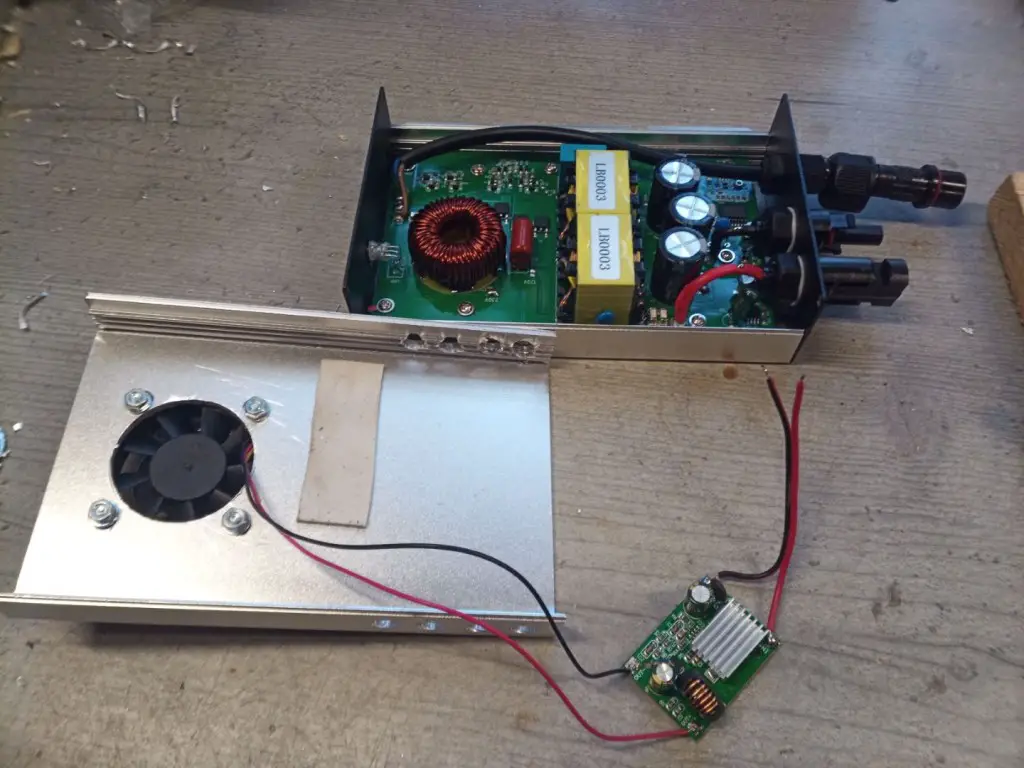
wenn der Wechselrichter später an einem warmen Ort sitzt und / oder regelmäßig mit voller Leistung läuft dann unbedingt den DC-DC-Wandler mit 12V Ausgangsspannung nehmen.
Bei kühlem Aufstellungsort und / oder wenn der PVGS nicht permanent ausgelastet ist reicht auch der DC-DC-Wandler mit 5V = der Lüfter dreht dann langsamer

um den DC-DC-Wandler zu montieren benutze ich einen Klecks Acryl. Den Wandler sachte andrücken, sodass die Platine nicht an das Alugehäuse kommt
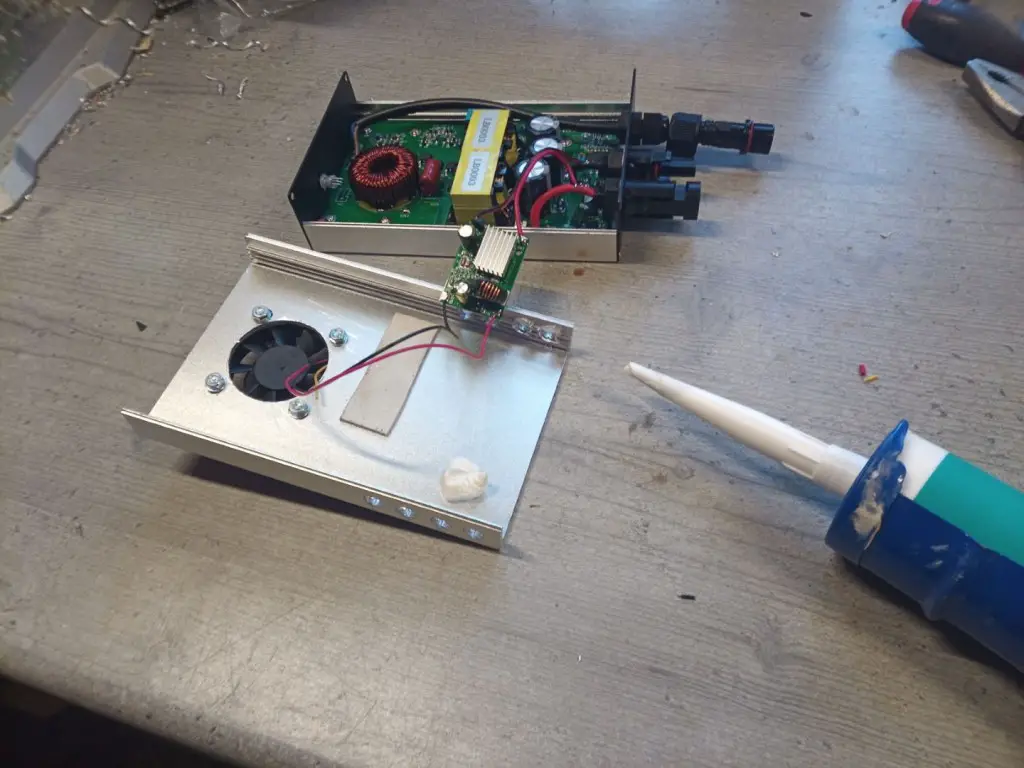
beim Zusammenbau darauf achten, dass keine Kabel irgendwo eingeklemmt sind
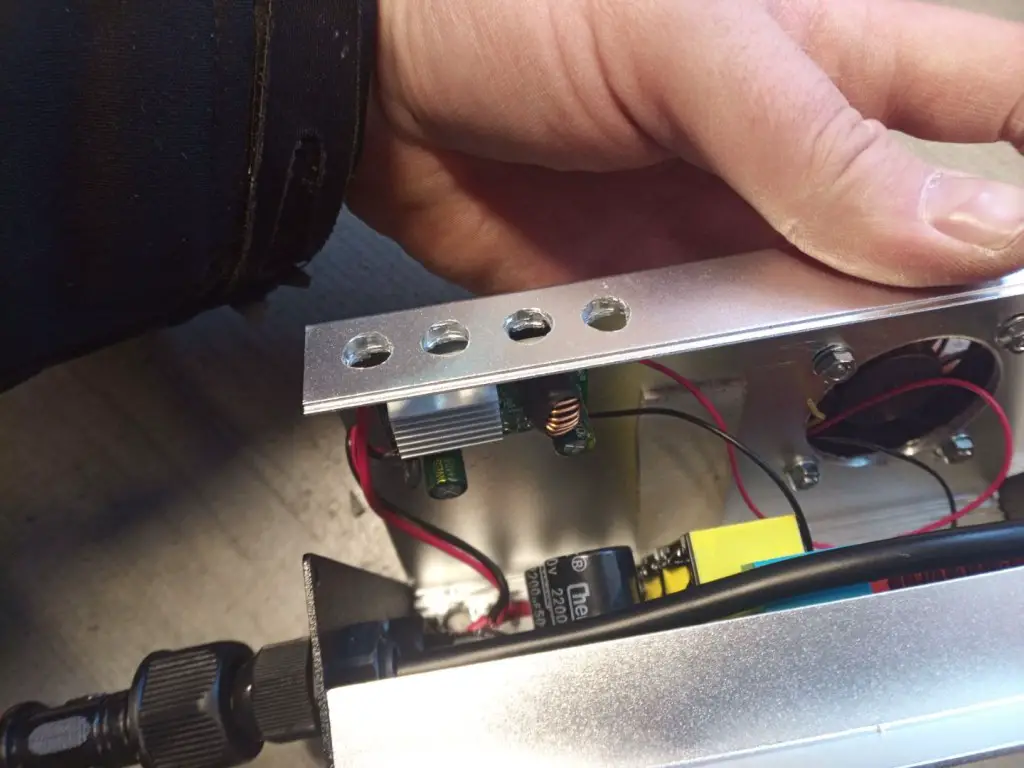
fertig


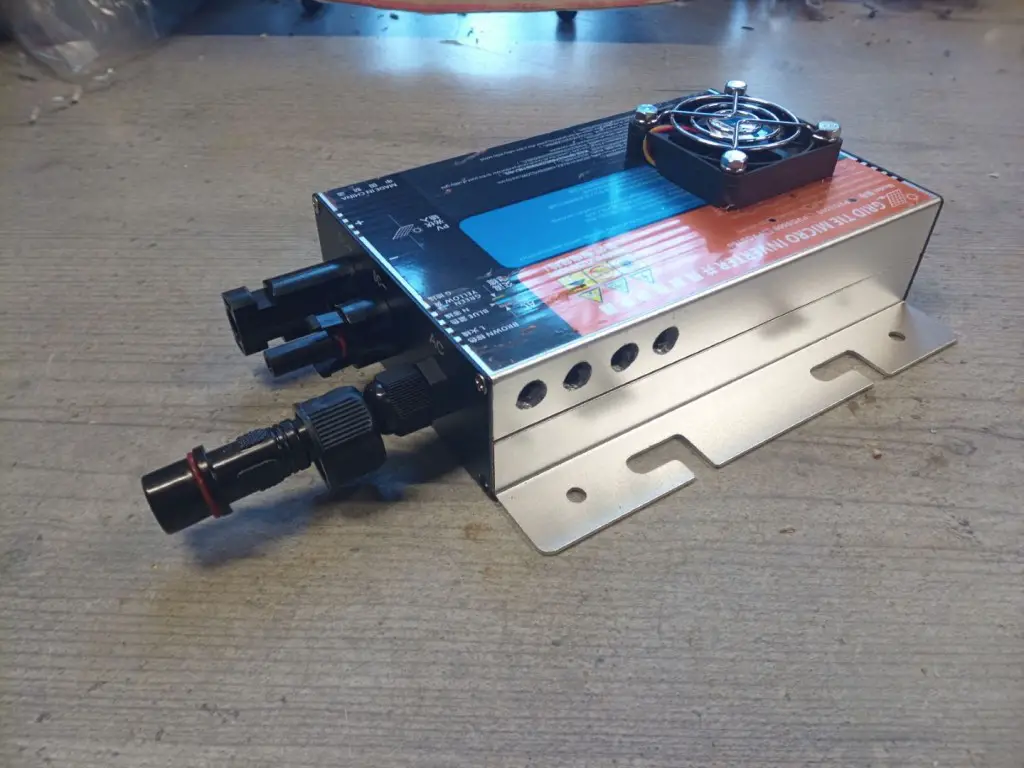
Testlauf
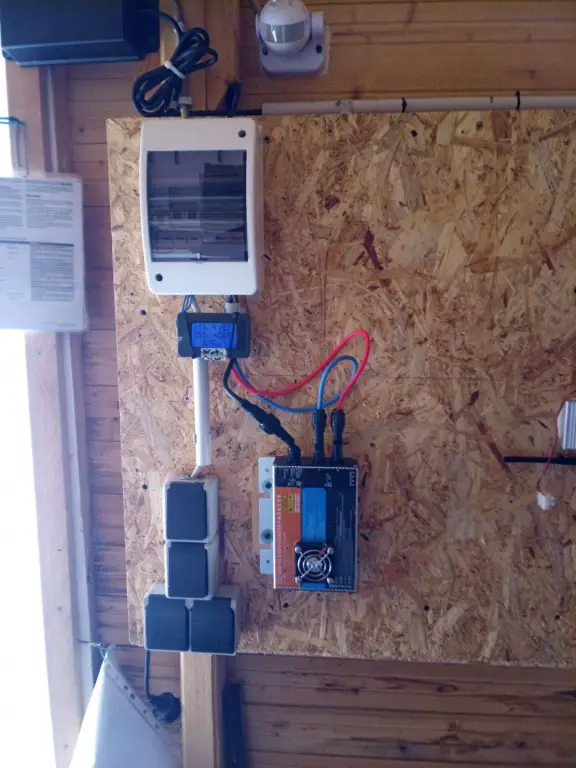
mit einem Stück Dachlatte als Abstandshalter zur Rückseite hin
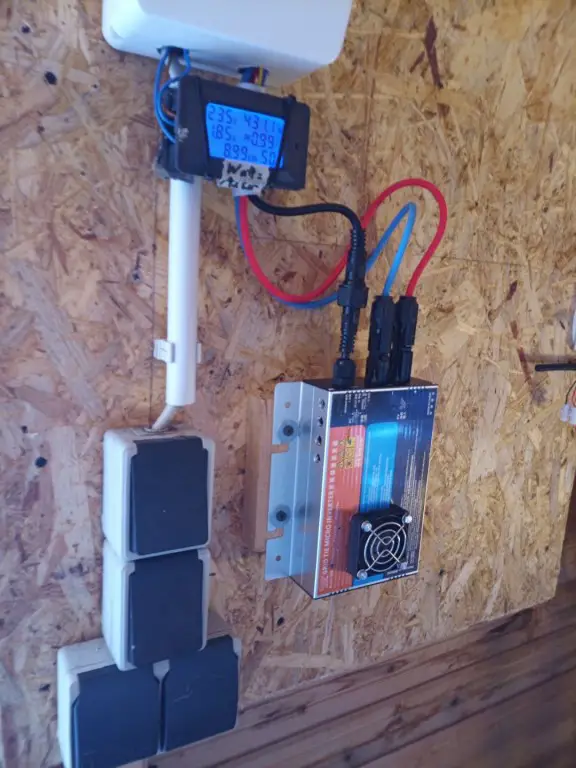
die Sonne ist noch nicht voll da, aber das Wattmeter zeigt schonmal über 430W

der PVGS 500 sitzt nun im Gartenhaus von Heidi an den vier 190W Modulen

Hier noch ein kurzer Testlauf mit eingebautem Lüfter
3.2. Fazit
Inhaltsverzeichnis:
1. WVC / SG Mikrowechselrichter
2. GMI Serie Grid Tie Micro Inverter
3. PVGS Serie
3.1. Lüfter
3.2. Fazit
3.3. Handbücher
- alle GMI und PVGS Modelle benötigen eine Zusatzkühlung
- die Modelle 266 / 300 sowie 350 sind zu 100% identisch und leisten alle 300 Watt
- die Modelle 500 / 600 und 700 sind ebenfalls identisch und leisten 600 Watt
3.3. Handbücher
Inhaltsverzeichnis:
1. WVC / SG Mikrowechselrichter
2. GMI Serie Grid Tie Micro Inverter
3. PVGS Serie
3.1. Lüfter
3.2. Fazit
3.3. Handbücher
{phocadownload view=file|id=17|target=b}
{phocadownload view=file|id=34|target=b}
Inhaltsverzeichnis:
- 1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)
- 2 Idee + Plan
- 3 Akku-Arbeitsplatz
- 4 eBike Akku Komponenten
- 5 eBike Akku zerlegen
- 6 Laptop Akkus zerlegen
- 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte
- 8 neue Hülle für 18650
- 9 China-Akkutest
- 10 Werkzeuge + Messgeräte
- 11 Null-Watt Einspeisung
- 12 Modbus / RS485 Adapter
- 13 BMS + Balancer
- 14 aktiv Balancer BMS - JKBMS
- 15 Ladegeräte + Kapazitätstester
- 16 kpl. Akkupacks testen
- 17 Innenwiderstand Ri
- 18 Solar Laderegler
- 19 Wechselrichter, Inverter
- 20 Löten - Anleitung für Akkus
- 21 Schlüsselanhänger aus 18650
- 22 Sicherheitskonzept
- 23 Akkus Beschaffung - wie und wo?
- 24 WVC / SG / GMI / PVGS Mikroinverter
- 25 Schritt-für-Schritt zur 18650 Powerwall
- 26 ATS - Automatic Transfer Switch
- 27 Schottky Sperrdioden für Parallelschaltung
- 28 Balkonsolar & Balkonkraftwerk
- 29 Hybrid Wechselrichter einrichten
25 Schritt-für-Schritt zur 18650 Powerwall
In diesem Kapitel möchte ich Schritt für Schritt erklären, wie man sich einen Solarspeicher aus gebrauchten 18650 Lithiumzellen selbst bauen kann.
Um ein wenig vorzugreifen: es geht hier um eine Powerwall mit 48V Arbeitsspannung in 14S-Konfiguration, also mit 14 identischen Akkupacks, die in Reihe geschaltet werden und zusammen auf 48V kommen. Die grundsätzliche Bauweise siehst Du auf dem Bild, die tatsächliche Größe kannst Du frei nach Deinen persönlichen Bedürfnissen anpassen, Auswahlkriterien weiter unten.

Die meisten Einzelschritte sind bereits im Vorfeld beleuchtet worden (s. Menü) aber mehr oder weniger gestückelt und unsortiert.
Hier möchte ich nun versuchen, eine gut verständliche Anleitung zum Nachbauen zu machen.
Um einen Überblick zu bekommen hier vorab die einzelnen Schritte, die nachfolgend weiter erklärt werden
Menü-Übersicht:
- 18650 Zellen sammeln
- Akkus zerlegen
- Zellen testen & sortieren
- Zusammenstellung der Akkupacks, Theorie & Praxis
- Akkupacks bauen - aber sicher
- Balancen der Packs und Zusammenbau der Powerwall
- Wechselrichter anschließen, Powerwall in Betrieb nehmen
- Internetseiten mit Infos rund um DIY Solar & Powerwall
1.) 18650 Zellen sammeln
Zunächst die Frage: wieviele 18650 Zellen braucht man denn?
Das hängt im wesentlichen von drei Faktoren ab:
1.1 wieviel Speicherkapazität benötige ich?
Grundlastsystem:
Um nur die Grundlast eines Haushaltes abzudecken reichen grob 3 KWh Speicher aus. Hierzu am eigenen Beispiel mal die Grundlast bestimmen (= der Stromverbrauch, der mindestens immer da ist, auch um 3 Uhr nachts, bedingt durch Kühlschrank, Kühltruhe, WLan-Router, Standby-Verbräuche etc.) und in der Zeit ohne Sonne aufsummieren.
Beispiel: beträgt die dauerhafte Grundlast 200W, die eigenen PV-Module werden ab 19 Uhr und bis morgens um 9 Uhr nicht mit Sonne versorgt sind das 14 Stunden x 200W = 2.800 Wattstunden = 2,8 kWh. Und das ist dann genau der Stromverbrauch, den mann mittels einer Powerwall abdecken kann und künftig nicht mehr vom Energieversorger zukaufen muss.
Um von der Größe her ein wenig Puffer zu haben sollte man auf das 1,5-fache des ausgerechneten Bedarfes gehen, also in unserem Beispiel 4,2 kWh.
Das wäre dann die Mindestgröße, die Sinn macht
Eigenverbrauch maximieren:
Wenn die eigene PV-Anlage nicht ausreichend Leistung beringt, um größere Verbraucher abdecken zu können wie z.B. Waschmaschine, Geschirrspüler, Mikrowellenherd, Kaffeemaschine etc.pp. kann man auch den fehlenden Strom mittels Powerwall zuschießen um so den Eigenverbrauch zu steigern.
Hier beispielhaft ein paar Verbräuche in kWh
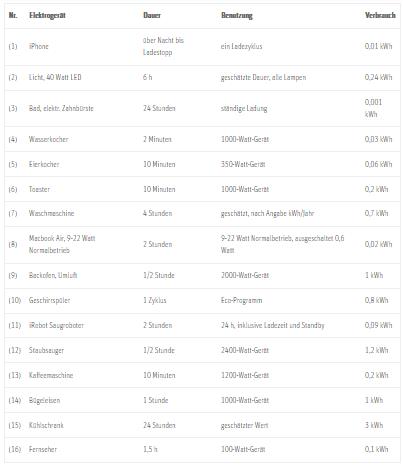
Screenshot Tabelle: blog.energiedienst.de
An dieser Stelle möchte ich auch unbedingt das Tool PVGIS der EU empfehlen, mit dessen hilfe man für seinen eigenen Standort die wichtigsten PV-Daten auf Basis vergangener Wetterdaten ermitteln und so sehr gut abschätzen kann, wieviel Stromertrag zu erwarten sind bei der geplanten Anlagengröße und Ausrichtung.

Um die Berechnungen inkl. Batterie durchzuführen im seitlichen Menü von "Grid connected" zu "Off-Grid" wechseln
1.2 wieviel Watt / maximale Stromstärke soll meine PW leisten können?
Auf die genaue Zusammenstellung & Bau der Akkupacks kommen wir zwar später im Punkt 6 nochmal genauer zu sprechen, trotzdem müssen wir uns schon gleich zu Anfangs entscheiden, wieviel Leistung (also nicht Wh sondern Watt) wir der Powerwall entlocken wollen.
Als Richtwert hat sich bewährt: maximal 1A pro Zelle Dauerleistung (wenn möglich besser 0,5A)
Hintergrund: 18650 Zellen erwärmen sich mehr oder weniger stark, wenn sie dauerhaft mehr als 1A Leistung abgeben oder auch aufnehmen müssen.
Berechnung: wir wollen beispielsweise Geräte mit zusammen max. 1.000W komplett über die Powerwall betreiben.
Darunter zählen z.B. Musikanlage, TV, Handyladegeräte, alle Lichter im Haus, PC / Laptop, Spielekonsolen, Abzugshaube, Mikrowellenherd.
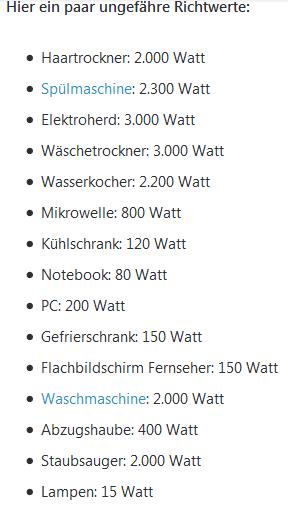
Screenshot Tabellenauszug von handwerkerratgeber.info
Minimale Auslegung:
Bei max. 1.000 Watt brauchen wir also bei einer Powerwall mit typischerweise 48V Arbeitsspannung (mit 12V oder 24V fange ich hier nicht an, das ist für Bastelkeller und Gartenhaus, aber nicht für Haushaltsgerätestrom geeignet) folgende Berechnung:
1.000W / 48V = 20,83A
Bei anvisierten max. 1A pro Zelle bedeutet das, dass wir mindestens 20 Akkuzellen je Akkupack benötigen.
Bei 14 identischen Akkupacks benötigen wir dann also 20 x 14 = 280 Akkuzellen insgesamt.
Die Stromstärke wird bei einer Reihenschaltung immer nur auf ein einzelnes Akkupack gesehen berechnet.
Kapazität grob überschlagen: bei der Kapazitätsberechnung zählt man ebenfalls nur die Zellen eines einzelnen Packs zusammen.
Geht man von einer durchschnittlichen Kapazität von 2.000mAh = 2Ah pro Einzelzelle aus ergibt das bei unserem System mit 20 Zellen je Pack also 2 x 20 = 40Ah je Pack. Jedoch ist Ah eine ziemlich nichtssagende EInheit, denn diese hat immer nur Aussagekraft in Bezug auf die verwendete Spannung.
Viel besser weil universeller vergleichbar und spannungsunabhängig ist da die Einheit Wh (Wattstunden) oder entsprechend kWh (Kilowattstunden).
Zur Umrechnung bietet sich der Onlinerechner von df7sx.de an, wobei wir hier als Spannung dann die Gesamtspannung der Powerwall, also 48V eintragen:

Unsere Powerwall mit 20 Zellen je Pack / 14 Packs in Reihe = 280 Einzelzellen hat demnach zwar ausreichend Momentanleistung für 1.000W, aber nur 1,92 kWh.
Meiner Meinung und Erfahrung nach ist eine Verdopplung auf 40 Zellen je Pack die kleinste, sinnvolle Größe.
Mittlere Auslegung:
Mit einer Verdopplung der minimalen Auslegung auf 40 Zellen je Akkupack bekommen wir dann folgende Leistungsdaten:
- 40 Zellen je Pack
- 14 Packs = 560 Zellen insgesamt
- 2.000W Leistung
- rund 3,5 kWh Kapazität
Das ist dann schon ganz brauchbar und deckt auch die allermeisten Verbraucher ab. Die einzigen, die leistungstechnisch nichtkomplett bedient werden können sind dann: Waschmaschine, Trockner, Geschirrspüler, Kaffeemaschine, großer Wasserkocher, Herd, Backofen, großer Fön, Wärmepumpe.
Maximale Auslegung:
Eine maximale Grenze was die Leistung in Watt anbelangt stellt in der Regel die in Haushalten übliche 16A Absicherung dar. Diese lässt Verbraucher mit maximal 3.700W zu. Zwar können in einem Haushalt in der Summe mehr als 3.700W gleichzeitig laufen, aber das liegt daran, dass mehrere Absicherungen auf die verschiedenen Räume aufgeteilt sind und mehrere Phasen.
Wenn man eine Powerwall an einem beliebigen Verteilerpunkt z.B. im Keller, in der Garage oder im Gartenhaus anklemmt hat man in der Regel jedoch nur eine Zuleitung mit einer einzelnen 16A Absicherung zur Verfügung, kann also auch nicht mehr als 3.700W ins Hausnetz einspeisen.
Um also dieses Maximum ausreizen zu können benötigen wir:
3.700W / 48V = 77A
Also 77 Zellen pro Akkupack. Da es die zum Bau der Akkupacks benötigten Zellhalter (50er Pack 5x4 auf Aliexpress) in 20er Schritten gibt bedeutet das dann in der praktischen Umsetzung
80 Zellen pro Akkupack. Damit könnten wir dann dauerhaft die vollen 16A / 3.700W abdecken.
Kapazität grob überschlagen: 80 x 2.000mAh = 160Ah = 7,68kWh
Damit lässt sich schon richtig viel machen und im Grunde den kompletten Verbrauch im Haus abpuffern.
Noch größere Packs bringen dann keinen Vorteil mehr bei der Momentanleistung, aber eben zusätzliche Kapazität.
um etwas vor zu greifen:
Es lassen sich auch mehrere Powerwalls parallel schalten um so beispielsweise auch nachträglich die Kapazität zu erhöhen.
Mein Vorschlag daher:
für den Anfang erstmal eine Powerwall mit 40 oder 60 Zellen parallel bauen und in Betrieb nehmen, das ist, gerade wenn man das zum ersten Mal macht, bereits aufwändig genug und man übernimmt sich nicht gleich zu anfangs. Bei Bedarf kann man dann später eine weitere Powerwall parallel dazu anschließen.
Ich selbst habe z.B. aktuell vier Powerwalls im Parallelbetrieb am Laufen und noch Platz für zwei weitere vorgesehen.
1.3 wieviele Zellen kann ich bekommen (abh. von Budget oder der Möglichkeit, kostenlos an gebrauchte Zellen zu gelangen)
Eine andere Herangehensweise ist natürlich die Größe der Powerwall davon abhängig zu machen, wieviele Zellen man überhaupt bekommen kann.

Das bringt uns zu einem wichtigen und ganz zentralen Thema, zu dem es bereits ein eigenes Kapitel gibt mit folgenden Optionen:
- Kaufen - Neu
- Kaufen - gebraucht & getestet
- Laptopakkus
- eBike-Akkus
-> Akkus Beschaffung - wie und wo?
|
Du findest unsere Beiträge hilfreich und möchtest uns unterstützen?  Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten und zwar ganz ohne, dass es Dich etwas kostet (hier klicken) |
2.) Akkus zerlegen
Menü-Übersicht:
- 18650 Zellen sammeln
- Akkus zerlegen
- Zellen testen & sortieren
- Zusammenstellung der Akkupacks, Theorie & Praxis
- Akkupacks bauen - aber sicher
- Balancen der Packs und Zusammenbau der Powerwall
- Wechselrichter anschließen, Powerwall in Betrieb nehmen
- Internetseiten mit Infos rund um DIY Solar & Powerwall
Wenn man es nun geschafft hat, ein paar gebrauchte Akkus zu organisieren, kann es an das Zerlegen gehen.
Hierzu gibt es auch bereits zwei separate Menüpunkte mit vielen Erklärungen und Beispielbildern:


Hier findest Du noch eine ganze Reihe nützlicher Werkzeuge, nicht nur zum Zerlegen er Akkus,
zudem auch einige Sicherheitstipps wie beispielsweise die "Sandgrube" bei einem Kurzschluss und/oder Akkubrand

Hinweis an dieser Stelle:
Du musst nicht zwingend losrennen und alle Werkzeuge kaufen / auf Amazon bestellen, die ich benutze.
Erstens ist das nicht unbedingt die allerbeste Methode, wie man etwas macht sondern die Methode, die ich für mich selbst als beste herausgefunden habe. Aber vielleicht arbeitest Du auch lieber mit anderen Werkzeugen.
Zweitens sollten auch einige Werkzeuge, die ähnlich sind und die man schon hat auch ausreichen für den Anfang. Falls Du dann während des Arbeitens feststellst, dass ein Arbeitsschritt mühselig ist oder lange dauert, kannst Du immer noch nach und nach einzelne Werkzeuge austauschen und neu kaufen.
|
Du findest unsere Beiträge hilfreich und möchtest uns unterstützen?  Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten und zwar ganz ohne, dass es Dich etwas kostet (hier klicken) |
3.) Zellen testen & sortieren
Menü-Übersicht:
- 18650 Zellen sammeln
- Akkus zerlegen
- Zellen testen & sortieren
- Zusammenstellung der Akkupacks, Theorie & Praxis
- Akkupacks bauen - aber sicher
- Balancen der Packs und Zusammenbau der Powerwall
- Wechselrichter anschließen, Powerwall in Betrieb nehmen
- Internetseiten mit Infos rund um DIY Solar & Powerwall
Da wir hier mit gebrauchten Zellen arbeiten ist es wichtig, diese vorher auf Herz und Nieren zu prüfen um
1. defekte und ausgelutschte Zellen auszusortieren
2. die noch nutzbare Kapazität zu ermitteln um später aus den vielen Einzelzellen eine gleichmäßig zusammengestellte Powerwall zu bauen

Das Testen der Zellen ist der zeitaufwändigste, aber auch der wichtigste Schritt beim Bau einer Powerwall, ich empfehle deswegen diesen Abschnitt möglichst aufmerksam zu verfolgen um einerseits
- einen gefährlichen Defekt mit Brand zu verhindern und stattdessen
- eine perfekt ausgeglichene Powerwall zusammen zu stellen
Im weiteren Verlauf gehe ich auf die einzelnen Prüfpunkte noch ausführlicher ein, teilweise gibt es auch komplette Artikel dazu.
Hinweis:
beim Kauf von neuen Zellen solltest Du die Punkte 3.4 + 3.6 + 3.7 durchführen, denn auch bei neuen Zellen schwankt die Kapazität produktionsbedingt immer etwas. Egal bei welchem Hersteller und auch egal welches Modell.
Kurzübersicht der einzelnen Prüfschritte:
- 3.1 optische Prüfung
- 3.2 Initialspannung
- 3.3 Innenwiderstand
- 3.4 Kapazitätstest
- 3.5 Spannungsabfall
- 3.6 Sortieren
- 3.7 Packkapazität
3.1 optische Prüfung
Nach dem Zerlegen der Laptop- und/oder eBike-Akkupacks kommt die optische Prüfung, also die Zellen alle von Außen aufmerksam anschauen und auf Beschädigungen achten:
- Undichtigkeit / Elektrolytaustritt (leicht klebrige, braun-gelbe Flüssigkeit, süßlicher Geruch),meist im Bereich der Pole, besonders im Zellenboden Mini-Löcher vom Entfernen der Nickelstreifen
- Roststellen (meist im Bereich der Pole)
- Knicke / Dellen am Akku
Zellen mit solchen Mängeln werden rigoros und ohne Wenn und Aber aussortiert
- beschädigte Hülle / Schrumpfschlauch

Gerade beim Zerlegen von eBikeakkus kommt es häufig vor, dass die Hülle beschädigt wird. An der Seite ist das erstmal nicht unbedingt schlimm, wenn das obere Drittel (Bereich um den Pluspol) unbeschädigt ist dann verwende ich solche Zellen ganz normal weiter und setze sie dann später in der Mitte der AKkupacks ein, wo man die Schrumpfschlauchbeschädgung nicht sieht bzw. wo sie dann durch die umliegenden Zellen geschützt sind.
Aber:
Schäden der Schutzhülle im oberen Drittel / um den Pluspol herum sind gefährlich, da hier superschnell ein Kurzschluss passiert da das gesamte Zellengehäuse negativ geladen ist und nur 2 - 3mm vom Pluspol trennen. Die beiden rechten Zellen auf dem Bild oberhalb würde ich so definitiv nicht benutzen.
Solche Zellen erstmal zur Seite legen, die kann man trotzdem weiter verwenden, indem man einfach eine neue Schützhülle anbringt.
Hierzu habe ich eine separate Anleitung geschrieben -> neue Hülle für 18650
Die hier im ersten Schritt aussortierten Zellen in einem dichten,nicht metallischen Behälter (Glas- oder Keramikschüssel, Baueimer, Tupperdose) sammeln und bei Gelegenheit zum Wertstoffhof bringen.
Lagerung:
Noch ein Wort zur Lagerung. Bitte LiIon Zellen nicht in metallische / leitende Behälter lagern, Kurzschlussgefahr.
Und auch nicht lose in eine Kiste / Karton schütten.
Am besten ordentlich gelagert, immer in eine Richtung und zwischen den einzelnen Reihen dann ein Stück Karton / Plastik / Styropor, sodass die Pole voneinander isoliert sind (rechts unten die wackelige Eispackung - das ist nicht wirklich gut)

Zur Lagerung kann natürlich jeder benutzen, was er / sie möchte, ich für mich benutze die Plastikboxen "Samla" von Ikea. Hier auf dem Bild das sind die kleinen 4L Boxen. Die kosten 99 Cent + 50 Cent Deckel und es passend etwa 150 Zellen rein, dienächstgrößeren Boxen haben 11L, kosten 1,99 + 1€ Deckel und es passen rund 350 Zellen rein.
3.2 Initialspannung
LiIon Akkuzellen gehen kaputt,wenn sie zu tief entladen werden. Allgemein nimm tman 2,5V als untere Spannungsgrenze, darunter spricht man von "Tiefenentladung".
Um zu vermeiden, dass man defekte Zellen in die Powerwall einbaut sollte man also dringend gleich zu Anfangs die Spannung messen.
- liegt die Spannung über 2,5V -> perfekt, ab damit in die Kiste o.ä,. für die weiteren Tests
- liegt die Spannung unter 2,5V -> aufpassen
LiIon Zellen gehen nicht direkt kaputt, wenn sie ein, zwei Mal unter 2,5V rutschen. Entscheidend ist die tatsächliche Spannungstiefe und am meisten noch die Dauer, bei der sie tiefenentladen lagern.

Bei gebrauchten Laptopakkus wissen wir in der Regel nie, wie lange die schon herumlagen, bevor wir die schlussendlich in den Händen halten,
daher ist es meiner Meinung nach sehr sinnvoll, solche Laptopakkus unterhalb von 2,0V nicht zu benutzen sondern stattdessen zu entsorgen.
Bei gebrauchten eBike-Akkus kann man unterscheiden.
Besonders bei den Powerpack und Powertube von Bosch kommt es sehr häufig vor, dass diese ein BMS-Defekt haben.
Bei den Powerpack-Modellen...

... wird der Akku beim Fahren komplett leer gefahren und kann danach wegen einer Schutzeinstellung nicht wieder geladen werden. Diese AKkus landen regelmäßig und in großen Mengen auf dem "Müll" (also in der Batteriesammelbox beim Fahrradhändler)
Da diese Akkus nur genau 1x leer gefahren werden und zudem auch in der Regel nicht monatelang tiefenentladen dort gelagert werden habe zumindest ich bisher sehr gute Erfahrungen damit gemacht, solche Akkuzellen zu benutzen.
Fast dasselbe passiert bei den Powertube Modellen

Bei den Modellen geht das BMS auch sehr häufig kaputt und es passiert dasselbe wie oben.
Zudem ein zweiter häufiger Defekt: registriert das BMS einen minimalen Spannungsunterschied bei den verbauten Zellen von etwa 0,02V dann geht das BMS in den Schutzmodus und entlädt die Akkuzellen über einen Widerstand bis auf 0 Volt. Auch hier kann der Akku danach nicht mehr geladen werden und landet auf dem Müll.
Das sind die beiden einzigen Ausnahmen, bei denen man überlegen kann, tiefentladene Zellen doch noch zu verwenden. In allen anderen Fällen bei denen man nicht weiß,wie lange die Zellen schon lagern -> entsorgen.
Exkurs 0-Volt-Zellen reaktivieren:
Die meisten Ladegeräte können tiefentladene Zellen unter 2,5V nicht aufladen. Sie erkennen sie entweder erst garnicht oder erkennen sie fälschlicherweise als NiMh Akkus.
Man muss sie reaktivieren um sie wieder benutzen zu können.
Manche Ladegeräte haben eine Reaktivierungsfunktion integriert, die heißt dann unterschiedliche, manchmal "0-Volt-Reactivation" oder "Low Voltage Boost" oder so ähnlich. Manchmal muss man den Reaktivierungsmodus dann manuellauswählen, manche Geräte machen das automatisch.
Ich selbst benutze dafür das XTar VC8, das hat eine automatische Reaktivierung.

Das kleinere XTar VC4 kann das genauso. Mehr zu den Geräten auch im übernächsten Abschnitt unter Punkt 4 Kapazitätstest
Dabei wird zu Anfangs mit einer sehr niedrigen Spannung und gleichzeitig sehr niedrigen Stromstärke die Zelle geladen, im weiteren Verlauf wird beides ganz langsam gesteigert.
Das ist sehr wichtig, denn ein "Hauruckladen" von tiefentladenen Zellen zerstört diese.
Aus diesem Grund bitte nicht nachmachen, was im Internet manchmal empfohlen wird: eine 0-Volt-Zelle mit zwei Kabeln parallel an eine volle Zelle anschließen, so wie z.B. hier:
Denn dabei passiert genau das, was wir nicht wollen: mit einem Schlag bekommt die 0-Volt Zelle die volle Spannung der anderen Zelle ab und die komplette Stromstärke, die die andere Zelle liefern kann.
Zusammenfassung:
- LiIon Zellen unter 2,50V sind tiefenentladen, unter 2,0V ist gefährlich
- daher: Laptopakkus und Akkus aus Quellen wo Du nicht sicher weißt, wie lange sie schon tiefentladen lagern -> entsorgen
- wenn schon tiefentladene Zellen reaktivieren dann möglichst "sanft" mittels dafür vorgesehener Reaktivierungsfunktion des Ladegerätes z.B. XTar VC4 / VC8
3.3 Innenwiderstand
Bei gebrauchten Zellen weiß man in der Regel so gut wie garnichts über das vorherige Leben.
- wie alt
- wie oft wurde sie geladen / entladen
- stark belastet oder nur leicht
- Lagerung / Temperatur
- evtl. schon mehrmals tiefenentladen
- kündigt sich ein Defekt an
Der Innenwiderstand einer LiIon Zelle gibt sehr viel Aufschluss über den Zustand einer Zelle und gehört neben den beiden vorherigen Tests (optische Prüfung und Spannungsmessung) zu den wichtigsten Prüfungen, um den Zustand einer Zelle beurteilen zu können.

Das Thema Innenwiderstandsmessung ist bei der DIY-Powerwall so wichtig, dass ich hierzu ein eigenes Kapitel verfasst habe -> Innenwiderstand Ri
zusammengefasst die zwei wesentlichen Punkte:
- ein Innenwiderstand über 70mOhm weist darauf hin, dass die Zelle bereits viel arbeiten musste und / oder sich ein Defekt ankündigt -> nicht mehr in der Powerwall nutzbar
- mit einem normalen Multimeter lässt sich der Innenwiderstand von Li-Ion Akkuzellen nicht korrekt messen, ebensowenig mit Ladegeräten, die eine Widerstandsanzeige haben, dazu benötigt man ein spezielles Messgerät (um 30€)
3.4 Kapazitätstest
Der für uns interessanteste Punkt ist sicher, wieviel nutzbare Restkapazität hat die gebrauchte Zelle nun, denn je älter / je mehr eine Zelle bereits schuften musste, desto geringer ist die verbleibende Kapazität.
Diese nutzbare Kapazität herauszufinden ist sehr leicht, man benötigt lediglich Ladegerät, welches einen Kapazitätstest beherrscht.

Im Grunde funktioniert dieser Test in drei Stufen:
- Akku voll aufladen
- Akku entladen -> dabei die Energie mitzählen, die aus dem Akku entnommen werden kann
- Akku danach wieder aufladen, damit er anschließend auch benutzt werden kann
Es gibt auch (günstige) Geräte, die bieten nur einen Schnelltest an. Der funktioniert dann so:
- Akku voll aufladen -> dabei die Energie mitzählen, die während des Ladevorgangs in den Akku hineinpasst
Dieser Test ist, mit Verlaub, absoluter Käse. Denn man kann erstens nie genau sagen, wieviel Restladung bereits im Akku drin war, und zweitens variiert die Menge, die in eine LiIon-Akkuzelle hineingeladen werden kann sehr stark. z.B. bei einem sog. Heater (dazu später mehr), der seine Ladeendspannung nicht oder nur unter viel Energieeinsatz erreicht. Dieser wird wahnsinnig viel Ladung aufnehmen können, aber hat trotzdem kaum nutzbare Kapazität.
Daher beim Kauf eines solchen Kapazitätsmessgerätes nicht einfach nur auf die Artikelbeschreibung "inkl. Kapazitätstest" achten sondern auch auf die Methode.
Bei Geräten wie dem Imax charger oder Bastellösungen wie die Platinen ZB2L3 HW-586 / TP4056 muss man diese drei Schritte alle einzeln und nacheinander abarbeiten,
aber es gibt auch eine handvoll "normaler" Ladegeräte, die diese drei Schritte vollautomatisch machen

Auch zu diesem Thema gibt es ein eigenes, sehr ausführliches Kapitel mit Vorstellung der gängigsten Ladegeräte
-> Ladegeräte + Kapazitätstester
Wie auf dem Bild oben schon zu erahnen nutze ich mittlerweile ein einfaches ATX Computernetzteil, anstatt vieler einzelner Steckernetzteile, um alle Kapatitätstester / Ladegeräte zu betreiben.

Hierzu gibt es auch eine bebilderte Anleitung -> ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte
Welche Kapazität ist noch gut und nutzbar?
Es gibt zwei Ansätze um zu sagen, welche Kapazität noch brauchbar ist für eine Powerwall.
1. Arbeitsaufwand
Im Grund ist jede Kapazität nutzbar für eine Powerwall, auch sehr kleine im Bereich von sagen wir mal 1.500mAh.
Allerdings ist der damit verbundene Arbeitsaufwand eben doppelt so groß, wie bei Zellen mit 3.000mAh Kapazität.
Man braucht doppelt so viele Zellen um in der Summe dieselbe Speichergröße zu bekommen, muss doppelt so viele Zellen testen, verbauen, löten, die ganze Powerwall wird doppelt so groß, man benötigt mehr Material "drumherum" wie Zellhalter, Busbars, Sicherungsdraht, Ringkabelschuhe etc. pp.
Aus diesem Grund, um den Arbeitsaufwand überschaubar zu halten nehmen die meisten DIY-Powerwall-Leute 2.000mAh als Minimum
Aber wie gesagt, technisch spricht erstmal nichts gegen niedrigere Kapazitäten, das ist eine persönliche, individuelle Entscheidung, ob man sich die Mühe machen will auch kleinere Zellen zu benutzen oder nicht.
Ich z.B. habe in der Garage eine komplette 12kWh Powerwall zum Laden des E-Autos rein aus Zellen zwischen 1.500mAh - 1.900mAh gebaut.

OK ich gebe zu, die wollte ich ursprünglich auch nicht verwenden und entsorgen, aber als es mit der Zeit so viele wurden fand ich es viel zu schade die zu entsorgen und hab sie dann doch verwendet. Und nun bin ich froh drum.
2. Die 80%-Regel
Wichtiger als der o.g. Arbeitswand ist die 80%-Regel
Und zwar sollte man die Grenze für nutzbare Restkapazität nicht ausschließlich an einem fixen mAh-Wert festmachen, sondern daran, wieviel Prozent eine Zelle von ihrer ursprünglichen Kapazität noch übrig hat.
Hier gilt allgemein die Empfehlung:
- bei 60% Restkapazität und weniger ist eine Zelle praktisch ausgelutscht und tot
- Minimum 80% Restkapazität sollte sie noch haben, damit es sich noch lohnt, die Zelle in einer Powerwall zu betreiben, damit sie auch noch ein paar Jahre durchhält
Beispiel:
Weist eine Zelle nach dem Kapazitätstest noch 2.000mAh auf ist das für den Arbeitsaufwand zwar erstmal gut, sagt aber noch nichts über den Zustand aus
- hatte die Zelle nagelneu ab Fabrik 2.100mAh ist das ein sehr guter Wert, denn sie hat noch rund 95% ihrer ursprünglichen Kapazität und daher noch nicht viel arbeiten müssen
- aber hatte die Zelle nagelneu ab Fabrik 3.500mAh dann hat sie nur noch bescheidene 57% ihrer usprünglichen Kapazität und hat demnach ihr Lebensende bereits erreicht und ist für eine Powerwall nicht mehr nutzbar
Diese Abschätzung der 80% hat hauptsächlich etwas mit der Zyklenanzahl zu tun, denn LiIon Zellen haben nur eine beschränkte Anzahl an Lade-Entladezyklen, die sie verkraften. Diese Zyklenanzahl hängt direkt mit der Restkapazität zusammen und anhand dieser kann man also abschätzen, wie lannge eine Zelle noch leben wird.
Woher weiß man, wieviel Kapazität eine Zelle ursprünglich mal hatte?
Klingt vielleicht erstmal nach unglaublich viel Arbeit aber: Du musst von jeder Zelle die Modellbezeichnung googeln und nachschauen, wieviel Kapazität die Zelle ab Werk mal hatte.
Aber:
Wenn Du erstmal ein paar zwanzig oder dreißig Akkupacks zerlegt hast wirst Du feststellen, dass sich die verbauten Zellen widerholen und es im Grunde nur ein Dutzend unterschiedlicher Zelltypen gibt, da hat man dann recht schnell raus, welche Zelle wieviel Kapazität haben sollte.
Und für den Anfang: googeln oder den Zellentyp in der Celldatabase von Secondlifestorage suchen
3.5 Spannungsabfall
Der nächste Prüfschritt ist, ob die AKkuzelle die Ladung auch halten kann oder ob sie sich unzulässig schnell entlädt.
Dazu werden die LiIon Zellen voll aufgeladen, also auf 4,20V ( nach dem Kapazitätstest sind die Zellen in der Regel eh auf 4,20V geladen, also ist das im Grunde kein separater Schritt.)
Danach werden die Zellen eingelagert und nach einer bestimmten Zeit wird die Spannung gemessen. Ist die Spannung zu weit abgefallen wird die Zelle entsorgt.
Hierfür gibt es keinen in Stein gemeiselten Wert sondern lediglich Richtwerte. Einige Leute nehmen 4 Wochen Einlagerungsdauer und einen minimalen Rest-Spannungswert von 4,10V.
Heißt:
hat die Zelle nach 4 Wochen Nicht-Benutzung nun weniger als 4,10V dann verliert sie die Ladung zu schnell und wird aussortiert.
Manche nehmen 4,0V als Grenzwert, andere 2 Wochen anstatt vier.
Das ist ganz davon abhängig, wie die eigene Präferenz ist, wie fit die Zellen sein sollen, die man verwenden möchte.
Hier beispielhaft ein Flowchart, das ich irgendwo im Netz mal aufgeschnappt habe:
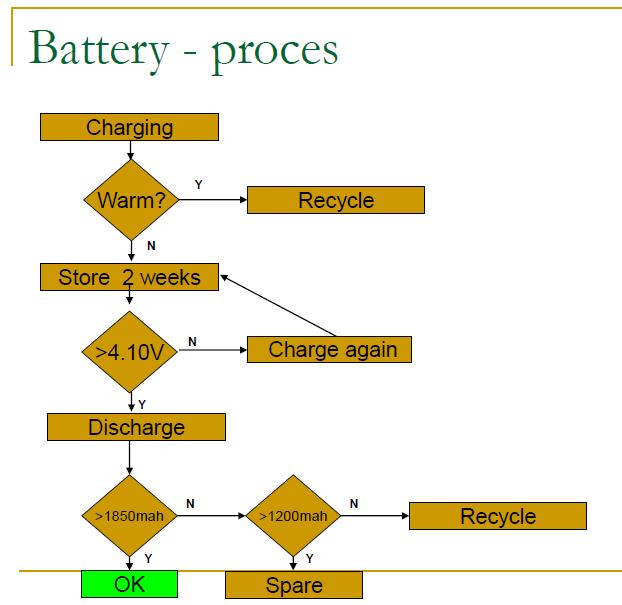
Ich persönlich messe diesem Test jedoch nicht zu viel Wichtigkeit bei, aus drei Gründen:
- in (m)einer Powerwall wird die Ladung eigentlich nicht über Wochen gelagert sondern täglich abgerufen und auch nachgeladen, d.h. es kommt nicht so sehr darauf an, dass die Zellen ihre Ladung möglichst lange verlustfrei halten können
- minimale Ladungsverluste einzelner Zellen können automatisch ausgeglichen werden, indem man einen aktiven Balancer benutzt -> aktiv Balancer BMS
- Zellen, die so alt oder beschädigt sind, dass sie gefährlich viel Ladung verlieren fallen bereits an anderer STelle auf, z.B. indem sie sich beim Laden stark erwärmen (Heater) oder die Ladeschlussspannung von 4,20V nicht erreichen
Wer allerdings seine Powerwall mit richtig doll gebrauchten Zellen und ohne aktiven Balancer baut (Laptopzellen, Akkupacks unbestimmten Alters, ...) sollte auf jeden Fall den Test des Spannungsabfalls sehr genau nehmen.
3.6 Sortieren
Die erste Ladung Akkuzellen ist nun komplett fertig getestet und für gut befunden. Und nun?
Bei kleineren Powerwalls mit grob 500 Zellen insgesamt bietet sich das Tool rePackr an um die vorhandenen, beschrifteten Zellen so zu sortieren, dass sich daraus gleichwertige Akkupacks für eine Powerwall zusammenstellen lassen
Du findest das kostenlose Online-Tool unter
- secondlifestorage.com -> Battery-Tools-> Pack builder
- oder direkt unter repackr.com
Für größere Powerwalls ist diese Methode sehr zeitaufwändig und es empfiehlt sich stattdessen ein anderes Vorgehen.
Und zwar werden die Zellen direkt nach dem Kapazitätstest sortiert nach ihrer Kapazität, und zwar in 100mAH Schritten - oder noch besser in 50mAh Schritten.

hierzu eignen sich die Ikea Samla Boxen sehr gut. Rund 350 Zellen passen in die Boxen mit 11L (wie hier auf den Bildern), in die kleinere 4L Box passen rund 150 Zellen rein

Wenn die getesteten Zellen alle sortiert nach Kapazität und ordentlich in Kisten eingeordnet sind dann lassen sich im nächsten Schritt stressfrei die AKkupacks für die Powerwall bauen.
|
Du findest unsere Beiträge hilfreich und möchtest uns unterstützen?  Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten und zwar ganz ohne, dass es Dich etwas kostet (hier klicken) |
4.) Zusammenstellung der Akkupacks, Theorie & Praxis
Menü-Übersicht:
- 18650 Zellen sammeln
- Akkus zerlegen
- Zellen testen & sortieren
- Zusammenstellung der Akkupacks, Theorie & Praxis
- Akkupacks bauen - aber sicher
- Balancen der Packs und Zusammenbau der Powerwall
- Wechselrichter anschließen, Powerwall in Betrieb nehmen
- Internetseiten mit Infos rund um DIY Solar & Powerwall
Nun haben wir einige Hundert fertig getestete LiIon Zellen, als nächstes stellen sich zwei Fragen
- 4.1 darf ich Akkus mit unterschiedlicher Kapazität mischen?
- 4.2 wieviel Zellen soll ich parallel und in Reihe schalten?
4.1 Darf ich Akkus mit unterschiedlichen Kapazitäten mischen?
Kommt darauf an, ob Reihenschaltung oder Parallelschaltung.
a) Reihenschaltung

Wenn Du Zellen in Serie schaltest müssen alle Zellen dieselbe Kapazität haben. Benutzt Du hier unterschiedliche Kapazitäten dann bestimmt die schwächste Zelle die Gesamtkapazität der gesamten Reihenschaltung. Ist die schwächste Zelle leer, dann ist das gesamte Pack nicht mehr weiter nutzbar obwohl die anderen Zellen vielleicht noch Ladung hätten.
b) Parallelschaltung

In einer Parallelschaltung kannst Du Zellen mit unterschiedlichen Kapazitäten mischen, die Gesamtkapazität ist dann die Summe der Einzelkapazitäten.
Bei Belastung wird dann die Zelle mit der höchsten Kapazität automatisch stärker belastet als die mit der niedrigsten Kapazität.
Effektiv wird dennoch die schwächste Zelle ein wenig schneller geleert werden und so wird das gesamte Pack gegen Ende der Ladung hin nicht mehr so hohe Ströme abgeben können. Der Effekt wird kleiner umso mehr Zellen parallel geschaltet sind.
Bei einer Parallelschaltung mit nur 3 oder 4 Zellen sollten diese möglichst nah beieinander liegen,
bei einem Akkupack mit 40, 60 oder mehr Zellen parallel, wie das in einer Powerwall recht üblich ist, macht es garnichts aus, wenn Zellen mit z.B. 2.000mAh bis 3.000mAh gemischt werden.
c) gemischte Schaltung

Für unsere Powerwall werden wir in der Regel so etwas haben, eine Mischung aus Parallelschaltung und Serienschaltung.
Hier muss man nun beide vorangegangenen Grundsätze gleichzeitig beachten:
- die Einzelkapazitäten der parallelen Teile (hier im Bild also die linken drei Zellen zusammen genommen, die mittleren drei zusammen genommen, die rechten drei zusammen genommen) dürfen unterschiedlich sein, da sie sich ausgleichen.
- die drei Blöcke, die dann jeweils in Reihe geschaltet sind müssen jedoch in der Summe dieselbe Kapazität haben da sonst der schwächste Block die Gesamtkapazität bestimmt
Beispiel:
- die linken drei Zellen haben 1.800.mAh / 2.000mAh / 2.200mAh = 6.000mAh gesamt
- die mittleren drei Zellen haben 1.900mAh / 2.000mAh / 2.100mAh = 6.000mAh gesamt
- die drei rechten Zellen haben 1.500mAh / 2.100 / 2.400mAh = 6.000mAh gesamt
Das würde problemlos gehen.
4.2 wieviel Zellen soll ich parallel und in Reihe schalten?

Im Grunde musst Du die Frage selbst beantworten, eine Hilfestellung findest Du direkt im ersten Teil unter 1.1 - 1.3
Gängig bei LiIon und im DIY-Selbstbausegment sind:
- seriell: 14s Systeme, also 14 Akkupacks in Reihe. Dadurch erhält man ein 48V Akkusystem.
- parallel: 40p, 60p, 80p, 120p - generell 20er Schritte da die standardmäßigen Zellhalter im Raster 4x5 gebaut sind
Nachdem ich mehrere Systeme gebaut habe unter anderem mit 40p, 60p, 100p und 120p kann ich folgendes aus meiner eigenen, persönlichen Erfahrung heraus sagen:
- 40p ist vergleichsweise schnell gebaut und gut für den EInstieg, damit man mal in halbwegs überschaubarar Zeit ein Ergebnis und demzufolge ein Erfolgserlebnis hat. Hier hat man dann ganz grob 4kWh zusammen. Die Akkupacks sind aufgrund ihrer eher geringen Größe anfällig für stark unterschiedliche Zellkapazitäten und hohe Ladeströme, also eher für kleinere Anlagen im Gartenhaus ider in einer Wohnung. Nicht geeignet für große Lasten wie Fön, Kaffeemaschine, Herd, Backofen etc. aber auch noch unproblematisch mit Leitungsquerschnitten und Verbindern. 16mm² reicht dicke aus.
- 60p ist eine gute, handliche Größe. Mit etwas Übung hat man schnell die einzelnen Arbeitsschritte erledigt, gute Größe um mal eben nach der Arbeit noch ein oder zwei Packs zusammenzubauen. Gut skalierbar. Mit 60A Abgabeleistung gerade so geeignet für Fön und Co. (alles bis 3.000W) aber noch nicht für Backofen, Herd etc. Grob 6kWh Gesamtkapazität
- 80p ist schon recht groß und schwer, man muss die Busbar-Querschnitte und Zuleitungsdurchmesser gut berechnen, um die maximal 80A Abgabeleistung auch ordentlich transportieren zu können, ohne dass etwas zu heiß wird.
- 120p ist schon sehr groß, hier braucht man dann schon etwas Durchhaltevermögen um 1) ein einzelnes Pack fertig zu bauen und zu löten = 600 Lötungen und b) erstrecht um 14 solche Packs zu einem Gesamtsystem zu bauen. Das macht man nicht mal eben so nebenher, da sollte man schon konkret Zeit einplanen, damit es nicht zu einem Kellerprojekt wird, das auf halber Strecke aufgegeben wird. Aber: 12 kWh und 120A Abgabeleistung = ausreichend für alle Anwendungen und auch so, dass die einzelnen Zellen nicht übermäßig gestresst werden. Aber hier gilt auch gewissenhaftes Arbeiten, denn 120A Strom sind schon richtig viel, damit kann man 12mm Stahl schweißen. 35mm² Kupferkabel Minimum. Weiterer Vorteil beim Bau von mehreren Systemen: mit dieser Bauweise ist der geringste Aufwand + die geringsten Kosten verbunden umgerechnet pro Zelle, denn mehrere kleinere Systeme sind aufwändiger als wenige große, und die Kosten für Teile drumherum wie BMS, Kabelverbinder, Sicherungen etc. sind bei wenigen großen Systemen auch niedriger als bei mehreren kleinen.

|
Du findest unsere Beiträge hilfreich und möchtest uns unterstützen?  Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten und zwar ganz ohne, dass es Dich etwas kostet (hier klicken) |
5.) Akkupacks bauen - aber sicher
Menü-Übersicht:
- 18650 Zellen sammeln
- Akkus zerlegen
- Zellen testen & sortieren
- Zusammenstellung der Akkupacks, Theorie & Praxis
- Akkupacks bauen - aber sicher
- Balancen der Packs und Zusammenbau der Powerwall
- Wechselrichter anschließen, Powerwall in Betrieb nehmen
- Internetseiten mit Infos rund um DIY Solar & Powerwall
Es gibt unzählige Arten und Bauformen, wie man aus 18650 Zellen einzelne Akkupacks und später eine gesamte Powerwall bauen kann.
5.1) einige Beispiele verschiedener Bauformen
01 - klein und knackig, Verbinder parallel
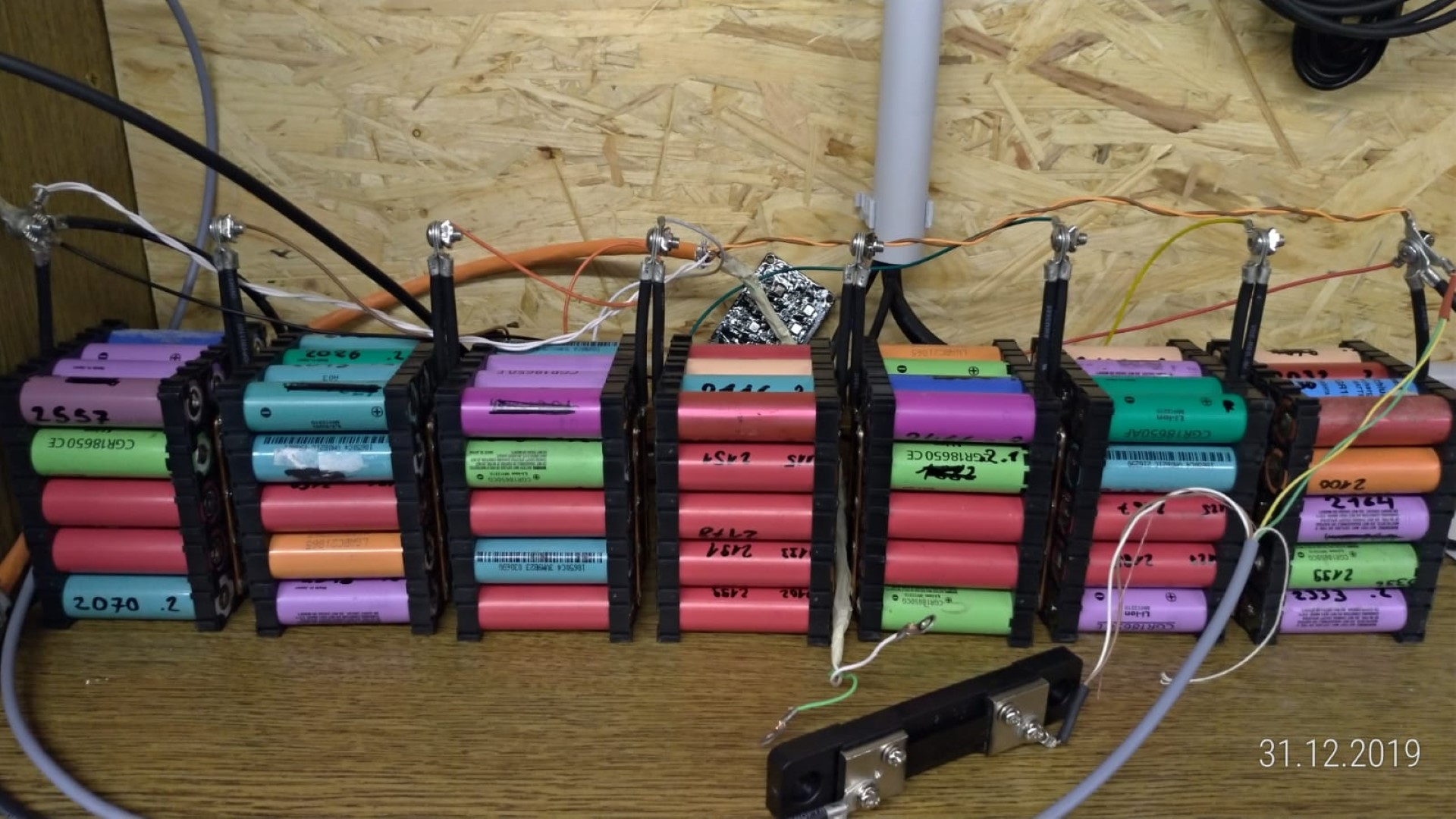
02 - aufwändig und dekorativ, verschachtelte Busbars
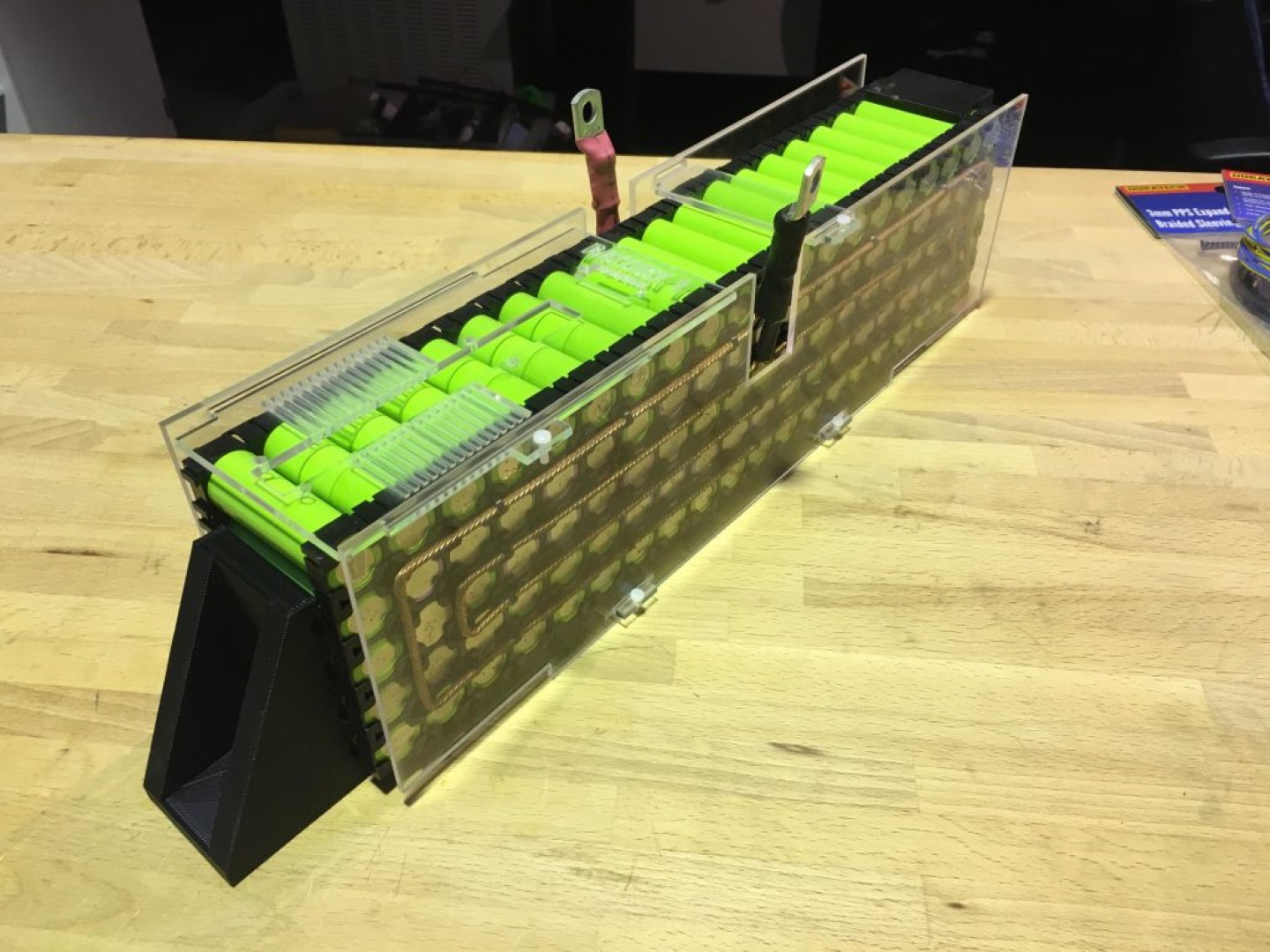
03 - mehrere Etagen

04 - sehr große Einzelpacks, hier sind die Zellen nicht alle parallel verbunden sondern immer eine Reihe parallel, die Reihen jeweils in Serie
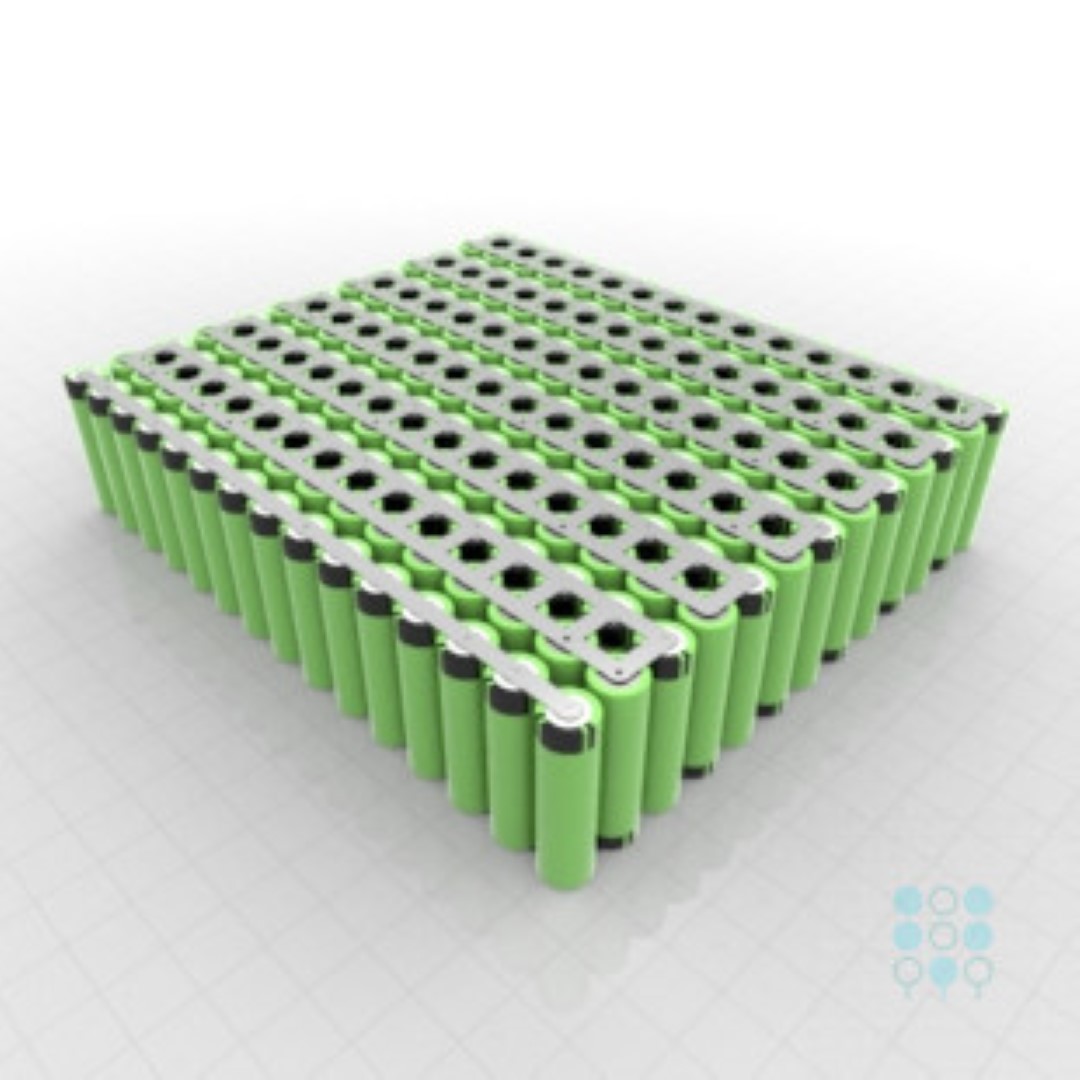
05 - Flacheisen / Metallband / Nickelstrip als Busbar

06 - seitliche Sammelschiene

07 - klickbare Kauflösung

08 - hier erkennt man gut den Aufbau: 10s4p also jeweils 4 Zellen parallel verbunden, diese 4er-Reihen dann in Serie -> 36V Arbeitsspannung

09 - Riesenpack, ebenfalls mit wechselnder Polung

10 - wieder seitliche Sammelschienen
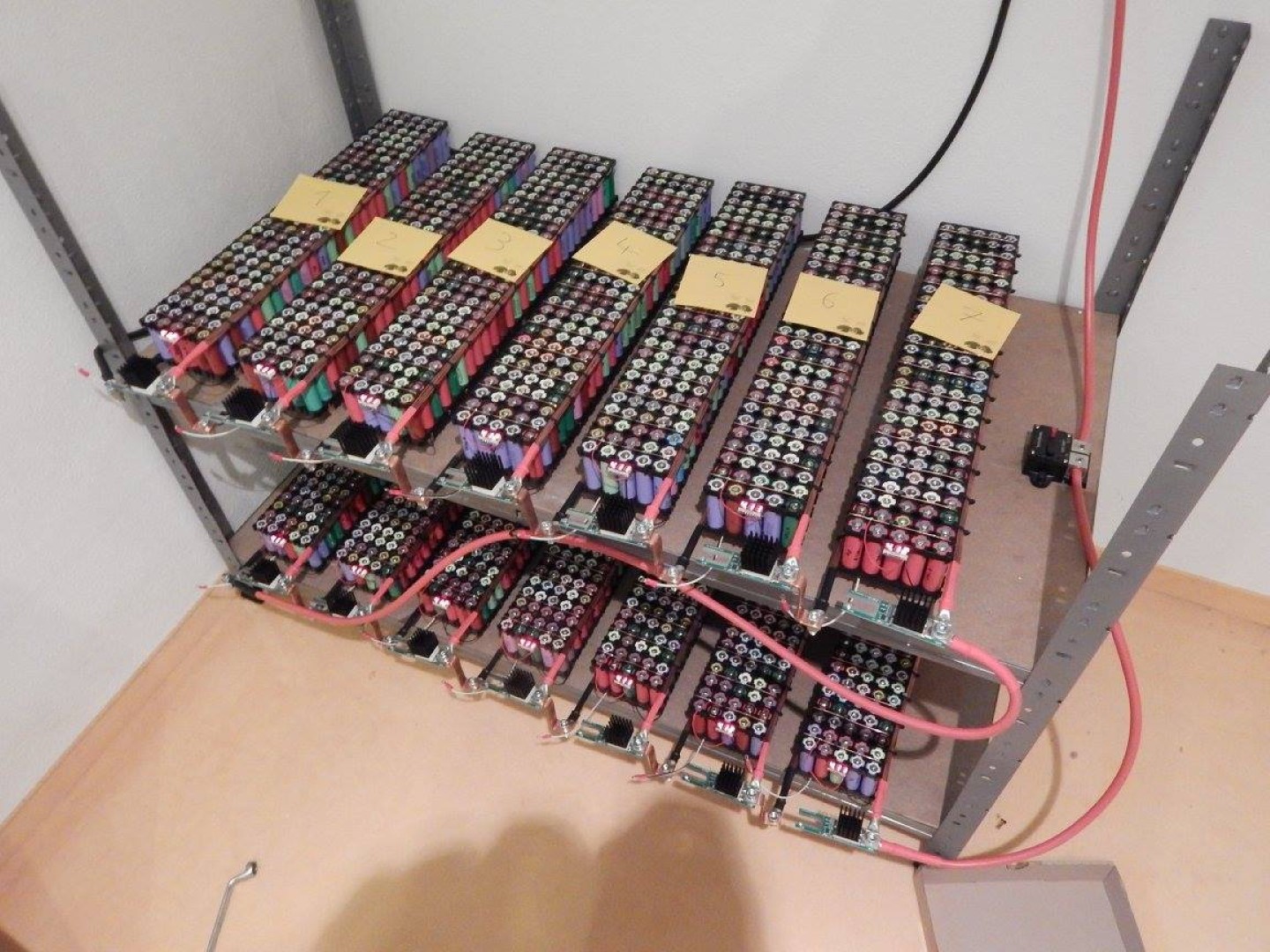
11 - zwei Packs parallel übereinander gestapelt
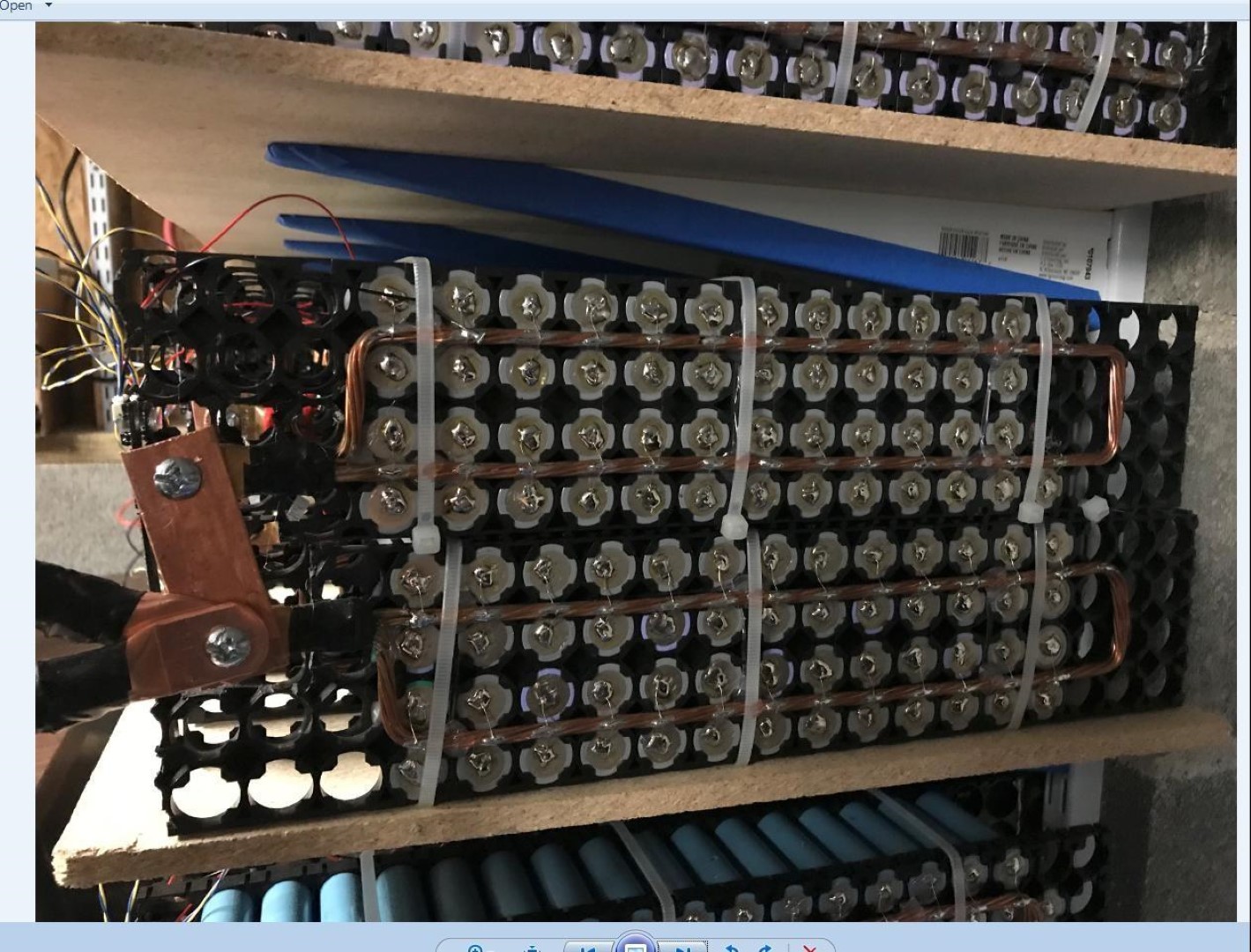
12 - dicker Kupferdraht direkt auf die Zellen aufgelötet
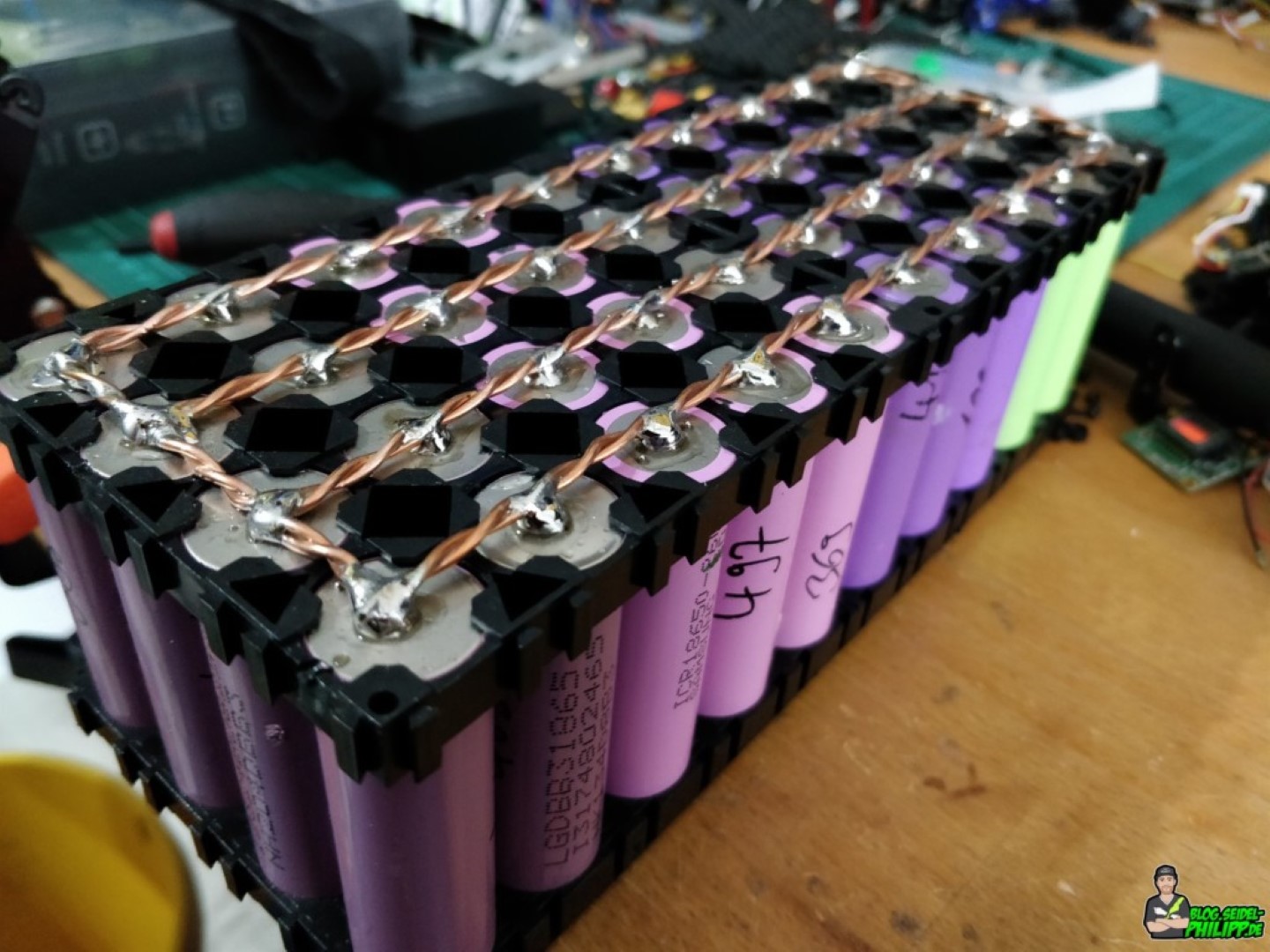
13 - mit Steckverbinder aus dem Modellbau

14 - Busbarenden an entgegenliegenden Enden

15 - Punktschweißen

16 - Löten und Busbarenden an denselben Seiten

17 - seitliche Busbars
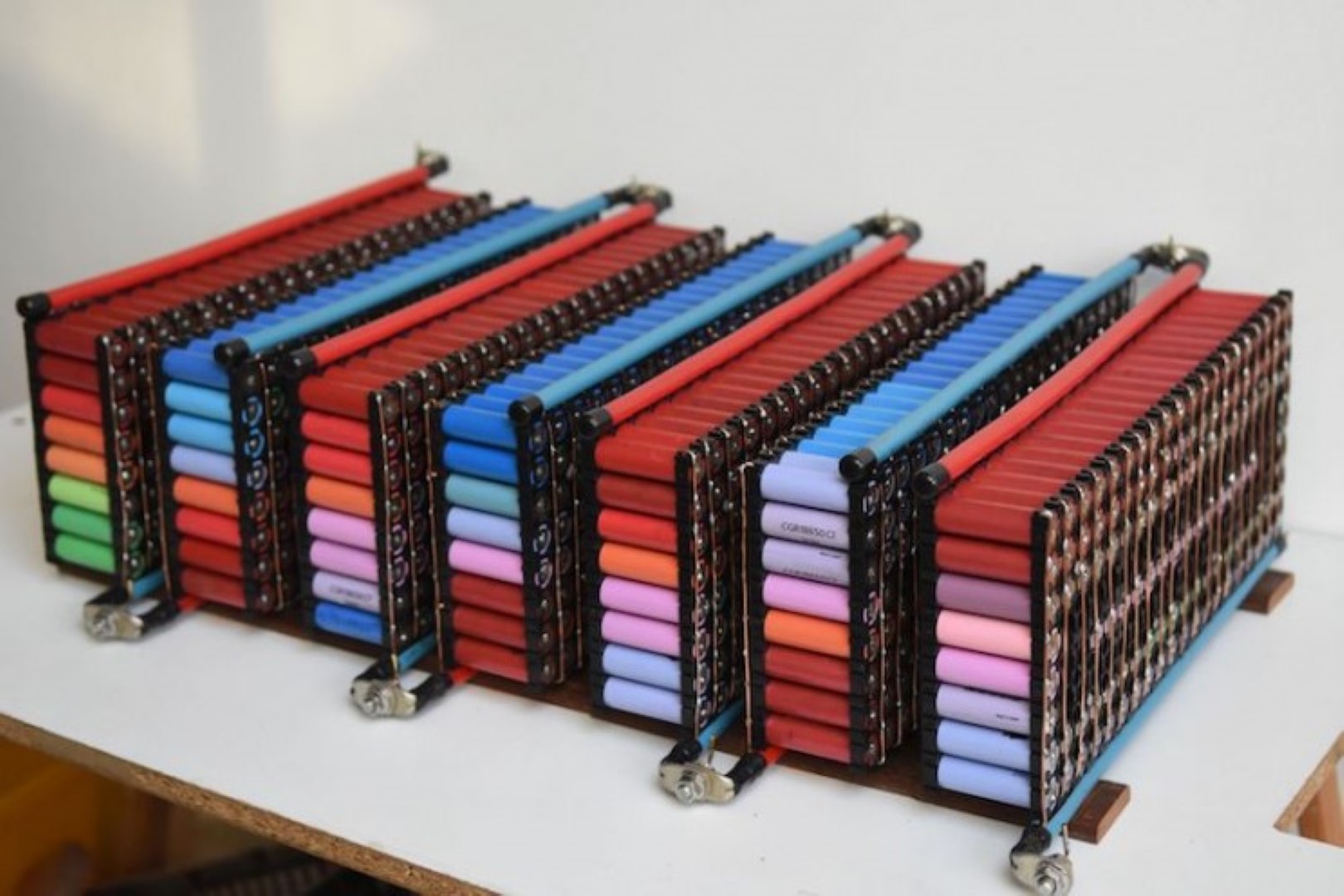
18 - Punktschweißen mit Fused-Nickelstrips

19 - Kupferbändchen als Busbars
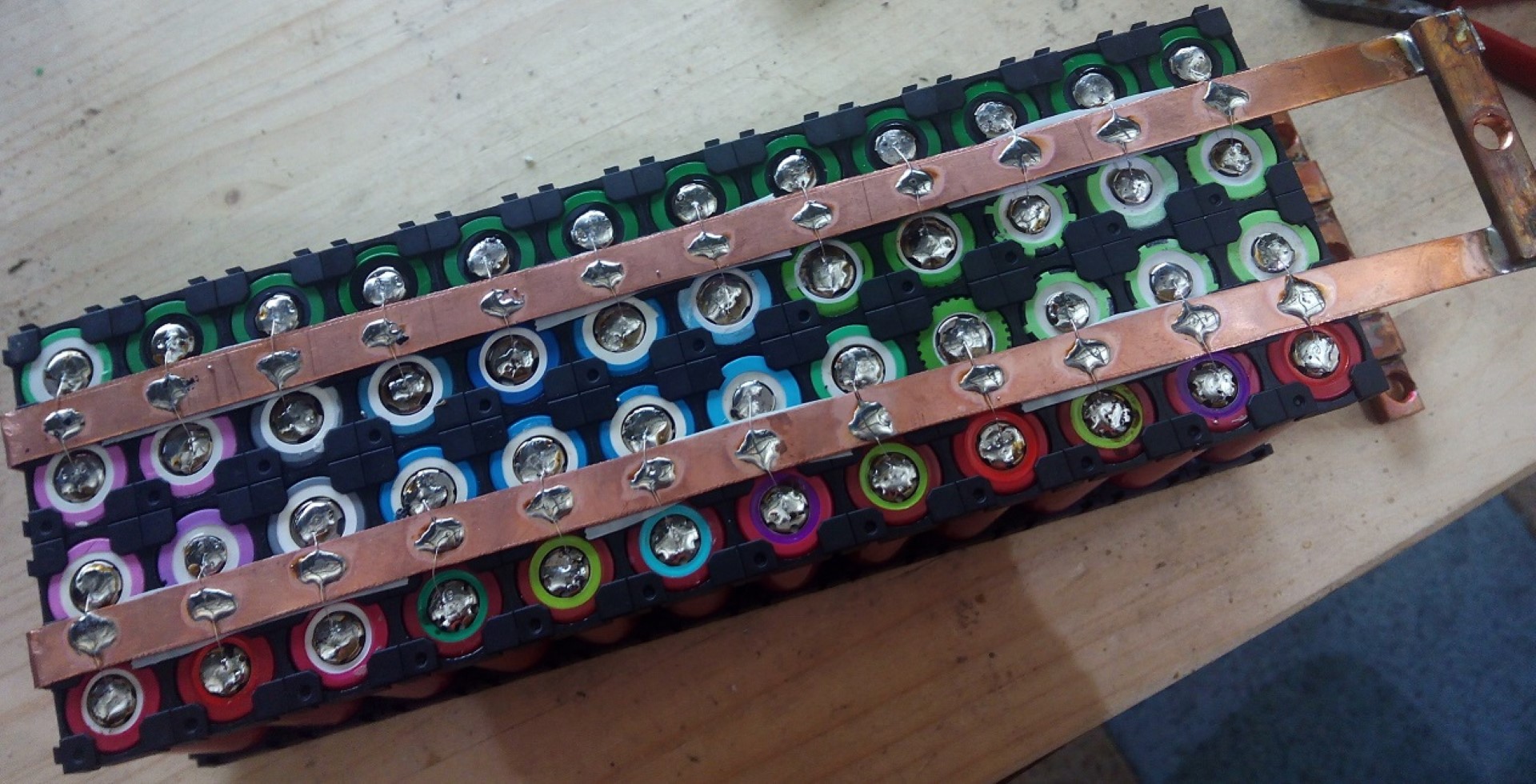
20 - Kupferbändchen als Busbars

21 - keine Ahnung, wie das funktioniert - ist auf jeden Fall nicht übersichtlich

22 - zwei dicke Busbars pro Seite mit massiven Verbindern

23 - große Packs
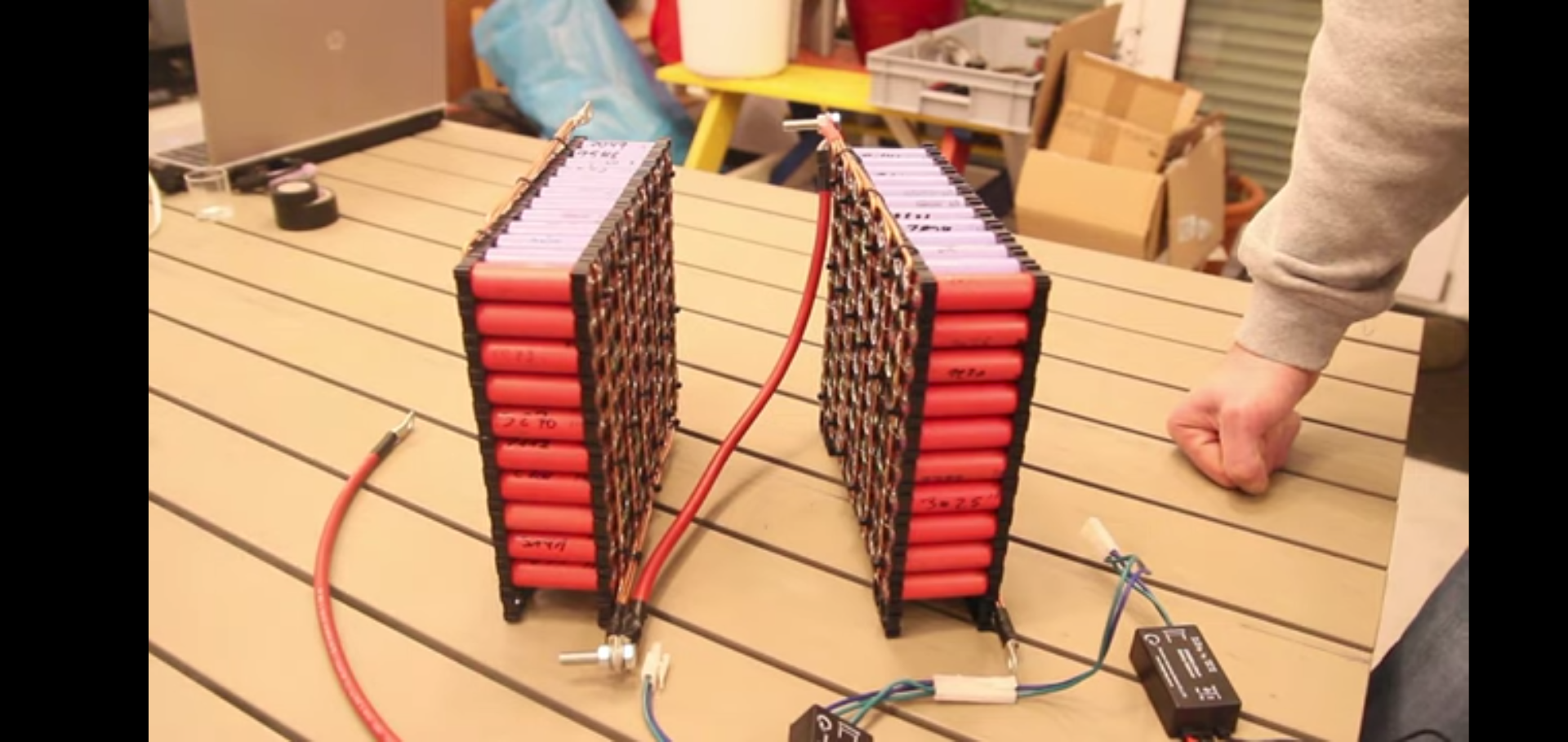
24 - plattgeklopfte Heizungsrohe als Sammelschienen an der Wand

25 - immer 2 Zellen an einem Sicherungsdraht

Welche Form Du nun für Deine eigene Powerwall nimmst hängt ab von
- der Größe Deiner geplanten Powerwall
- wie Deine Platzverhältnisse vor Ort sind (z.B. Plus und Minuspol auf derselbenseite oder gegenüberliegend benötigt unterschiedlich viel Platz)
- welche Materialien / Geldmittel Du zur Verfügung hast (speziell bei der Verwendung der Busbars, wenn man z.B. Kupfer-Flacheisen zur Verfügung hat kann man die gut nutzen, anstatt teuer Kupferkabel zu kaufen)
- Deinem persönlichem Geschmack ab
Ich habe mittlerweile 13 Powerwalls gebaut und nicht überall dasselbe Design sondern immer so, wie es am besten passt.
Was ich allerdings überall gleich mache, weil es sich (für mich) bewährt hat werde ich in den nachfolgenden Punkten aufzeigen.
Als Bauform benutze ich am liebsten die auf den Bildern oberhalb Nr. 14, 16 und 25
5.2) Akkupacks bestücken
Wenn die 18650er Zellen bereits alle getestet und in 50mAh oder 100mAh-Schritten sortiert sind geht es an das Bestücken der Akkupacks
Ich benutze dazu immer die ganz normalen, standardmäßigen Zellhalter (50er Pack 5x4 auf Aliexpress)
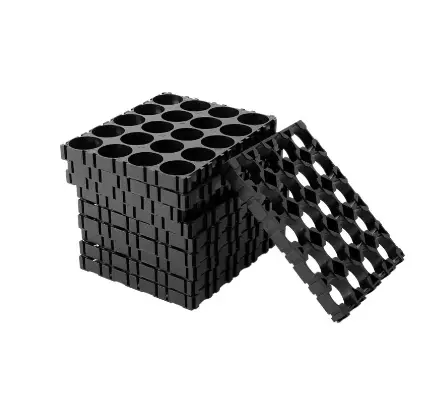
Die kosten im 50er Pack rund 20€ inkl. Versand aus China, wenn man über Aliexpress bestellt. Dort einfach nach "4x5 Zellhalter" suchen dann findet man schon unzählige Angebote. Ich bestelle meist 2x 50er Pakete zusammen, das geht bisher auch immer ohne weiteres durch den Zoll.

Nach dem Zusammenklippsen der Zellhalter (50er Pack 5x4 auf Aliexpress)

...geht es dann an das Bestücken
Tipp:
wenn Du Akkupacks baust, wo Plus- und Minuspol an derselben Seite des Packs enden dann achte darauf, dass Du bei der Bestückung des Packs so vorgehst, dass die Zellen mit hoher Kapazität an dem Ende sind, wo auch die Pole sind. Je weiter weg von den Polen desto schwächer die Zellen.

Wieso? Weil die Zellen, die direkt an den Polen verbaut sind stärker und mehr belastet werden als die, die weiter weg sind, weil durch die Entfernung und die damit verbundene Kabelstrecke der Busbar der Widerstand leicht ansteigt.
Indem man an den Polbereichen die stärksten Zellen verwendet gleicht sich das dann in etwa wieder aus da die stärksten Zellen nun auch am stärksten belastet werden, und die weniger starken Zellen auch weniger stark belastet.
Falls Du ausreichend Platz hast baue die Packs so, dass die Pole gegenüber liegen, so werden alle Zellen automatisch gleich stark belastet. Das macht vor Allem dann Sinn, wenn Du die Packs schmal und sehr lang baust, wie z.B. bei diesem 100p Pack hier:

bei 40er und 60er Packs ist das noch ziemlich egal, bei 80er sollte man schon zu gegenüberliegenden Polen übergehen, bei 100p ist das quasi "Pflicht"
5.3) Lötpunkte setzen
Nachdem die Zellen in den Zellhalter (50er Pack 5x4 auf Aliexpress) stecken geht es ans Löten.
Das Löten selbst besteht aus drei Lötschritten. Im ersten setzen wir nur einen kleinen Lötpunkt auf jeden Pol einer jeden Zelle, damit später der Sicherungsdraht gut und schnell darauf haftet.
Achtung:
Das Löten von LiIon Zellen kann gefährlich sein, wenn man sichnicht die Zeit nimmt um sich vorher zu informieren, wie genau das geht. Das habe ich schon mehrfach erwähnt und auch hier recht ausführlich erklärt -> 20 Löten - Anleitung für Akkus
Zum Setzen der Lötpunkte benutze ich einen 150W Lötkolben, einen Ersa 150S Lötkolben (erhältlich auf eBay und Amazon)

Ich hatte vorher einen billigen China-Lötkolben aber die Lötspitze sind aus weichem Kupfer und halten nur rund 100 Lötpunkte, dann muss man nachschleifen, das geht dann etwa 3 - 4 Mal dann ist die Lötspitze durch und es gibt nur sehr schwer passenden Ersatz. Seit dem Ersa-Lötkolben ist Ruhe und ich kann durchgängig und stressfrei arbeiten. Der hat eine Dauerlötspitze, die zudem auch filigraner ist und die Hitze besser dosiert (links Chinateil, rechts Ersa 150S Lötkolben (erhältlich auf eBay und Amazon)

Es reichen wirklich kleine Lötpunkte, große Kleckse sind gerade auf der Plusseite sogar eher gefährlich und obendrein ist es eine Verschwendung von Lötdraht

Tipp:
Auch wenn das schon wieder Geld kostet, aber bei den geplanten mehreren Hundert oder gar Tausend Lötungen ist ein Rauchabzug definitiv zu empfehlen, da Lötdämpfe gesundheitsschädlich sind.

Gibt es so wie hier auf dem Bild mit Schlauch auf eBay oder Aliexpress
Ich hab mir dann noch aus Pappe und Panzertape eine "Schnute" gebastelt, die den Rauch direkt dort abzieht, wo ich gerade arbeite, das funktioniert prima

5.4) Busbars verdrillen, biegen und löten
WIe die Busbar nun gebaut wird, ob aus ALuminium, aus Kupfer, aus Flachmaterial, als Rohr, ob aus einem einzelnen Kabel oder aus mehreren verdrillten ist erstmal egal, solange das wichtigste Passt: der Querschnitt.
Benutze diesen Online-Rechner um den benötigten Querschnitt zu ermitteln -> Kabellängen & Kabelquerschnitts Rechner
Ich selbst habe keine Quelle für Flacheisen oder Kupfer allgemein, also muss ich kaufen.
Ich benutze Kupferkabel als Einzeladern, die ich entmantele und dann verdrille. In meinen ANwendungsfällen bewährt hat sich:
- bis 60A -> 3x 2,5mm² Einzelader, doppelt gelegt als U-Form -> 15mm² Gesamtquerschnitt
- bis 120A -> 4x 4mm², doppelt gelegt als U-Form -> 32mm² Gesamtquerschnitt
dünner, also 1,5mm² ist mMn zu fummelig und auch mehr Arbeit, diese zu entmanteln als es der Aufwand wert ist,
dicker, also 6mm² ist schon sehr starr und kaum noch zu bewegen
Derselbe Händler hat auch preiswerte Batteriekabel zum Anschluss der Powerwall an den Wechselrichter / MPPT Laderegler
Wieso nicht ein dickes Kabel?
Das Verdrillen von mehreren dünnen Adern macht das Ganze flexibler als eine dicke, starre Einzelader.
Zum Abisolieren habe ich mehrere Techniken ausprobiert.
- Abisolierzange
- Elektriker-Abisoliermesser
- Teppichmesser
Am Ende bewährt weil schnell hat sich dann diese Methode:
1. Einzeladern in passend lange Stücke schneiden

2. mit einer Teppichmesser-Trapezklinge im Schraubstock die Einzelader abisolieren

wenn man anfängt mit dem Kabel an der Klinge ruckelnd hängen zu bleiben dann wird sie so langsam stumpf, dann einfach die Klinge einen Zentimeter weiter aus dem Schraubstock rausziehen.
Ich schaffe so in etwa 10 - 15 Kabelstücke, dann ist die Klinge an der Stelle stumpf.

3. ganz viele abisolierte Einzeladern

4. drei Adern in Schraubstock und Akkuschrauber einspannen und so lange verdrillen, bis sich die Busbar etwas verkürzt, so etwa 10 cm.

Das musst Du passend für Dein Gefühl machen und zwar so, dass die fertig verdrillte Busbar nicht so locker ist, dass sie labberig ist, aber auch nicht so fest, dass man sie nicht mehr gescheit biegen kann

bei mir sieht das dann so aus
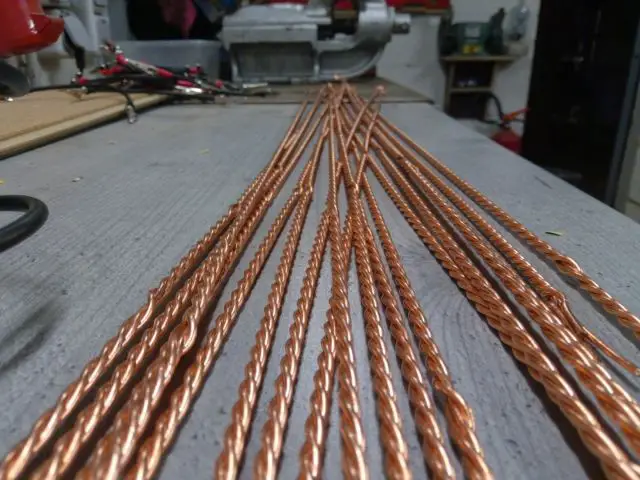
5. eine Biegeschablone basteln aus einem alten Holzbrett und ein paar Dübeln (8 oder 10mm)
Diese hier ist jetzt für zwei Busbars da das Brett so breit war, bringt aber im Grunde keinen Vorteil gegenüber einer Schablone für nur eine Busbar.
Nimm zum Abmessen der Abstände und Anzeichnen auf dem Brett einen Plastikhalter

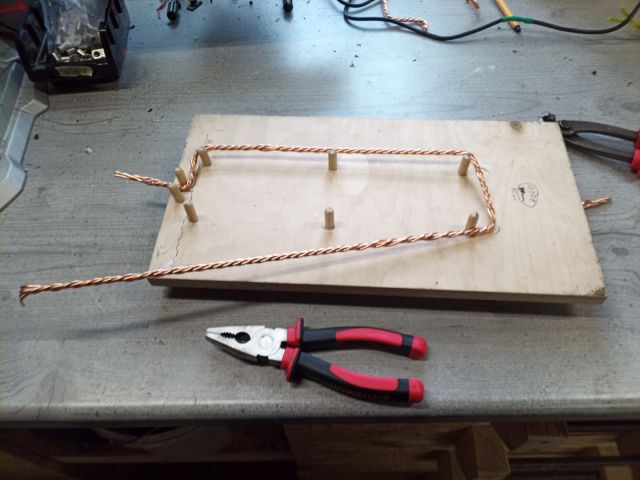
die krummen Enden mit einer Beißzange abzwicken
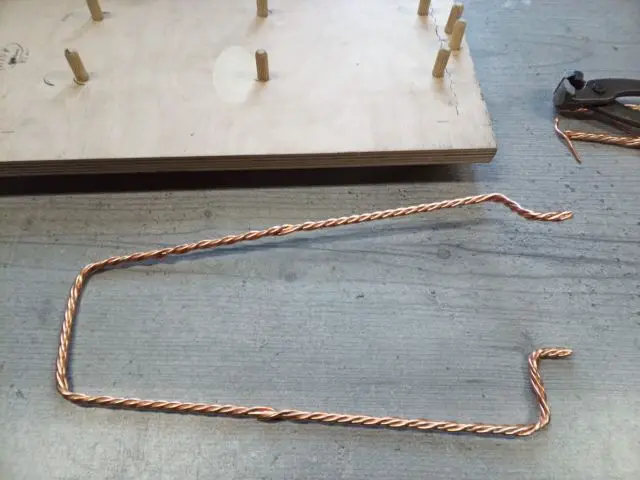
fertig gebogen sieht das noch etwas unschön aus

die beiden Enden werden mit Ringkabelschuhen in den Maßen SC16-6 zusammen geführt. Die "16" steht für "max. 16mm² Kabeldurchmesser" und die "6" für das Bohrloch passend für M6 Schrauben.

Bei der Variante mit 4x 4mm² nehme ich nicht einen dicken 35mm² Ringkabelschuh, denn da passen keine 2x 16mm² Busbars rein, sondern ich benutze zwei 16mm Ringkabelschuhe
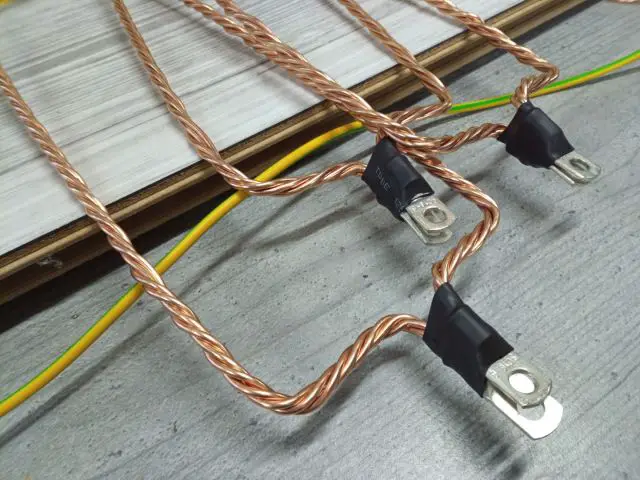
die Kabelschuhe werden erstmal locker von Hand drüber geschoben. 2x 3x 2,5mm² passen gerade eben so da rein

Ringkabelschuhe werden, genau wie Aderendhülsen, gecrimpt. Um die Verbindung zusätzlich besser leitfähig zu machen löte ich sie vor dem Crimpen aber immer noch zusätzlich innen, denn schlechte Verbindungen bedeuten einen hohen Übergangswiderstand und damit starke Erwärmung wenn viel Strom fließt
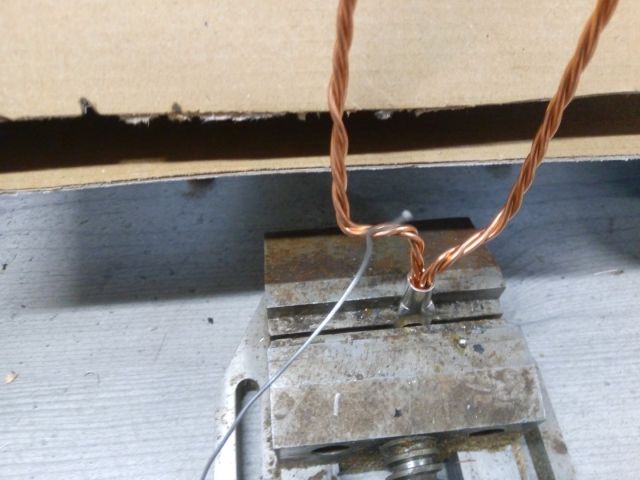
also erst mal mit dem dicken 200W Lötkolben gut erhitzen. Dann gebe ich Lötzinn zu, sodass der Ringkabelschuh etwa zu 2/3 gefüllt ist

im noch warmen Zustand wird dann 2x gecrimpt

Tipp:
besser als diese einfache Crimpzange oberhalb ist diese im Bolzenschneider-Design. Die kostet mit rund 25€ zwar etwa mehr aber die Verbindungen sind sicherer

Mehr Infos auch hier -> Akkus - 10 Werkzeuge + Messgeräte
sieht dann so aus. Das Lötzinn was zu viel ist drückt sich etwas raus und im Innern des Kabelschuhs sind nun alle Kupferdrähte perfekt mit dem RIngkabelschuh verbunden


zum Schluss noch Schrumpfschlauch (13mm Durchm./22mm Flachmaß in Rot / Schwarz = ideal für 16mm Ringkabelschuhe) über die Enden und einschrumpfen
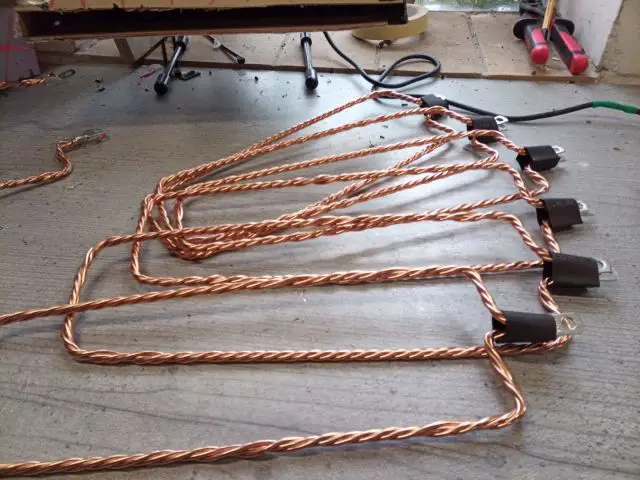
hier sind quasi alle Stationen zu sehen. Unten die Einzelaldern, darüber abisoliert, dann dreifach verdrillt und zum Schluss zurechtgebogen

Und hier sind auch nochmal alle Schritte in einem Video zusammengefasst
5.5) Busbars Kabelbinder & Sicherungsdraht löten
Nachdem in den vorherigen Schritten die Akkuzellen nun sortiert nach Kapazität auf den Zellhalter (50er Pack 5x4 auf Aliexpress) stecken und die Busbars fertig gebaut sind,
werden in diesem Schritt nun die Akkupacks fertig zusammen gebaut.
5.5.1 Kabelbinder
Zunächst werden die Busbars mit Kabelbindern am Akkupack beideitig fixiert.
Auch hier gibt es unterschiedliche Methoden, je nachdem, wie die Form der Akkupacks und der Busbars ist. Ich erkläre hier, wie ich meine Akkupacks baue mit der typischen Bauform mit 4 Zellen Breite.
Dazu 7mm Löcher in die Zellhalter bohren.
- an dem Ende wo die Pole Enden kommen die Löcher dzwischen die erste und zweite Zellenreihe
- am anderen Ende, wo die Busbar die Kehrtwende macht kommen die Löcher zwischen zweite und dritte Zellreihe
- bei 40p und 60p reicht das, bei 80p und mehr ist es sinnvoll, nochmal zwei Löcher in der Mitte der langen Akkupacks zu bohren

- danach das Akkupack wie auf dem Bild seitlich hinlegen, vier Kabelbinder (idealerweise 2,9mm x 300mm oder besser 3,5mm x 300mm) durchschieben,
- die Busbars beidseitig locker darüberstülpen
- Kabelbinder um die Busbar herumschlingen und wieder durch dasselbe Loch zurück - noch nicht festziehen, erst alle vier Kabelbinder locker fixieren

- die Busbar so ausrichten, dass die U-Biegung am Ende genau zwischen den Zellenreihen auf dem Plastik aufliegt
- erst dann die Kabelbinder festzurren und den überstehenden Rest abschneiden
(PS: auf den beiden folgenden Bildern sind die Busbars schon angelötet, keine Angst, der Schritt kommt nachher noch, ich hatte nur keine passenden Bilder auf der nur die Busbar zu sehen ist)


nachdem die Busbar mit den Kabelbindern festgezurrt ist kann man noch die beiden Hauptpole mit einer (Kombi-) Zange packen und ausrichten / etwas biegen, sodass die RIngkabelschuhe beide ordentlichparallel sind
5.5.2 Sicherungsdraht Löten:

Den nächsten Schritt, wie man nun Busbars und 18650er Zellen mittels Sicherungsdraht verbindet und dabei verhindert, dass beim Löten von LiIon etwas schlimmes passiert habe ich bereits ausführlich im eigenständigen Artikel erläutert, sodass ich das hier nicht nochmal schreibe sondern auf den Artikel verweisen möchte -> Akkus - 20 Löten - Anleitung für Akkus
Dort findest Du zu vielen allgemeinen Hinweisen und Sicherheitstipps auch ganz gezielt
- verwendeter Lötdraht
- Lötkolben
- ideale Löttemperatur
zum Abschluss nochmal ein kurzes Video zu den beiden hier beschriebenen Schritten
Tipp 1:
Was man im Video nicht sieht, da ich diese Technik erst später angewendet habe: es spart Zeit, wenn man den Sicherungsdraht am Stück lötet, also in einer großen Schlangenlinie von Zelle zu Zelle verlötet und dann am Schluss die Verbindungen durchknippst, die zu viel sind

Welche Verbindungen sind nun zu viel?
Ganz einfach: jede Zelle darf nur eine Verbindung zur Busbar haben und nicht noch eine zweite Verbindung zu einer anderen Zelle, da sich der Strom sonst aufteilen kann und der Sicherungsdraht dann nicht durchbrennt
Tipp 2:
Kontrolliere nach dem Löten nochmal alle Sicherungsdrähte kurz auf Festigkeit, indem Du einfach mit einem Finger reihum an allen Drähten kurz ziehst. Wenn ein Lötpunkt nicht hält geht der Sicherungsdraht dann ab und Du kannst ihn wieder nachlöten / richtig löten
5.6) Powerwall Kiste zusammenbauen


Dieser Schritt ist optional!!
Wie man die Powerwall nun lagert / aufstellt ist jedem selbst überlassen und kann auch höchst unterschiedlich sein.
Ich habe meine Powerwalls zum Großteil im Haus und daher eine feuerfest ausgekleidete Metallkiste gebaut was auch Bestandteil meines Sicherheitskonzeptes im Umgang mit LiIon ist, s. auch hier -> Akkus - 22 Sicherheitskonzept
Wenn Du Dir auch eine feuerfeste Kiste bauen willst dann schau am besten hier rein, da habe ich den Bau Schritt-für-Schritt dokumentiert
- KW31 - Solarakku Akkupacks bauen, Dummy-Load, Berufsschule-Akku1
- KW33 - Berufsschulakku fertig, Akkukiste
- KW42 - Solarakku 2 fertig, MPI 10k, SDM630 Einbau
Hier auch nochmal als Zeitraffer-Video
Alternative zur Metallkiste: Metallschrank / Spind

- KW04 - DIY 18650 Powerwall Spind 1
- KW05 - DIY 18650 Powerwall Spind 2
- KW06 - DIY 18650 Powerwall Spind 3
- KW07 - DIY 18650 Powerwall Spind 4
- KW08 - DIY 18650 Powerwall Spind 5
- KW09 - DIY 18650 Powerwall Spind fertig
weitere Arten, eine Powerwall aufzustellen














5.6) Kann man die nutzbare Kapazität eines fertigen Akkupacks bestimmen?
Ja. Einerseits rechnerisch, indem man die Einzelkapazitäten der verbauten Zellen aufsummiert.
Problem:
Die oben vorgestellten Kapazitäts-Messgeräte testen alle den vollen Spannungsbereich zwischen 4,20V bis runter zu 2,80V oder 2,60V.
Das ist für einfache Anwendungen wie Taschenlampen, RC-Modelle, Powerbank etc. in Ordnung, aber damit unsere Powerwall möglichst lange lebt wollen wir den Spannungsbereich einschränken, in welchem die Lithium Zellen genutzt werden.
Üblich ist hier ein Spannungsbereich zwischen 4,0V und 3,3V. Ich selbst benutze 4,05V bis 3,30V
Eine Reduzierung des nutzbaren Spannungsbereiches hat aber auch zur Folge, dass die nutzbare Kapazität sinkt, da sie nicht mehr voll ausgeschöpft werden kann.
Nach meinen persönlichen Messungen "verliert" man bei einem Spannungsbereich von 4,05V bis 3,30V recht genau 20% gegenüber der maximalen Kapazität bei 4,20V bis 2,60V
Das bedeutet:
Um die Pack-Kapazität zu bestimmen kann man die gemessenen EInzelkapazitäten addieren und am Ende dann 20% abziehen
Alternative, genauere Methode:
Man kann die Pack-Kapazität auch durch Messen ermitteln. Nur geht das nicht mit den o.g. Kapazitätstestern, sondern man benötigt dazu zwei Dinge:
1. ein regelbares Ladegerät oder 300W Labornetzteil um das Akkupack auf exakt 4,0V (oder eben 4,05V) aufzuladen

2. eine sog. "elektronische Last" oder auch "Dummy Load" um den geladenen Akku bis auf 3,30V zu entladen und dabei die Kapazität zu messen

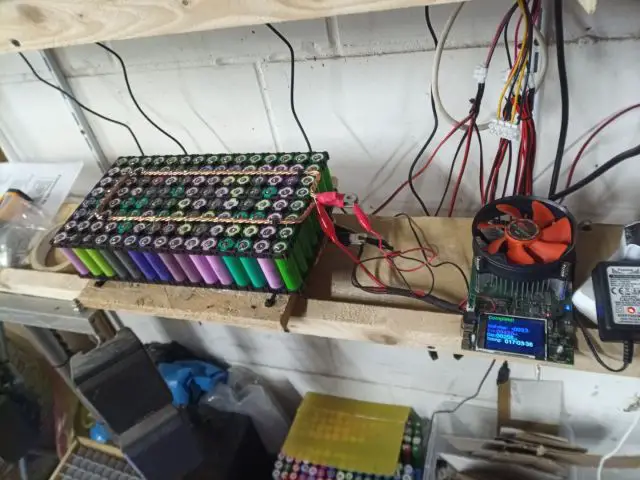
Hierzu gibt es im Menü ein eigenes Kapitel mit detaillierter Beschreibung -> Akkus - 16 kpl. Akkupacks testen
|
Du findest unsere Beiträge hilfreich und möchtest uns unterstützen?  Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten und zwar ganz ohne, dass es Dich etwas kostet (hier klicken) |
6.) Balancen der Packs und Zusammenbau der Powerwall
Menü-Übersicht:
- 18650 Zellen sammeln
- Akkus zerlegen
- Zellen testen & sortieren
- Zusammenstellung der Akkupacks, Theorie & Praxis
- Akkupacks bauen - aber sicher
- Balancen der Packs und Zusammenbau der Powerwall
- Wechselrichter anschließen, Powerwall in Betrieb nehmen
- Internetseiten mit Infos rund um DIY Solar & Powerwall
6.1) manuelles Balancing
Bevor Du die Powerwall zusammenbaust, also die einzelnen Akkupacks in Reihe schaltest, ist es unbedingt erforderlich, diese vorher zu balancen.
Was bedeutet das und wozu?
Wie an anderer Stelle bereits geschrieben müssen in einer Reihenschaltung mit Batterien, egal welcher Art, die Spannungen der einzelnen Batterie(packs) gleich sein.

Ein aktiver / passiver Balancer kann zwar im laufenden Betrieb dafür sorgen, dass sich die Spannungen angleichen, aber wenn schon zu Beginn die Spannungen auseinanderdriften, und das auch noch von 14 Packs, dann wird der Balancer allerhand zu tun haben und Tage, evtl. sogar wochenlang arbeiten müssen - oder sogar garnicht hinterher kommen.
- Daher: vor dem Zusammenbau alle Packs manuel = von Hand balancen.
- Wie: das ist furchtbar einfach
- in einem Satz: 48 Stunden alle Packs parallel schalten
Ich habe mir dazu ein paar Kabelstücke in etwa 12cm Länge abgeschnitten und...

...mit Krokodilklemmen (Aliexpress / eBay) versehen

Achtung:
Beim parallelen Zusammenschalten von Akkus fließen mitunter sehr hohe Ausgleichsströme. D.h. vom Akku mit höhrerer Spannung fließt ein Strom zum AKku mit der niedrigeren Spannung. Je höher die Spannungsdifferenz, desto höher der Strom.
Daher sollten die Spannungen beim Zusammenschalten schon recht nah beieinander liegen. Im Beispiel wie hier, da wir nur einzelne Packs mit rund 4,0V zusammenschalten darf der Unterschied zwischen den Packs ruhig 0,5V betragen, der Ausgleichsstrom wird recht niedrig sein bei 1 bis maximal 5 Ampere kurzzeitig.
Gegenbeispiel: möchte man später einmal zu einer bereits fertigen Powerwall mit 48V Arbeitsspannung dann eine zweite Powerwall parallel dazuschalten, dann sind 0,5V Spannungsdifferenz schon sehr viel und es fließen Ströme mit um 100A - was enorm viel ist und Kabel und Stecker zum Schmelzen bringen kann.
Um auf Nummer sicher zu gehen habe ich deswegen
- ein Verbindungsstück als KFZ-Sicherung mit 10A gebaut
- ein Multimeter dazwischen geschaltet mit Messung der Stromstärke
So kann ich mit einer Kabel-Krokodilklemme (Aliexpress / eBay) erstmal den einen Pol parallel verbinden, und den anderen Pol dann mit 10A abgesichert und mit dem Multimeter schauen, wieviel Strom fließt. Hier Beispiel sind es nur minimale 0,4A also alles im sehr grünen Bereich
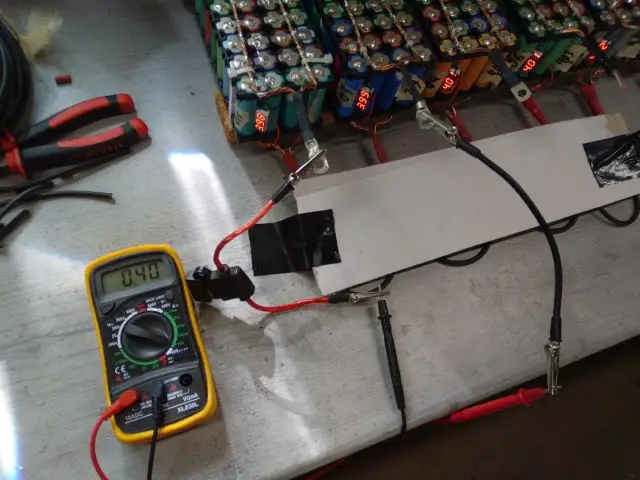
Standard-Krokodilklemmen (Aliexpress / eBay) können dauerhaft maximal 2A verkraften, liegt der gemessene Ausgleichsstrom also unterhalb der 2A dann tausche ich die Sicherungs-Klemme gegen eine normale, gehe weiter zum nächsten Akkupack und...

... wiederhole dort den Vorgang

bis schließlich alle 14 Packs parallel miteinander verbunden sind.
Tipp:
die Pappe habe ich als Schutz über die unteren Pole gelegt, damit es nicht zu einem Kurzschluss kommt, falls mal eine der oberen Krokodilklemmen (Aliexpress / eBay) ab geht und nach unten kippelt
Dauer:
48 Stunden die Akkupacks so belassen.Wieso? Ganz einfach, die Spannungsdifferenz zwischen den einzelnen Packs wird sehr niedrig sein, d.h. die Ausgleichsstöme sind ebenfalls niedrig - die Kapazität der Packs aber sehr groß.
Das wiederum bedeutet, dass sich die Ladung zwischen den Packs nur sehr langsam angleichen wird und das Balancing Minimum 48 Stunden Zeit braucht. Im Winter, wenn es kalt ist (unter 10°C) und die LiIon Zellen sehr träge Ladung abgeben und aufnehmen würde ich die Balancing-Dauer mindestens verdoppeln.

6.2) Zusammenbau der Powerwall
Nun kommt der Zusammenbau der Powerwall an die Reihe.
Klingt vielleicht erstmal kompliziert, ist es aber nicht. Es sind im Grunde nur 4 Schritte
- Akkupacks in Reihe schalten
- BMS anschließen
- Sicherungen einbauen
- Wechselrichter anschließen -> s. nächstes Kapitel
6.2.1 Akkupacks in Reihe schalten
Es gibt natürlich viele mögliche Bauformen für Akkupacks. Die gängigsten beiden benutze ich selbst auch. Nr. 1 ist wie auf den bisherigen Bildern auch so, dass Plus und Minuspol auf derselben Seite des Packs sind. Das macht man dann, wenn der Platz beengt ist, sodass man nur an eine Seite der Packs rankommt, z.B. beim Einbau in einen Schranke / Regal / Kiste / Spind.
Um die Packs nun in Reihe zu schalten muss man immer vom Plus des einen Packs auf den Minus des nächsten gehen.
Ich benutze dafür
- Ringkabelschuhe in SC16-6 (= für 16mm² Kabel und 6mm Bohrloch) oder SC35-6 (= 35mm² Kabel und 6mm Bohrloch)
- Schrauben, Unterlegscheiuben und Muttern in M6

Wichtig:
richtig doll festziehen, nicht bloss so bissel. Über diese Verbindung fließt später der komplette Strom, der Kontakt muss daher super gut sein.
Bei einer schlechten Verbindung (Dreck dazwischen, nicht richtig festgezogen) kann diese so heiß werden, dass die Isolierung wegschmilzt und sogar ein Feuer entsteht. Also nicht von Hand oder mit einer Zange oder sonstwas rumeiern sondern
- mit zwei Schraubenschlüsseln festziehen
- solche Verschraubungen zum Schluss immer nochmal kontrollieren
Tipp:
die Busbar-Enden mitsamt Ringterminals kann man in der Regel noch bissel biegen, bis die Ringterminals schön flach aufeinander liegen.
Sollte das mal nicht gehen weil die Busbar zu dick ist, wie in meinem Fall mit den 120p Packs und den dicken 8x4mm² Busbars dann hilft dieser Trick:

Ich habe mir ein Kupferrohr mit 6,2mm Innendurchmesser und 2mm Wandstärke besorgt und in 2cm lange Stückchen geschnitten. Das dient nun als Abstandshalter zwischen den Ringterminals und sorgt für einen guten Stromfluss da die M6 Schraube an sich einen zu niedrigen Querschnitt hätte.
Ansonsten, um von einer Etage in die nächste "zu hüpfen" kann man ein Stück Kabel mit zwei Schraubterminals nehmen. Idealerweise mit zwei unterschiedlich farbigen Schrumpfschlauch (13mm Durchm./22mm Flachmaß in Rot / Schwarz = ideal für 16mm Ringkabelschuhe) , damit man beim Montieren nicht aus Versehen die Polung vertauscht.

die verwendete Crimpzange findest Du hier -> Werkzeuge + Messgeräte

Bei der Variante der Akkupacks, bei denen Plus- und Minuspol an entgegengesetzten Enden sind...

...ist das Zusammenschalten wesentlich einfacher, denn da sind die Pole nicht so dicht beisammen und man hat mehr Platz zum Verschrauben ohne so extrem aufpassen zu müssen, dass man mit den Schraubenschlüsseln einen Kurzschluss verursacht




6.2.2 BMS anschließen
Gleich mal vorab:
wenn Du im Internet irgendwo gelesen hast, dass man sich bei LiIon Zellen ein BMS sparen kann: das ist absoluter und völliger Blödsinn, ein super gefährlicher Rat und und Leute die soetwas behaupten haben keine Ahnung.
Deswegen bitte mein gut gemeinter Rat und das ist ein Fakt:
Sobald man LiIon Zellen in Reihe schaltet, und da ist es völlig egal ob eine Zelle oder 100, egal ob gebraucht oder neu, egal ob günstig oder teuer:
ein BMS ist Pflicht, Aus, Punkt, Ende der Diskussion. LiIon Zellen ohne BMS sind gefährlich und die Verwendung grob fahrlässig, ein gefährlicher Brandfall ist somit vorprogrammiert und nur eine Frage der Zeit.
Zur Erklärung, was ein BMS ist, was es macht und wo der Unterschied zum Balancer ist -> BMS + Balancer
Installations-Ort:
- Das BMS gehört so nah es geht an den Akku ran, also nicht erst Akku -> 2m Kabel -> BMS
- alle BMS-Modelle, die ich bisher in Häänden hatte (rund 50 verschiedene Modelle) und im Netz gesehen habe werden imPrinzip auf dieselbe Weise angeschlossen: sie kommen in den Minus-Strang zwischen Akku und Verbraucher bzw. Stromquelle.
Hier im Bild geht der Minuspol (rotes Kabel unten) direkt durch zum Wechselrichter (bzw. ist noch eine Sicherung dazwischen geschaltet, die man hier im Bild nicht sieht, s. nächstes Kapitel).
Der Minuspol der Batterie geht zum BMS, von dort aus geht es dann weiter zum Wechselrichter (bzw. geht auch der Minuspol erstmal zur Sicherung).
Im Fehlerfall (Überlast, Unterspannung, Überspannung, Überhitzung, Unterkühlung, Kurzschluss, zu große Spannungsdifferenz zwischen den einzelnen Packs, Verpolung, ...) unterbricht das BMS dann den Minuspol an dieser Stelle, wie ein Relais
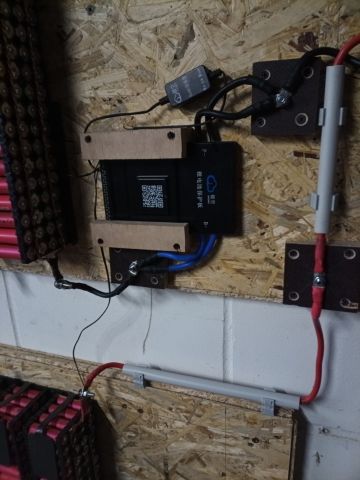
Hier findest Du das BMS-Modell, welches ich benutze samt ausführlicher Erklärungen, wie man es einstellt und benutzt -> aktiv Balancer BMS
6.2.3 Sicherungen einbauen
Es macht aus mehreren Gründen Sinn, die Powerwall im Gesamten nochmal abzusichern und nicht direkt an den Wechselrichter anzuschließen
- zusätzliche Sicherheit
- man kann die Powerwall sehr einfach vom Rest abtrennen, z.B. wenn man etwas verändern möchte oder um eine Wartung durchzuführen
Achtung:
Bitte nicht diese Sicherungsautomaten aus dem KFZ-Bereich benutzen
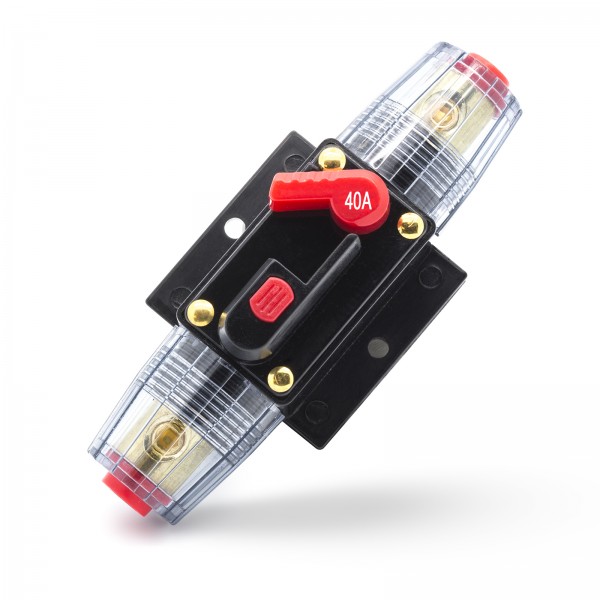

Die obere Variante hatte ich zu Anfangs auch in Benutzung, und die sind einfach nicht für den Dauerbetrieb mit derart hohen Strömen einer Powerwall ausgelegt.
Schon bei 30A wurde die Sicherung bedenklich heiß, und dass obwohl sie für 100A spezifiziert war.
Viele Bastler benutzen stattdessen sog. ANL Sicherungen. Das sind Schmelzsicherungen, ebenfalls aus dem KFZ-(Hifi)Bereich.
Die sind zwar für hohe Dauerbelastung ausgelegt, aber die Nachteile sind:
- wenn sie auslösen sind sie durchgebrannt und eben zerstört, man muss eine neue Sicherung (für ca. 3,50€ pro Stück) kaufen und einsetzen
- "mal eben" herausnehmen für eine Wartungsarbeit an der Powerwall ist immer mit Schrauberei verbunden
daher mein Tipp:
Sicherungsautomaten in Standard-Din-Größe, also wie im normalen Sicherungskasten / Zählerschrank im Haus auch.
Aber:
bitte keine normalen Sicherungsautomaten benutzen, denn die sind für AC also Wechselspannung ausgelegt, nicht aber für DC / Gleichspannung.
Gleichspannung hat die Besonderheit, dass es im Moment des Zusammenschließens zweier Kontakte zu einem Lichtbogen kommt, der kurzzeitig einen sehr hohen Strom haben kann und schnell eine normale AC-Sicherung zerstört.
Deswegen DC-Sicherungsautomaten
Hier gibt es verschiedene Hersteller und Modelle, ich selbst benutze die DC-Sicherungsautomaten von FEEO (aus China).

Die haben eine gute Qualität und sind kein Billigschrott, besitzen intern einen speziellen Lichtbogenschutz
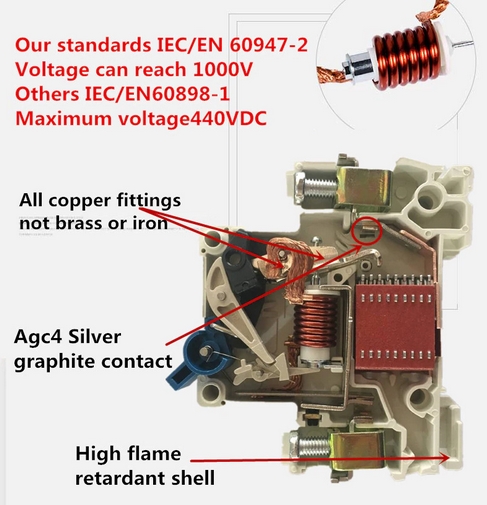
Die haben ein gültiges CE-Zertifikat, es gibt sie in unterschiedlichen Stärken und kosten etwa 7€ pro Stück als Doppelsicherung wie auf dem Bild oben
Dazu dann einen kleinen Aufputz-Sicherungskasten.

Als 4er oder 6er kostet sowas etwa 10€ -> einfach auf eBay nach "Aufputz Kleinverteiler" suchen

So abgesichert haben wir nicht nur ein zusätzliches Sicherheitslevel, sondenr können auch die Powerwall mal eben wegschalten, um an der Anlage zu schrauben.
6.2.4 Wechselrichter anschließen -> s. nächstes Kapitel
Je nachdem, welchen Wechselrichter man benutzt ist auch das Anschluss-Schema unterschiedlich, weswegen ich darauf in einem separaten Kapitel eingehen möchte
7.) Wechselrichter anschließen, Powerwall in Betrieb nehmen
Menü-Übersicht:
- 18650 Zellen sammeln
- Akkus zerlegen
- Zellen testen & sortieren
- Zusammenstellung der Akkupacks, Theorie & Praxis
- Akkupacks bauen - aber sicher
- Balancen der Packs und Zusammenbau der Powerwall
- Wechselrichter anschließen, Powerwall in Betrieb nehmen
- Internetseiten mit Infos rund um DIY Solar & Powerwall
Nicht jeder Wechselrichter ist geeignet, um ihn mit einem Akku zu betreiben. Hier braucht man einen speziellen Batteriewechselrichter.
Hier ist es zudem extrem wichtig, dass die Batteriespannung auch zum Eingangsspannungsbereich des Wechselrichters passt.
Sprich:
hat der Akku / die Powerwall 48V dann muss der Wechselrichter auch 48V EIngangsspannung vertragen können. Im Zweifelsfall also immer die Herstellerangaben / das Datenblatt / Handbuch beachten.
Zu den verschiedenen Arten an Wechselrichtern und auch Anlagenkonzepten findest Du hier nochmal detailliertere Informationen:
Hier nochmal (m)ein Anschluss-Schema mit MPPT Solar-Laderegler, Batteriewechselrichter und 48V Powerwall als Null-Watt-Einspeisekonzept
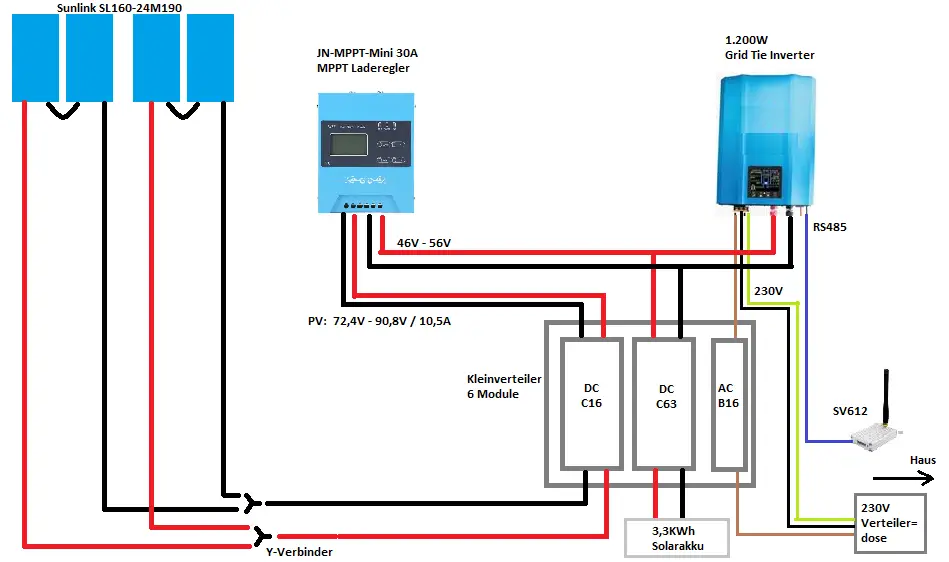
Hier schematisch nicht erfasst aber bei allen Anlagenschemata gleich: der Anschluss der Powerwall folgt immer demselben Prinzip
Powerwall -> BMS (Minuspol) -> Sicherung -> (Batter- oder Hybrid)Wechselrichter
Der Wechselrichter sollte unbedingt auch nochmal separat an 230V abgesichert sein, also mit einem AC Sicherungsautomaten entsprechend seiner Leistung.
Beim Verkabeln der Powerwall mit dem Wechselrichter hat auch wieder der DC-Sicherungsautomat eine sehr positive Funktion.
Ohne DC-Sicherung müsste man die Batteriekabel direkt an den Wechselrichter anschrauben, und im Moment des Kontaktes fließt wieder kurzzeitig ein sehr hoher Strom und es kommt zur Lichtbogenbildung, da sich die internen Kondensatoren des Wechselrichters schlagartig und im Bruchteil einer Sekunde aufladen. Das "batscht" ganz schön und man hat einen ordentlichen Funken an den Anschlussklemmen.
Mit DC-Sicherung lässt man diese erstmal ausgeschaltet, verkabelt alles in Ruhe und erst wenn alle Kabelverbindungen sicher und ordentlich verschraubt sind legt man die Sicherung um. Die Kondensatoren laden sich zwar noch immer schlagartig, aber das macht nichts und ist ja prinzipiell OK. Aber diesmal gibt es keinerlei Lichtbogen.
Wenn nun Powerwall, BMS und Wechselrichter (ggf. separater MPPT Laderegler) miteinander verkabelt sind kann man alle Geräte starten und einrichten.
Hier mal noch als Übersicht meine DIY 18650 Tesla Powerwall in der Garage, die ich nutze um das Elektroauto zu laden im Video erklärt:
|
Du findest unsere Beiträge hilfreich und möchtest uns unterstützen?  Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten und zwar ganz ohne, dass es Dich etwas kostet (hier klicken) |
8.) Internetseiten mit Infos rund um DIY Solar & Powerwall
Menü-Übersicht:
- 18650 Zellen sammeln
- Akkus zerlegen
- Zellen testen & sortieren
- Zusammenstellung der Akkupacks, Theorie & Praxis
- Akkupacks bauen - aber sicher
- Balancen der Packs und Zusammenbau der Powerwall
- Wechselrichter anschließen, Powerwall in Betrieb nehmen
- Internetseiten mit Infos rund um DIY Solar & Powerwall
Da Solar in Eigenregie bauen, DIY Powerwall und Selbstbau generell nicht sehr verbreitet ist findet man auch per Google erstmal nicht so viele hilfreiche Informationen und man muss schon genauer schauen und etwas länger suchen.
Deshalb möchte ich hier ein paar Quellen auflisten, die ich selbst nutze und von denen ich sehr viel gelernt habe.

Und nochmal der Hinweis: das ist keine Werbung, wir erhalten weder Geld noch Waren noch sonst irgendeine Vergünstigung durch Nennung der Links, ich möchte hier lediglich die Erfahrung, die ich für mich gemacht habe auch anderen zugänglich machen.
8.1 Diskussionsforen:
- https://forum.drbacke.de -> 1. Anlaufstelle für DIY Solar & Powerwalls im deutschsprachigen Raum, nette kleine Community
- https://secondlifestorage.com -> 1. Anlaufstelle für DIY Solar & Powerwalls international (Englisch), große Community
- https://powerforum.co.za -> Forum aus Süd-Afrika (Englisch) mit internationalem Publikum, freundliche, pragmatische Community
- https://www.photovoltaikforum.com/ -> größtes deutsches Photovoltaikforum, für Selbstbau nur bedingt offen
8.2 Youtube Channels auf Deutsch
8.3 Youtube Channels auf Englisch
- Pete von HBPowerwall
- AverRage Joe
- Daniel von DIY Tech & Repairs
- Adam Welch
- The Kilowatt Challenge
- DavidPoz
- jehugarcia
Vorsicht Influencer
Einige der o.g. Youtube-Channels machen auch Werbung durch Produktplatzierung, erhalten also Geld für ihre Empfehlung und gehören demnach zu den sog. Influencern -> Influencer einfach erklärt: Definition, Bedeutung & FAQ
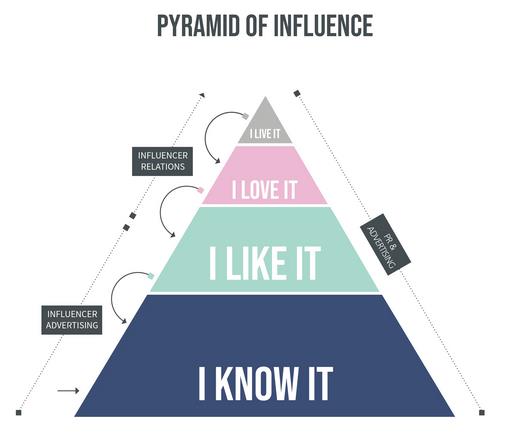
(Bildquelle: dmexco.com
Daher mein Rat:
- Produktempfehlungen im Internet immer kritisch hinterfragen (was hat derjenige, der hier empfiehlt davon?)
- falle nicht auf Influencer (= bezahlte Werbemacher) oder
- Fake-Amazon-Testberichte (Artikel als Pdf downloaden falls die Seite offline sein sollte: {phocadownload view=file|id=14|target=b}
- hinterfrage immer die Quelle
Inhaltsverzeichnis:
- 1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)
- 2 Idee + Plan
- 3 Akku-Arbeitsplatz
- 4 eBike Akku Komponenten
- 5 eBike Akku zerlegen
- 6 Laptop Akkus zerlegen
- 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte
- 8 neue Hülle für 18650
- 9 China-Akkutest
- 10 Werkzeuge + Messgeräte
- 11 Null-Watt Einspeisung
- 12 Modbus / RS485 Adapter
- 13 BMS + Balancer
- 14 aktiv Balancer BMS - JKBMS
- 15 Ladegeräte + Kapazitätstester
- 16 kpl. Akkupacks testen
- 17 Innenwiderstand Ri
- 18 Solar Laderegler
- 19 Wechselrichter, Inverter
- 20 Löten - Anleitung für Akkus
- 21 Schlüsselanhänger aus 18650
- 22 Sicherheitskonzept
- 23 Akkus Beschaffung - wie und wo?
- 24 WVC / SG / GMI / PVGS Mikroinverter
- 25 Schritt-für-Schritt zur 18650 Powerwall
- 26 ATS - Automatic Transfer Switch
- 27 Schottky Sperrdioden für Parallelschaltung
- 28 Balkonsolar & Balkonkraftwerk
- 29 Hybrid Wechselrichter einrichten
26 ATS - Automatic Transfer Switch
Hier möchte ich erklären, wie ich mit Hilfe eines ATS, also eines automatischen Umschalters, von einer PV-Anlage je nach Bedarf zwischen zwei unterschiedlichen Wechselrichtern hin- und herschalte.
Und zwar habe ich ganz praktisch das Problem, dass das System in der Garage aus vier Hauptkomponenten besteht
- PV-Module
- MPPT Solar-Laderegler (EPever Tracer)
- 18650 Powerwall
- Batterie-Wechselrichter (SoyoSource GTN1200W)

Der MPPT lädt die Powerwall und sobald eine Last anliegt (das E-Auto wird über die Wallbox geladen) dann nehmen sich die beiden SoyoSource Wechselrichter Strom aus der Powerwall und speisen in die Wallbox ein.
Soweit so gut.
Problem:
Wenn die Akkus der Powerwall voll geladen sind und die Sonne weiter scheint, dann kann keine weitere Energie mehr aufgenommen werden und die Sonnenenergie verpufft.
Besser wäre, wenn die überschüssige Energie ins Hausnetz eingespeist werden würde, um dort die Grundlast zu decken. Doch das können die Soyo Source Wechselrichter nicht. Das können nur sog. Hybrid Wechselrichter und der günstigste, mir bekannte Hybrid, der das netzparallel kann ist der MPP Solar MPI 5.5k bzw. das baugleiche Modell von Infinisolar der E 5.5k -> s. auch Akkus - 19 Wechselrichter, Inverter
Beide Varianten kosten rund 1.000€ und das ist eine ganze Ecke teurer als mein Setup hier in der Garage.
Lösung:
Ein zweiter Einspeisewechselrichter, ein automatischer Umschalter sowie eine Spannungswächter
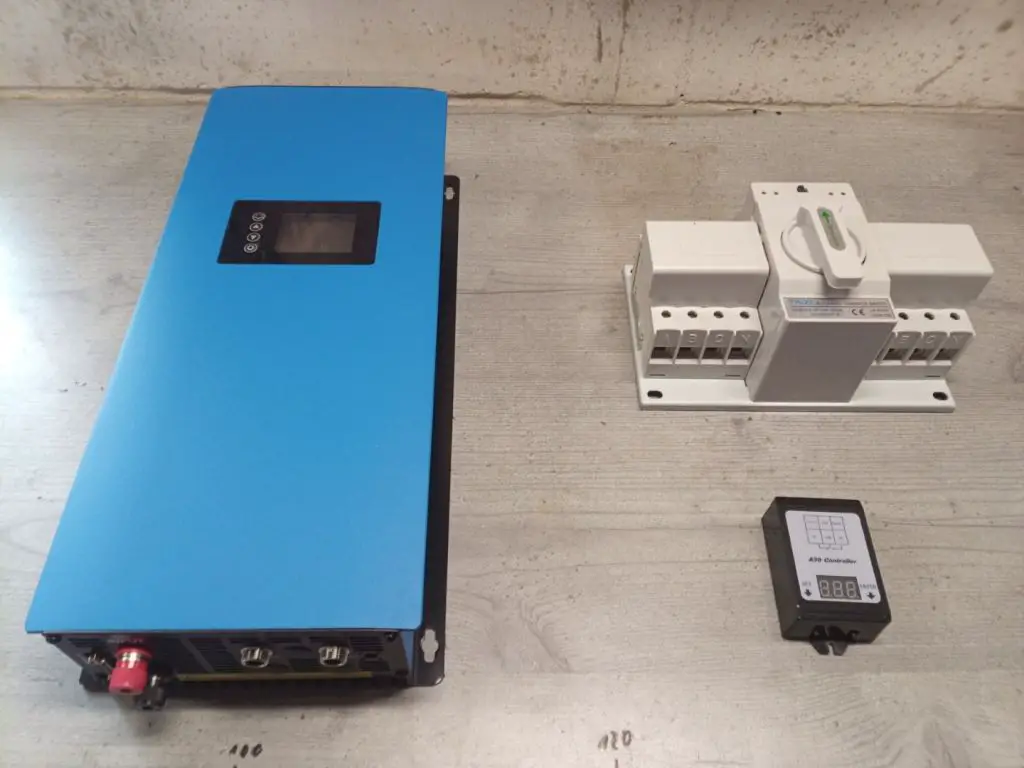
Der Plan:
Sobald die Powerwall voll ist soll die PV-Anlage umgeschaltet werden auf den zweiten Wechselrichter, der dann ins Netz einspeist.
26.1 Der Wechselrichter
Als zusätzlichen Wechselrichter zum Einspeisen des PV-Überschusses habe ich mich für einen SUN GTIL2 2000W entschieden.

Mit runden 300€ inkl. Versand aus Deutschland (eBay) war das die günstigste Alternative mit einer PV-Eingangsspannung bis 90V. Billigere Wechselrichter schaffen meist nur 65V und das ist für mein System zu wenig, da ich je zwei PV-Module in Reihe geschaltet habe und daher eine Arbeitsspannung von um 80V.
Mehr Infos zu dem SUN GTIL2 sowie Handbuch und CE-Zertifikat als Download im Menü unter -> Akkus - 19 Wechselrichter, Inverter
26.2 ATS - Automatic Transfer Switch
Zum Umschalten habe ich diesen ATS bestellt.
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
Hier gibt es unzählige Varianten, die im Grunde alle gleich funktionieren: ein Servomotor in der Mitte schaltet die seitlichen Sicherungsautomaten um.

Ursprünglich gedacht sind solche ATS, um das komplette Hausnetz umzuschalten zwischen Netzbezug und Notstrom, also Akkubetrieb.
Achtung:
Qualität und auch technische Umsetzung sind eher schlecht und ich würde auf keinen Fall empfehlen, solch ein ATS aus China zum Umschalten von 230V und großen Lasten zu benutzen.
Daniel vom Youtube-Kanal "DIY Tech & Repair" hat hierzu ein gutes Video gemacht, in welchem er so einen ATS mal zerlegt und auf die Gefahren hinweist
zum Umschalten haben die ATS alle oberhalb ein kleines Terminal. Dort bekommt der Motor 230V.
- 1x Eingang = Phase für Schalterstellung links
- 1x Eingang = zweite Phase für Schalterstellung rechts
- 2x N (Nullleiter) = gleich für beide Schalterstellungen
Es gibt zwei Varianten von ATS.
Variante 1 hat ein Terminal mit vier Eingängen so wie oberhalb beschrieben
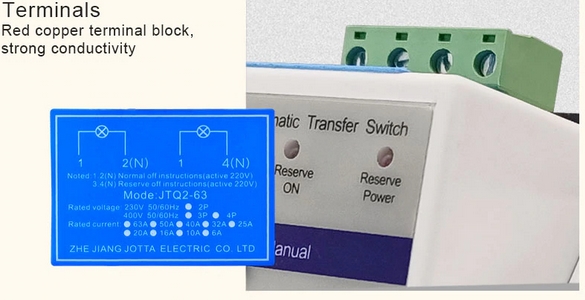
Variante 2 hat ein Terminal mit sechs Eingängen so wie bei mir hier:
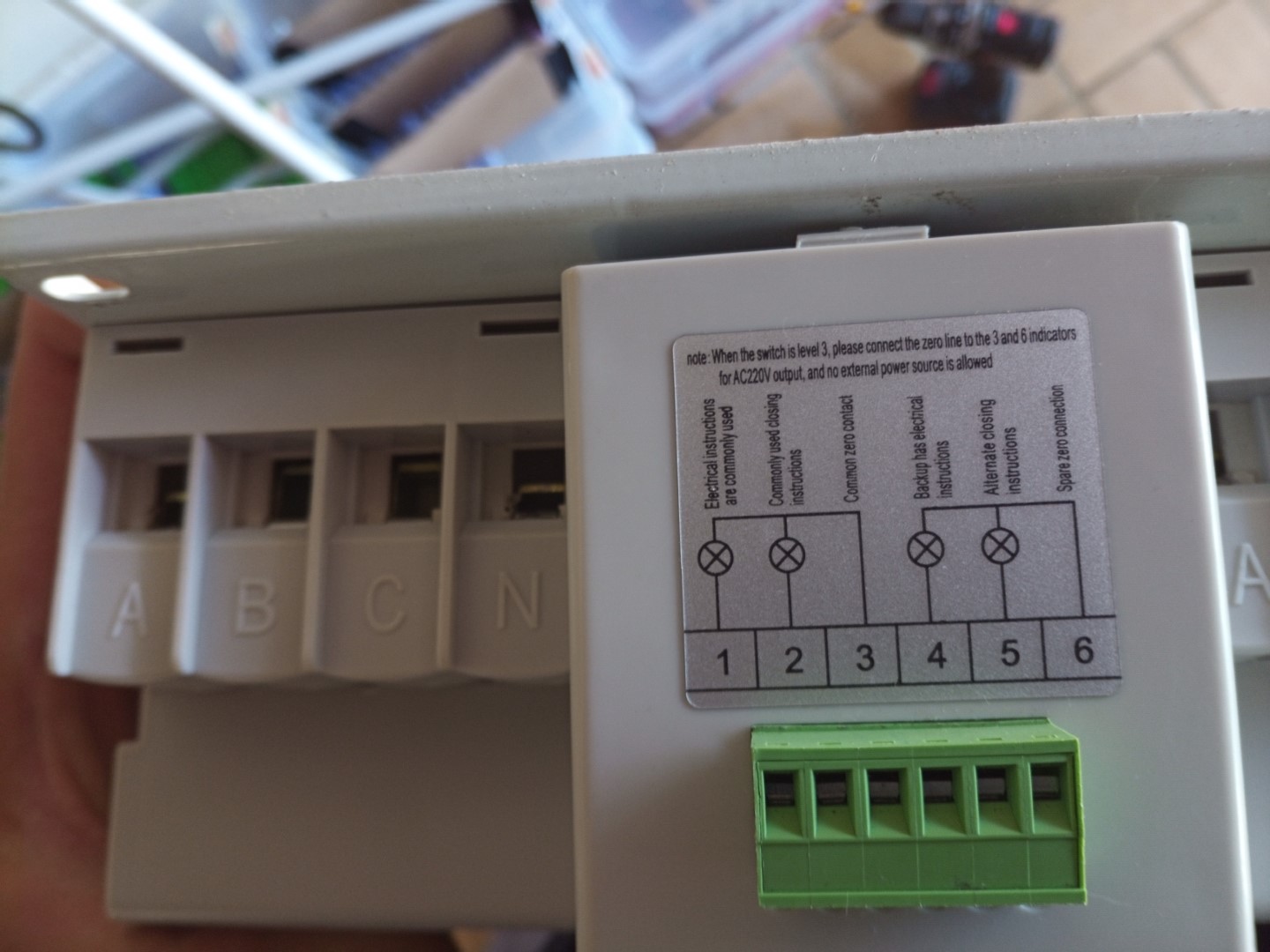
in diesem Fall ist die Belegung so:

D.h. es müssen je zwei Terminaleingänge mit jeweils einer Phase belegt werden. Dazu kann man auch eine kleine Drahtbrücke verwenden.
Die beiden N-Eingänge kann man auch mittels Drahtbrücke miteinander verbinden.
Ideal ist ein ATS mit 4P und 63A
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
Ich habe bereits zwei PV-Anlagen mit einem ATS ausgestattet und dazu zwei unterschiedliche ATS-Modelle entsprechend umgebaut.
hier findest Du die beiden Anlagen mit ATS:
- 2021 - KW19 - Sonnenterrasse auffüllen 2 & DIY 18650 Powerwall ATS
- 2021 - KW26 - Heidi-PV ATS, Vorgartenpflege, Hochbeete1
Den Umbau findest Du direkt unterhalb als Anleitung genauer beschrieben,
Anleitung zum Umbau eines AT
- Wieso und weshalb umbauen?
- ATS öffnen
- 230V Kabel abtrennen
- 230V Kabel neu verbinden
- ATS wieder zusammenbauen
1. Wieso und weshalb umbauen?
Achtung Lebensgefahr:
wie im oberen Video von DIY Tech & Repair gezeigt und auch in dem Bild unterhalb zu sehen gehen je zwei Kabel von der Steuerelektronik zu den Schraubterminals. Auf diesen beiden Kabeln liegen 230V an.
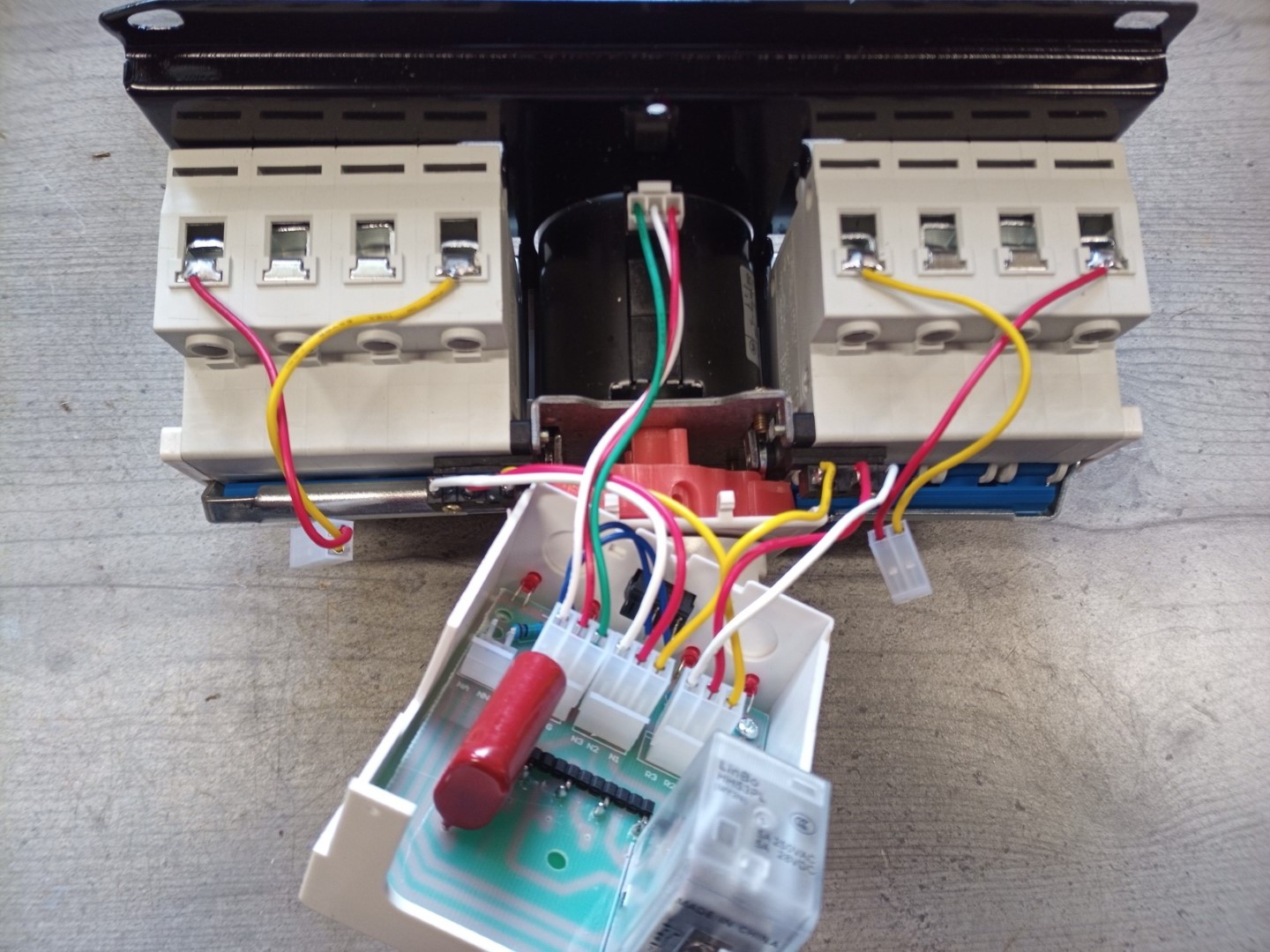
Das hat zur Folge, dass 230V von der Steuerspannung her auf den Schraubterminals anliegen wo die PV-Leitungen dran sollen.
Wenn man also nicht 230V umschaltet sondern z.B. so wie ich die PV-Spannung muss man unbedingt diese Kabel von den Schraubterminals abtrennen.
Am Beispiel eines ATS von Jotta (recht gängig, auf ALiexpress und auch eBay zu haben, in Varianten als 2er / 3er und 4er Umschalter) möchte ich erläutern, was man wo umbauen muss um ein ATS gefahrlos als Umschalterfür PV zu benutzen.


Die Vorgehensweise ist übertragbar auch auf alle anderen ATS Modelle da die Funktionsweise dieselbe ist, ich habe nur das ATS von "Jotta" gewählt, da ich hier beim Umbau recht viele Bilder gemacht habe und es so gut erklären kann.
2. ATS öffnen
Zum Öffnen des ATS auf der Rückseite 2 - 4 Schrauben lösen und dann den Mittelteil soweit möglich abnehmen.
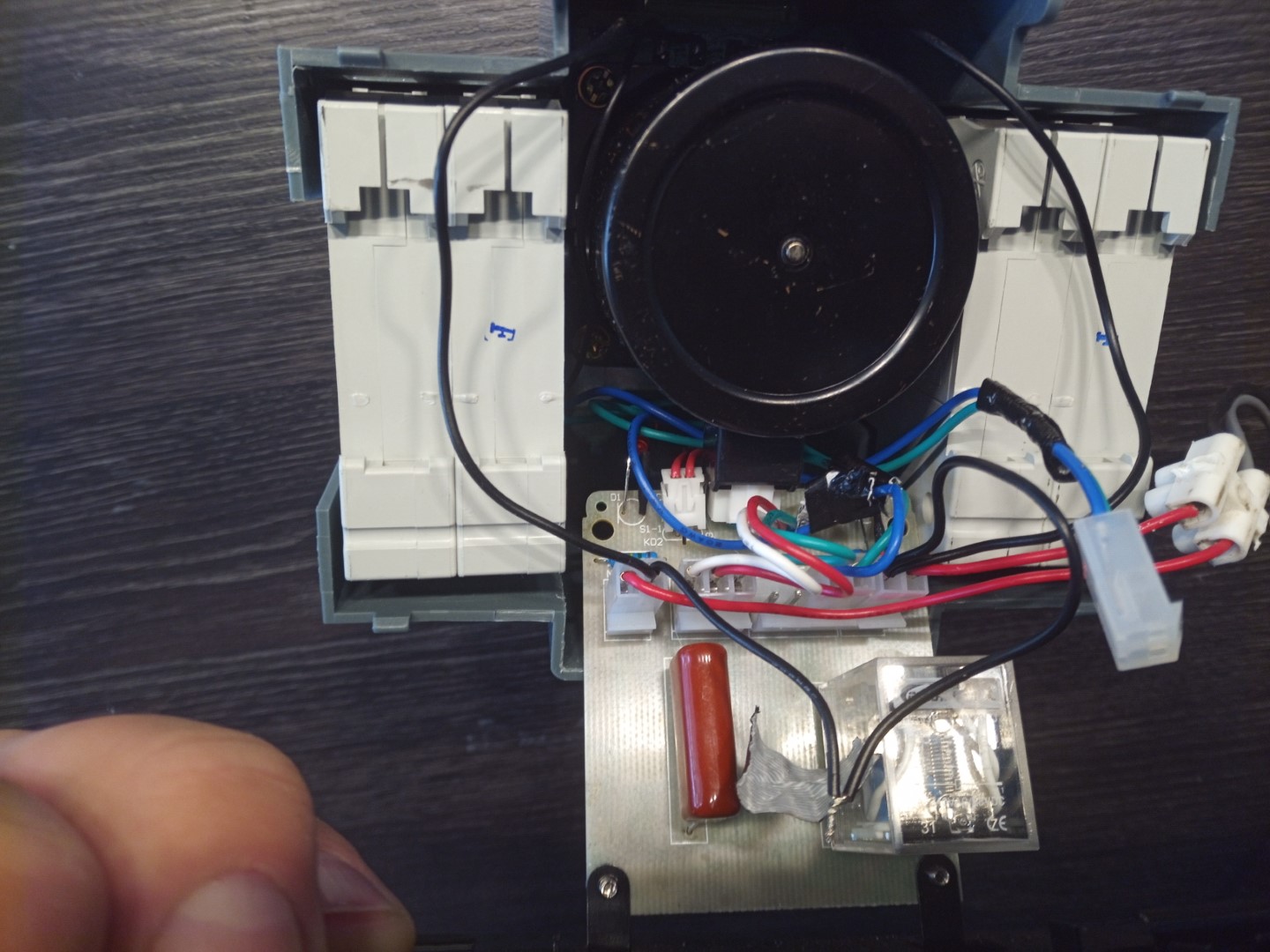
Die seitlichen Abdeckungen die über die Sicherungsschalter gehen braucht man nicht entfernen, das geht meist so.
Wir müssen nur an den Mittelteil ran wo alle Kabel zusammenlaufen und das Relais sitzt. Die Platine kann man mit etwas Wackeln ein Stück weit rausziehen.
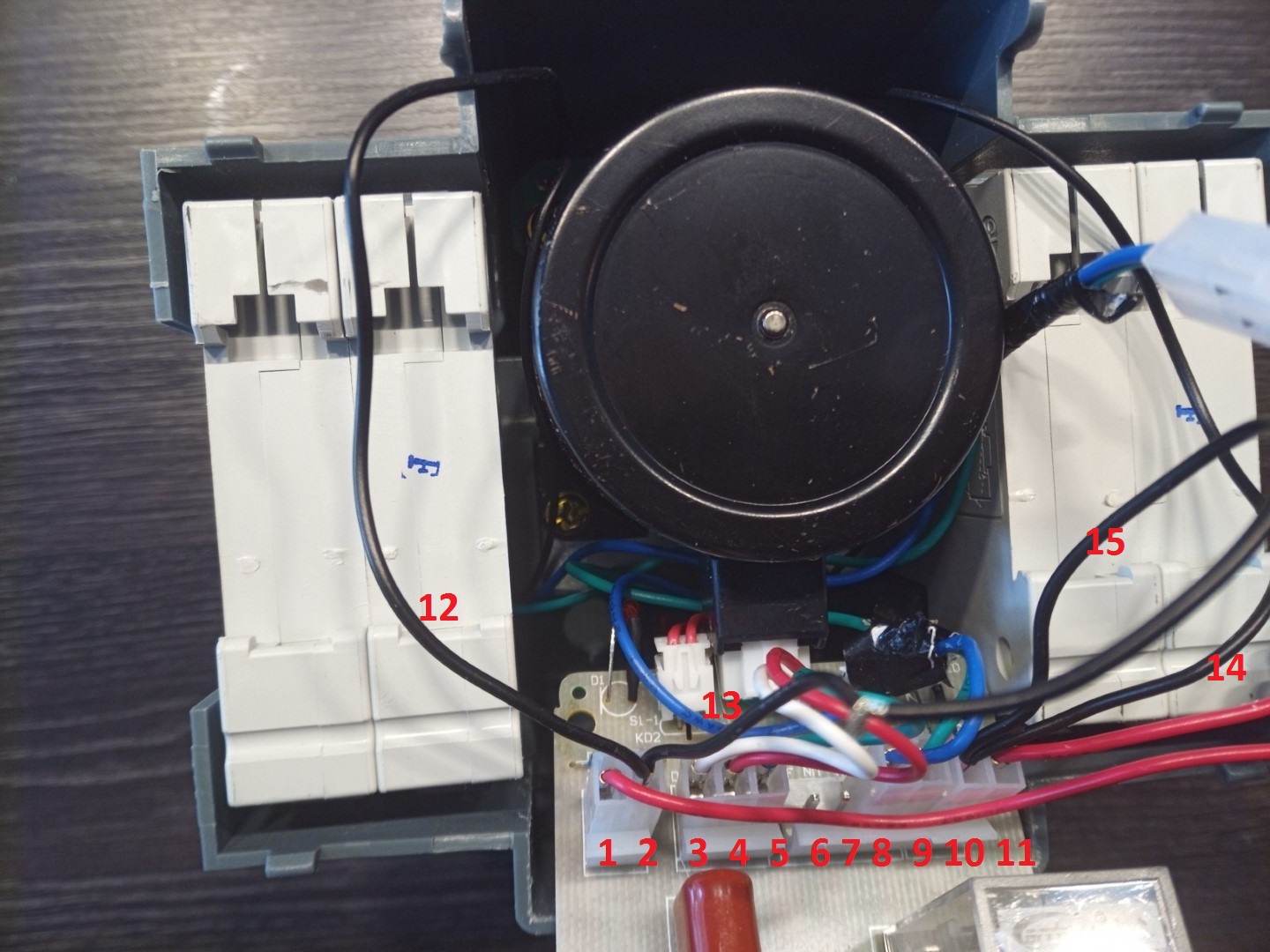
Ich hab hier auch mal die Belegung notiert:
| Nummer | Stecker | Belegung |
| 1 | Stromvers. links* |
L1 vom Sicherungsblock links* (unbedingt abtrennen) |
| 2 | Stromvers. links* | Null |
| 3 | Motor | |
| 4 | Motor | |
| 5 | Motor | |
| 6 | Endschalter links | zu Pin 7 gebrückt wenn Drehschalter rechts |
| 7 | Endschalter links | L1 durchgeschaltet wenn Drehschalter links |
| 8 | Endschalter rechts | zu Pin 9 gebrückt wenn Drehschalter links |
| 9 | Endschalter rechts | L1 durchgeschaltet wenn Drehschalter rechts |
| 10 | Stromvers. rechts | Null |
| 11 | Stromvers. rechts |
L2 vom Sicherungsblock rechts (unbedingt abtrennen) |
| 12 | Null vom Anschlussterminal | |
| 13 | Null vom Sicherungsblock links (unbedingt abtrennen) | |
| 14 | Null vom Anschlussterminal | |
| 15 | Null vom Sicherungsblock rechts (unbedingt abtrennen) |
*Links = Draufsicht Anschlussplatine = Frontansicht Drehregler = "Bat" = "N Normal power"
Rechts = Draufsicht Anschlussplatine = Frontansicht Drehregler = "WR 2" = "R Backup Power"
hier noch die Rückseite der Platine
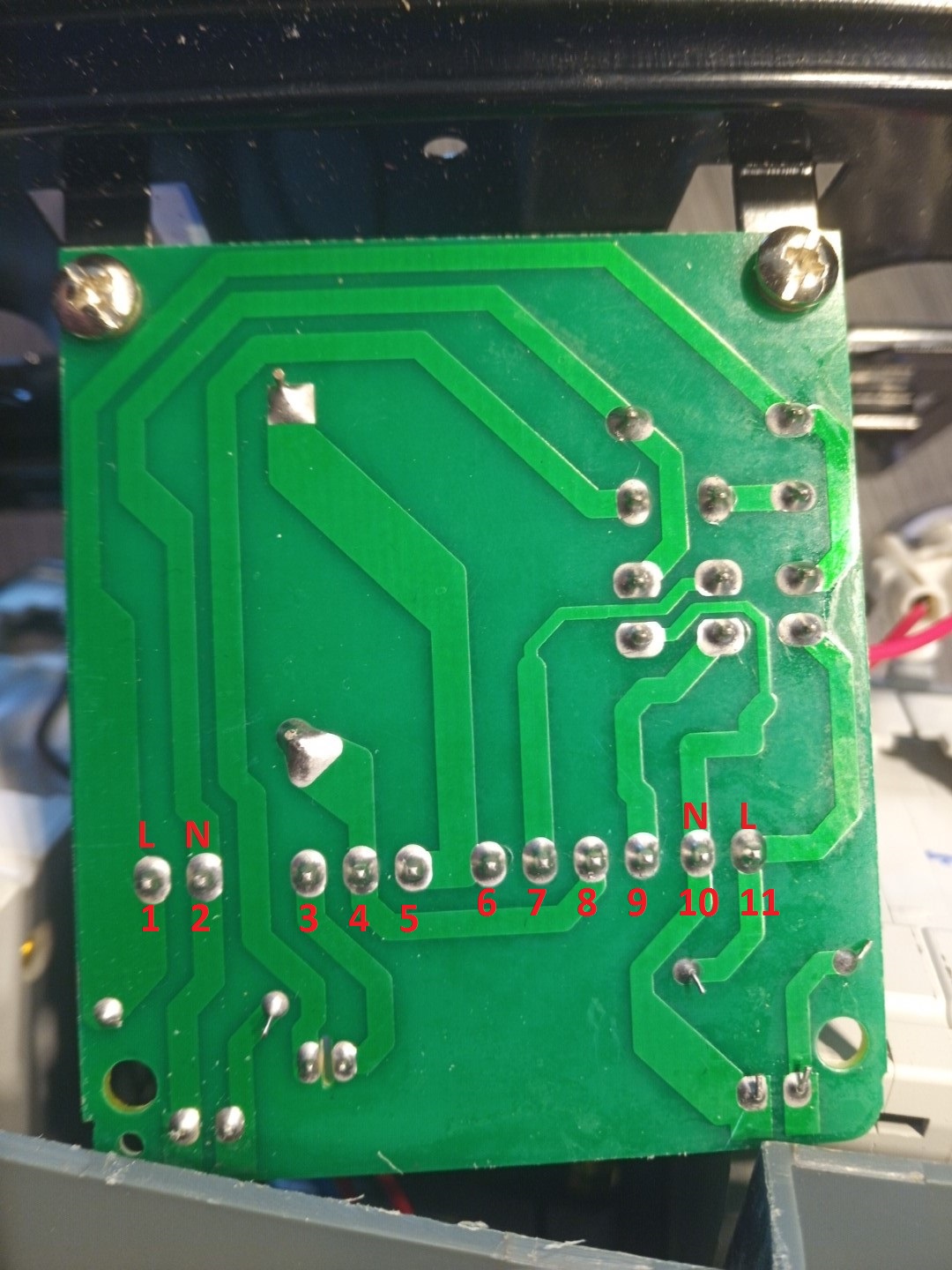
das Relais schaltet den Motor des Umschalters
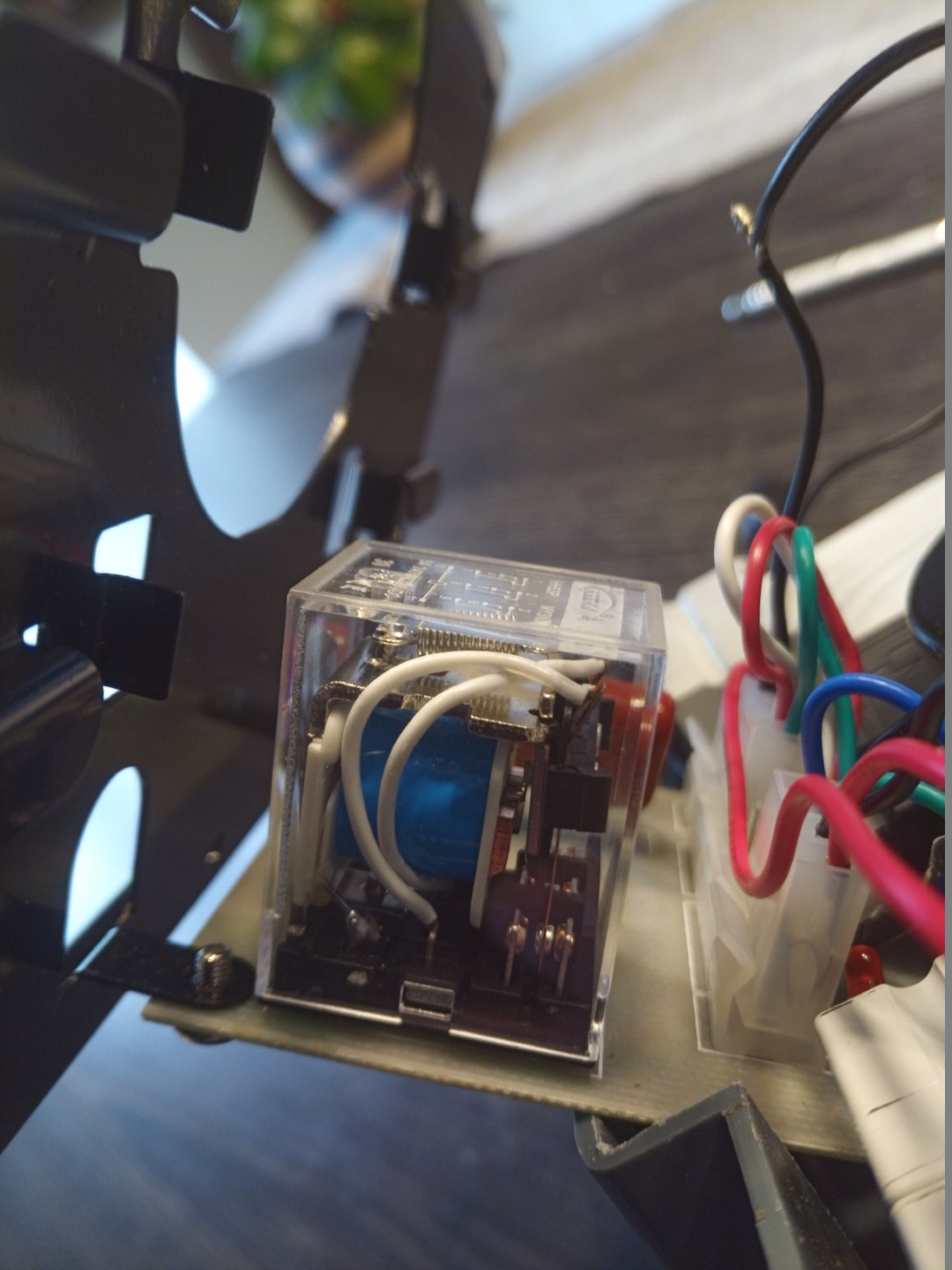
3. 230V Kabel abtrennen
Im Beispielbild oben ganz zu Anfang geht das "Abtrennen" sehr einfach da die Kabel gesteckt sind, das ist ein ATS von "Apneu"
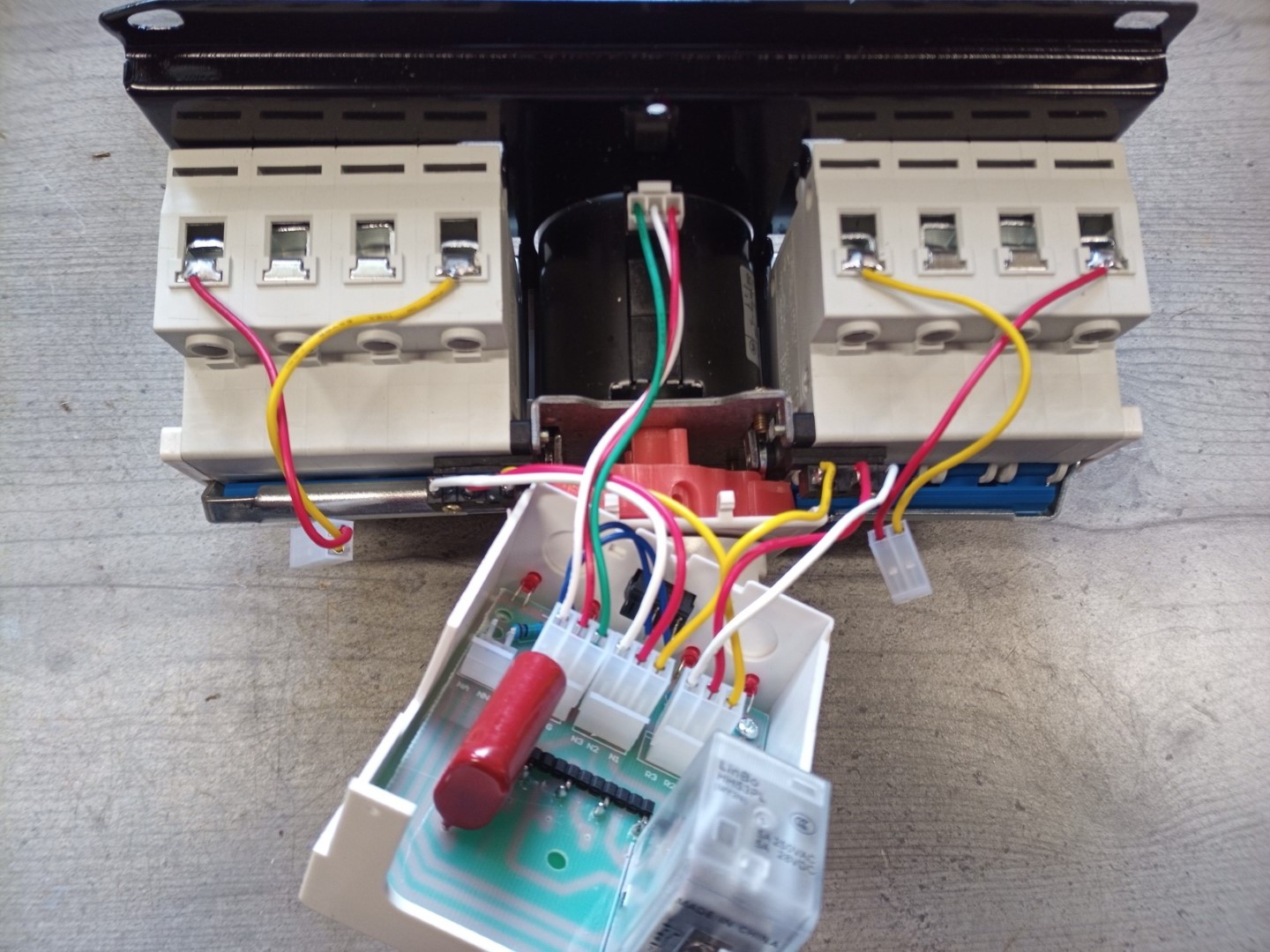
Anders sieht es aus beim ATS von "Taixi TXQ5" bei dem es anstatt einer Platine mit Steckern unzählige Einzelstrippen gibt, die man zum Großteil alle einzeln durchmessen muss, da auch die Farbmarkierungen völlig konfus sind und permanent wechseln

Achtung: wenn man diese 230V Leitungen von den seitlichen Schraubterminals einfach nur abtrennt dann funktioniert der ATS nicht mehr.
Gehen wir wieder zurück zum ATS von Jotta.
Hier habe ich die beiden L und N Leitungen von den seitlichen Schraubterminals einfach abgerupft, die waren nur recht locker aufgelötet
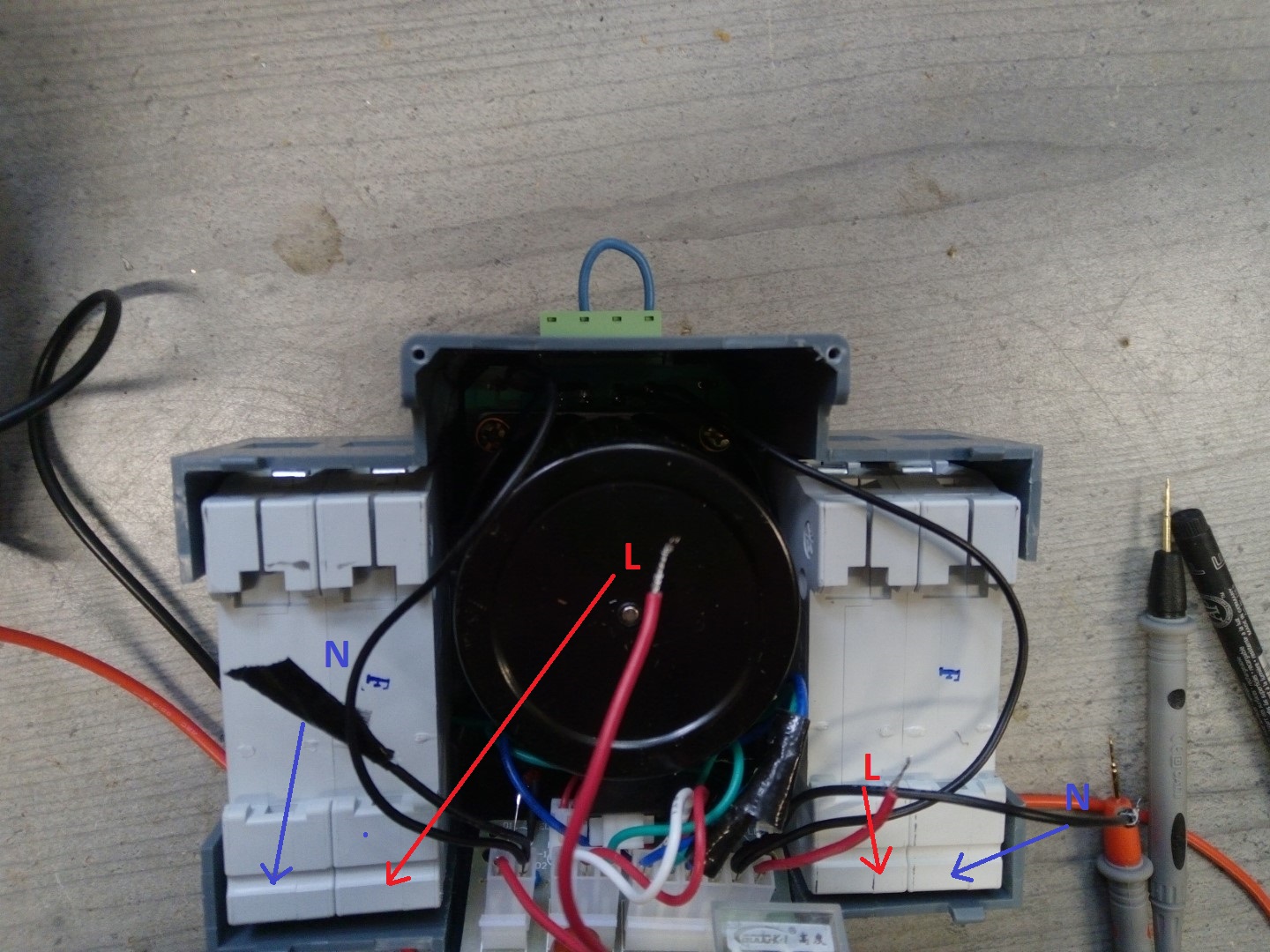
Die beiden N Kabel brauchen wir nicht mehr, die einfach gut abisolieren.
Nun, da die 230V Kabel von den Schraubterminals entfernt sind geht es weiter mit dem nächsten Schritt.
4. 230V Kabel neu verbinden
Die beiden L Kabel müssen neu verbunden werden, und zwar müssen die an die vordere Stromversorgung mit dazu.
Hier das Bild ist die Rückseite der vorderen Stromversorgung

- der abgetrennte L vom Sicherungsblock links muss nun an die Stromversorgung links (hier L1), und
- der abgetrennte L vom Sicherungsblock rechts muss nun an die Stromversorgung rechts (hier L2)
Beim ATS ohne Platine und mit den vielen Kabelstrippen geht das recht einfach (wenn man mal rausgefunden hat, welches Kabel wohin geht), hier beim Jotta ATS muss man an der Stromversorgung ein Stückchen Kabel anlöten da man ansonsten nicht gescheit ran kommt.
Das ist eng und bissel fummelig aber es geht, man kann das Plastikgehäuse auch etwas auseinander biegen dann hat man Platz zum Arbeiten
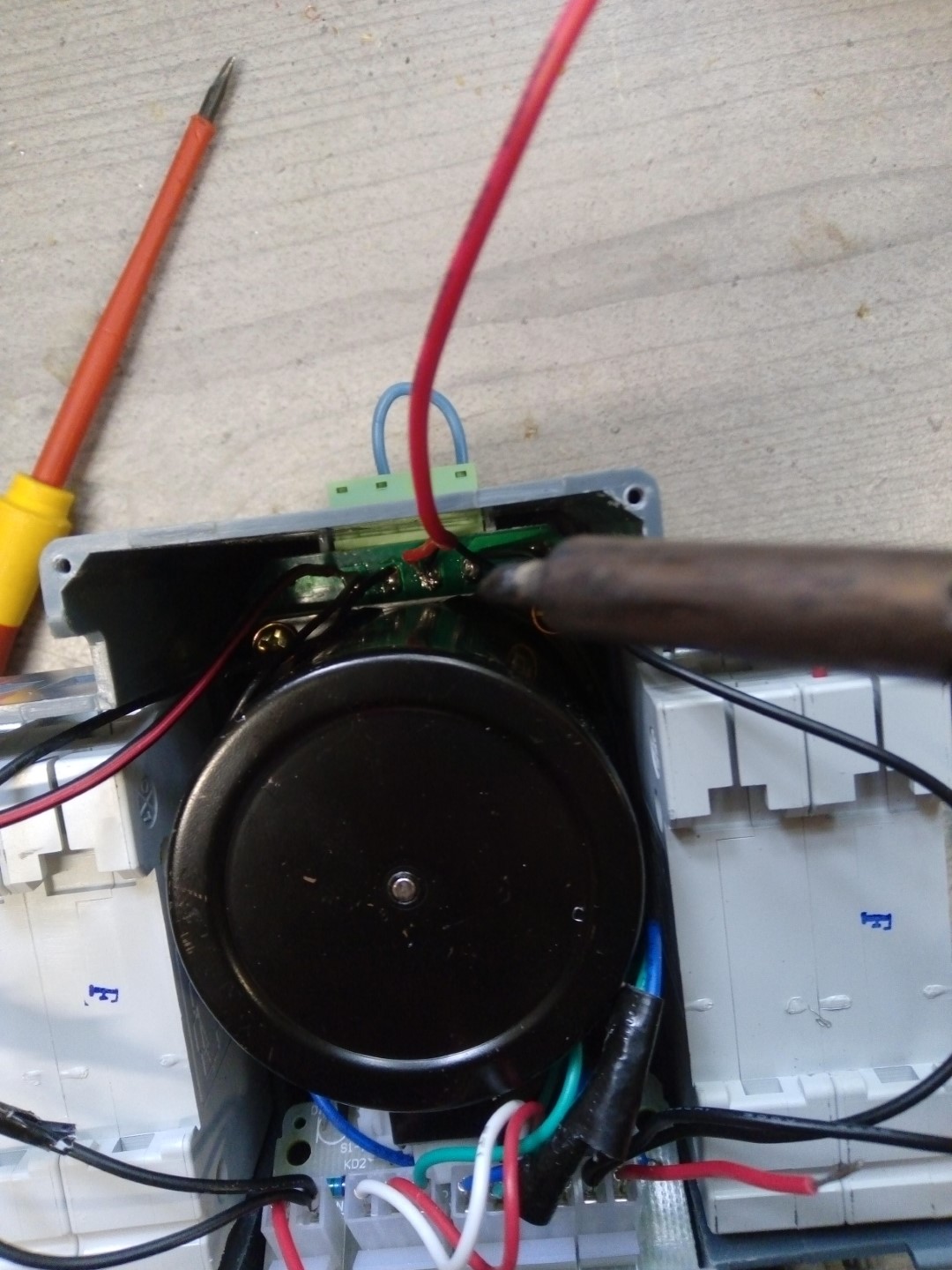
nun kann man das abgetrennte Kabel links mit der STromversorgung links verlöten, Schrumpfschlauch drüber, fertig.
Dasselbe mit der rechten Seite
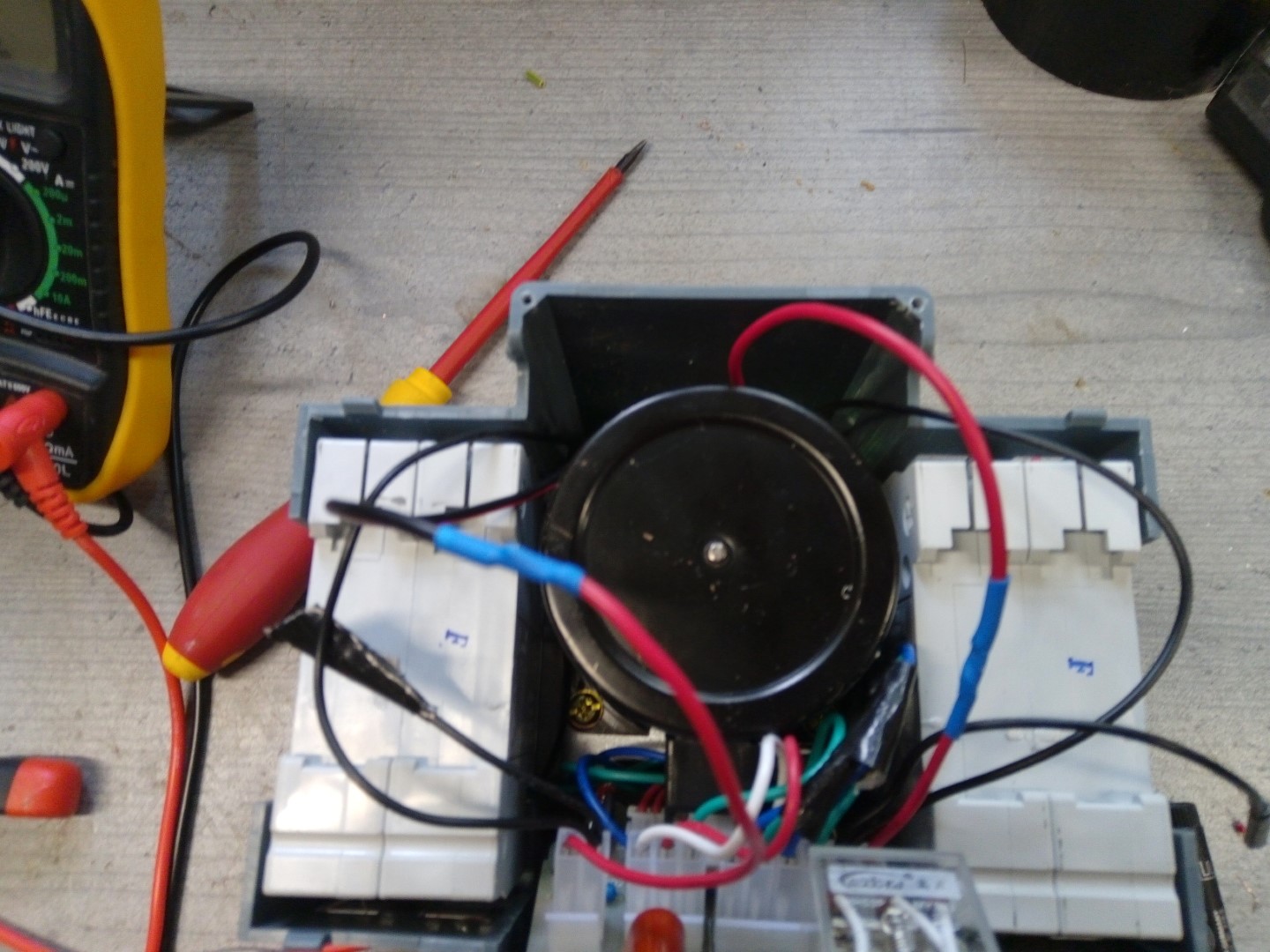
5. ATS wieder zusammenbauen
Vor dem Zusammenbau bitte überprüfen, ob auch wirklich alle 230V Kabel richtig isoliert sind und keine blanken Kabelstellen mehr da sind.
Dann den ATS wieder zusammenbauen und das war's.
Wenn man die Gefahr der Verbindung zwischen Steuerspannung und Schraubterminals gebannt hat ist das Anschließen des ATS sehr simpel.
Anschluss für Umschalten
Das Umschalten funktioniert immer von unten nach oben oder von oben nach unten, das ist egal, man muss sich nur entscheiden. Hier in Anschlussschema wird von unten (= Eingang) nach oben umgeschaltet
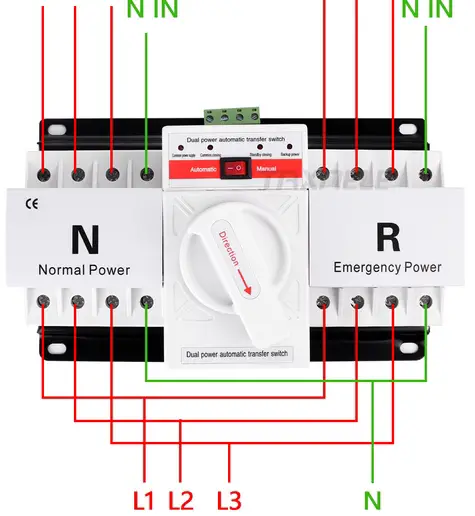
Dazu müssen die beiden Eingangsseiten jeweils miteinander verbunden werden, also Klemme L1 links auf Klemme L1 rechts, L2 links auf L2 rechts und so weiter.
Oben geht dann je nach Schalterstellung der Strom wieder raus.
Achtung:
Bissel verwirrend ist, dass bei Stellung des Drehschalters nach links dann der Ausgang rechts durchgeschaltet wird und umgekehrt.
Bei mir habe ich das dann einfach entsprechend mit Edding beschriftet
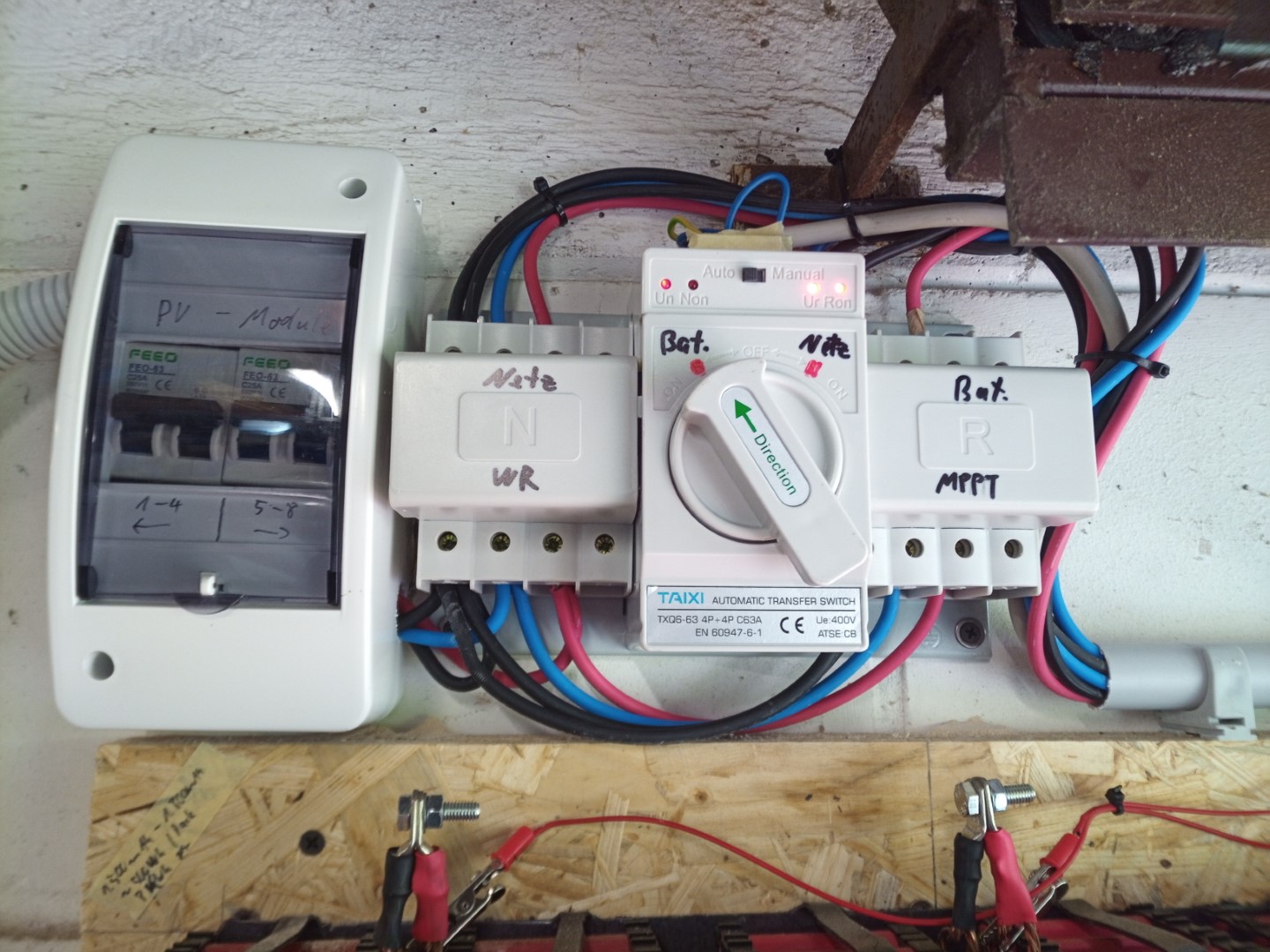
Anschluss für Steuerung
Wie oben beschrieben braucht man eigentlich nur einen Nullleiter für den Motor sowie zwei Phasen, je eine pro Schalterstellung. Böse: ich habe hier den gelb-grünen PE = Erdungsleiter genommen als zweite Phase. Das sollte man eigentlich wirklich nicht tun!! Also mach es bitte besser als ich und benutze ein 5-adriges Kabel, bei dem dann zwei korrekt farblich markierte Adern für die beiden Phasen genutzt werden können (Braun, Schwarz, Grau)

Es dürfen nie beide Phasen gleichzeitig Spannung haben, deswegen steuert man das ATS am besten mittels Relais an, weswegen wir gleich übergehen zum nächsten Punkt, dem Spannungswächter.
26.3 Spannungswächter
Als dritte Komponente diesen Spannungswächter / Batteriewächter

Intern sieht der dann so aus
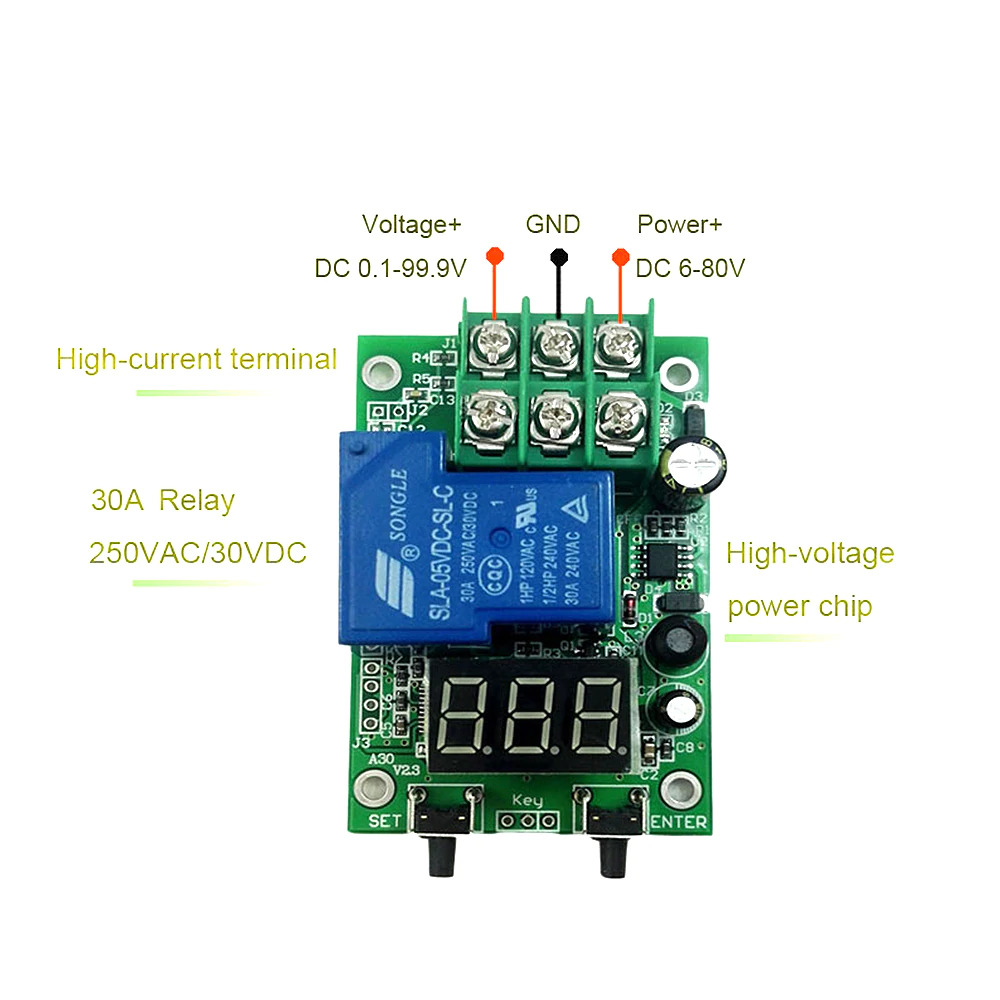
Bei Aliexpress kostet der etwa 10€ inkl. Versand-> diesen Spannungswächter / Batteriewächter
und der funktioniert folgendermaßen:
- am Terminal-Eingang oben rechts sowie oben Mitte kommt die Stromversorgung für das Gerät dran, damit es überhaupt arbeiten kann
- am Terminal-Eingang oben links sowie oben Mitte wird die Spannung der Powerwall gemessen
- Im Menü (Handbuch s. weiter unten um Download) stellt man nun eine obere Grenzspannung sowie eine untere Grenzspannung ein
- am Terminal-Eingang unten Mitte kommt der Eingang für das verbaute Relais dran, also in meinem Fall eine 230V Phase
- je nachdem, ob die obere oder die untere Grenzspannung erreicht ist schaltet das Relais auf den Terminal-Ausgang unten links oder unten rechts.
zwei Versionen & Menü Funktionen erklärt
Von dem Controller gibt es zwei Versionen @ Aliexpress
- A30-U1
- A30-U3
Bautechnisch / von der verwendeten Hardware und den technischen Leistungsdaten sind beide identisch.
Unterschied:
Der "U1" hat nur einen Modus, nämlich genau wie oberhalb beschrieben
Der "U3" hat zusätzlich noch folgende Optionen:
- Spannung Korrektur
- Display Ausschaltverzögerung in Minuten (0 = immer an)
- Schaltzustand: Umschaltung der Relais-Stellung möglich, also Relaisstellung 1 als Nullstellung oder aber Stellung 2 als Nullstellung
- Timer Relais bevor erneut geschaltet werden kann (long press “ENTER” for 3 seconds to reset values)
Da das Menü nicht selbsterklärend ist hier die Erklärungen zu den insgesamt 6 Menüpunkten des "U3" Modells:
1. Obere Grenzspannung

2. untere Grenzspannung
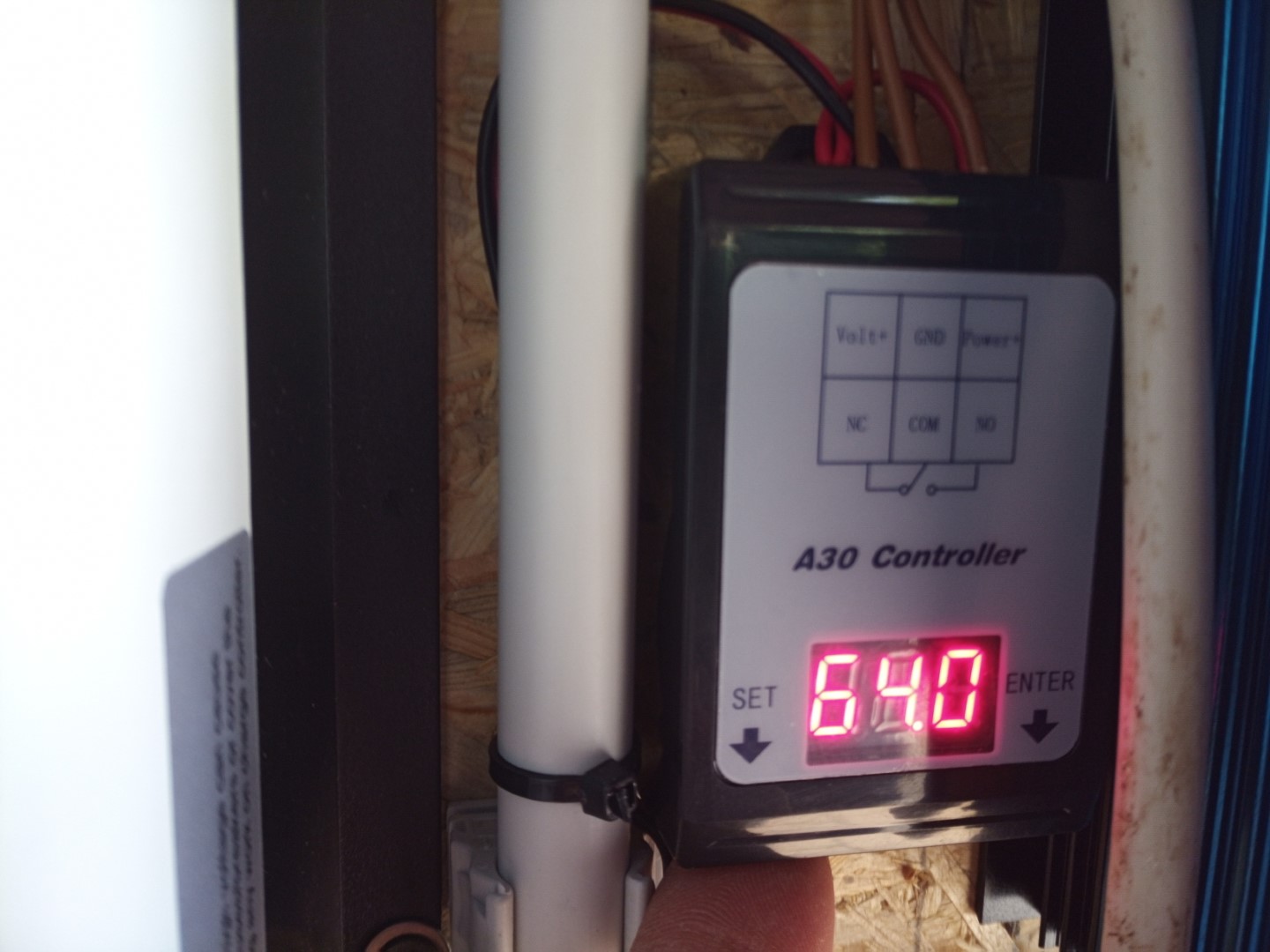
3. Spannung Korrektur

4. Display Ausschaltverzögerung in Minuten (0 = immer an)

5. Schaltzustand
- "ON H" = Relais schließt bei Überschreitung der oberen (high) Grenzspannung
- “ON L" = Relais schließt bei Unterschreitung der unteren (low) Grenzspannung
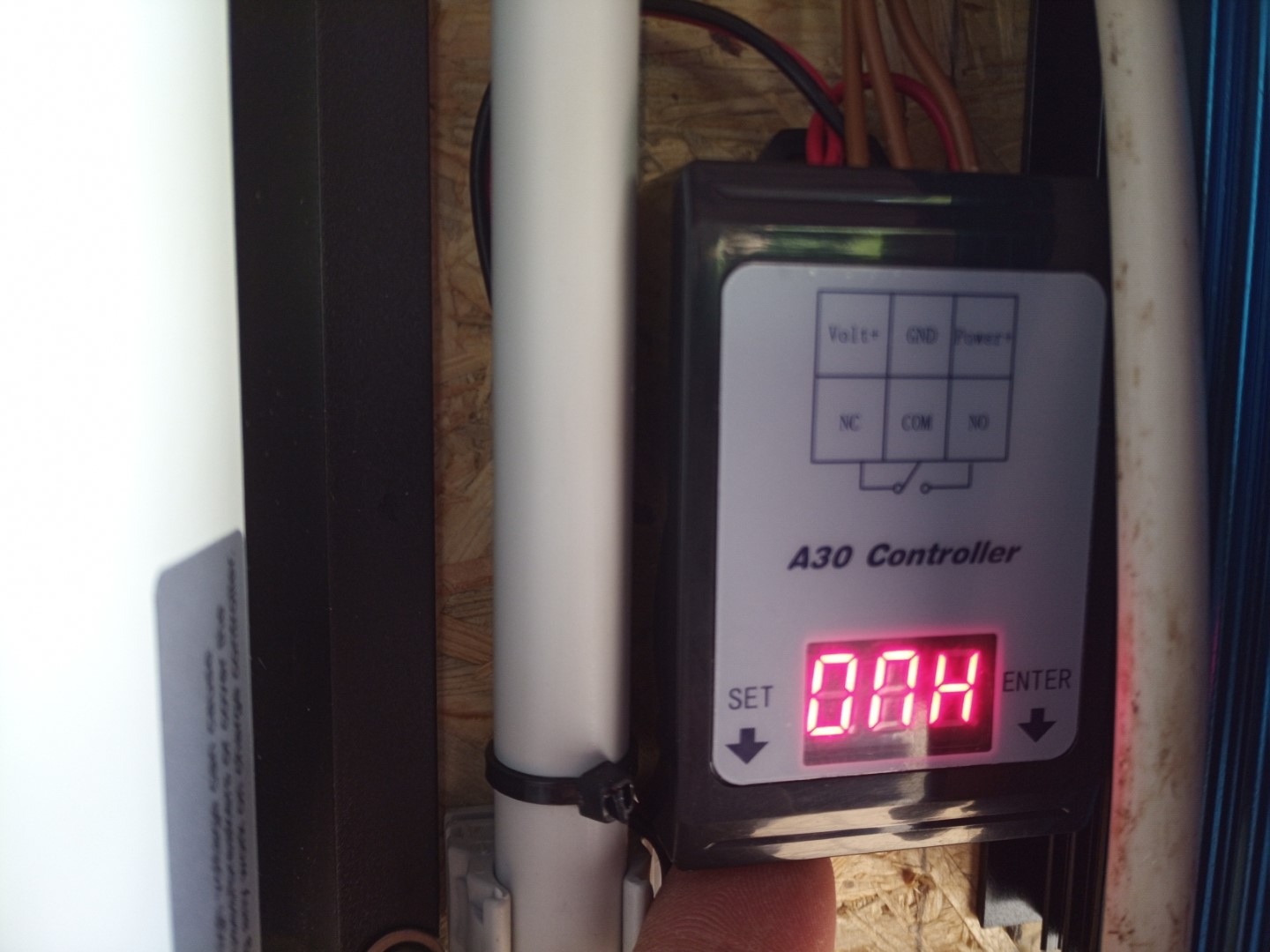
6. Timer Relais bevor erneut geschaltet werden kann (long press “ENTER” for 3 seconds to reset values)
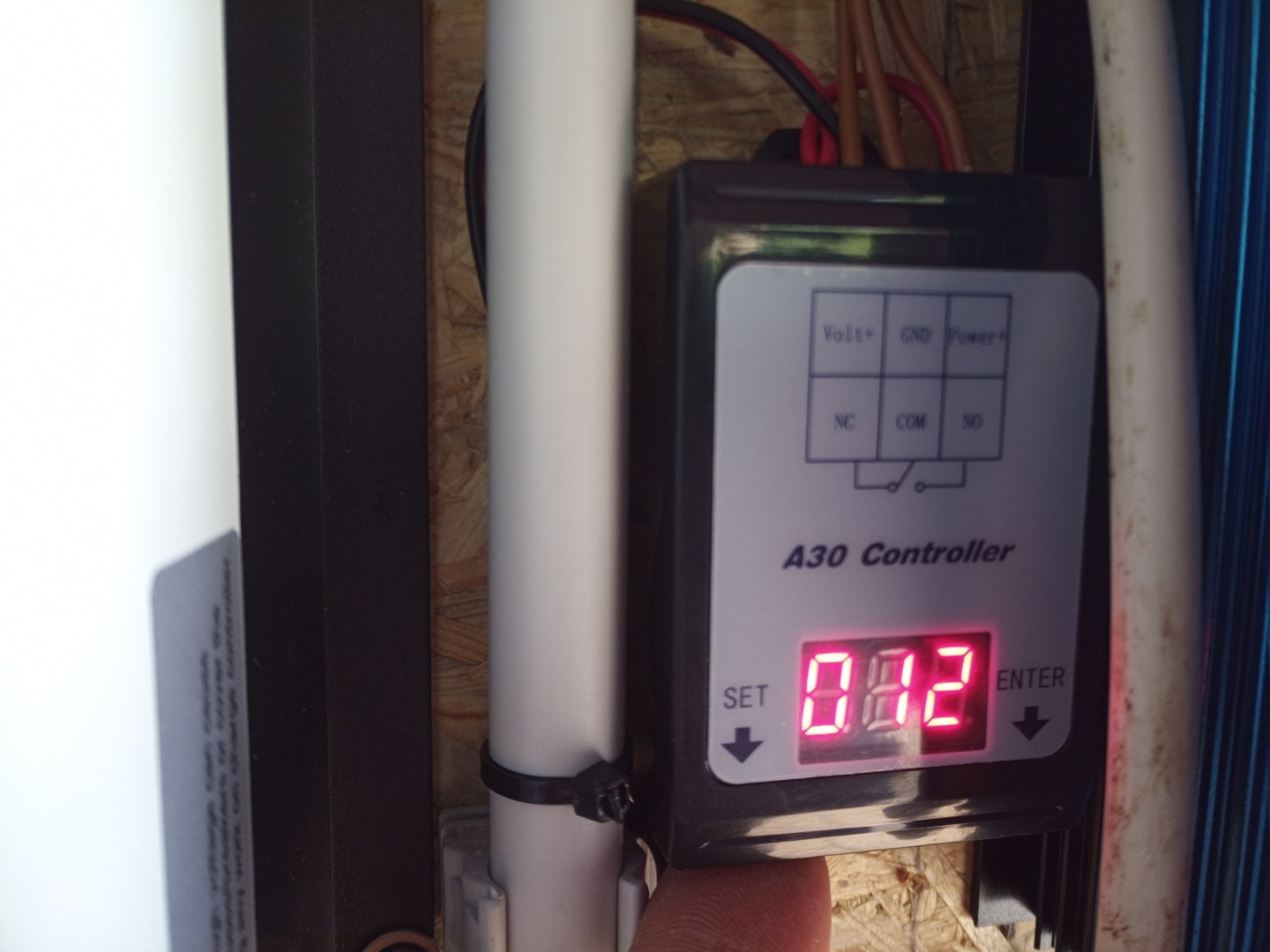
Downloads
{phocadownload view=file|id=43|target=b}
{phocadownload view=file|id=44|target=b}
{phocadownload view=file|id=45|target=b}
Funktionsweise des gesamten Systems in meinem Fall:
- die Powerwall ist voll geladen bei 65,0V also habe ich die obere Grenzspannung auf 65,0V eingestellt und den dazugehörigen Ausgang so an den ATS geklemmt, dass der Motor umschaltet auf Umschaltstellung nach rechts und somit die PV-Module auf den SUN 2000W Wechselrichter geschaltet werden, der dann ins Netz lädt
- stecke ich das E-Auto an die Powerwall an dann speisen die beiden SoyoSource Wechselrichter aus der Batterie in das Netz ein, dabei fällt die Spannung in der Powerwall ab und bei Unterschreiten der unteren Grenzspannung (auf 63,0V eingestellt) schaltet das Relais des Spannungswächer auf die andere Position und schaltet so die Phase zum ATS auf die andere Klemme durch, so dass dieser auf Umschaltstellung nach links dreht, also auf den MPPT Laderegler, der dann wieder die Powerwall lädt
Hier ein kurzes Video, wie das Ganze im Betrieb nun funktioniert
Inhaltsverzeichnis:
- 1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)
- 2 Idee + Plan
- 3 Akku-Arbeitsplatz
- 4 eBike Akku Komponenten
- 5 eBike Akku zerlegen
- 6 Laptop Akkus zerlegen
- 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte
- 8 neue Hülle für 18650
- 9 China-Akkutest
- 10 Werkzeuge + Messgeräte
- 11 Null-Watt Einspeisung
- 12 Modbus / RS485 Adapter
- 13 BMS + Balancer
- 14 aktiv Balancer BMS - JKBMS
- 15 Ladegeräte + Kapazitätstester
- 16 kpl. Akkupacks testen
- 17 Innenwiderstand Ri
- 18 Solar Laderegler
- 19 Wechselrichter, Inverter
- 20 Löten - Anleitung für Akkus
- 21 Schlüsselanhänger aus 18650
- 22 Sicherheitskonzept
- 23 Akkus Beschaffung - wie und wo?
- 24 WVC / SG / GMI / PVGS Mikroinverter
- 25 Schritt-für-Schritt zur 18650 Powerwall
- 26 ATS - Automatic Transfer Switch
- 27 Schottky Sperrdioden für Parallelschaltung
- 28 Balkonsolar & Balkonkraftwerk
- 29 Hybrid Wechselrichter einrichten
27 Schottky Sperrdioden für Parallelschaltung
Hier geht es um eine kleine Optimierung der Solar-Leistung bei Teilverschattung einzelner Module.
Bei einer Reihenschaltung mehrerer Module wirkt sich eine (Teil-)Verschattung einzelner Module je nach Art der Verschattung nur teilweise auf die Leistung des einzelnen Modules aus, aber niemals auf den gesamten String.
Moderne PV-Module bestehen in der Regel aus 60 oder 72 einzelnen Solarzellen, die in drei senkrechten Reihen jeweils in Reihe geschaltet sind.
Diese drei Reihen sind untereinander mit sog. Bypass-Dioden ausgestattet, diese sitzen auf der Rückseite des PV-Moduls im Anschlusskästchen.

Wird nun ein Teil einer der drei Reihen (oder die ganze Reihe) verschattet und der Rest des Moduls nicht (die weißen Quadrate sind kleine Schatten), dann kann die dazugehörige Bypass (unten, rot markiert) diesen Teil des Modules umgehen, es hat dann nur 1/3 weniger Gesamtleistung, arbeitet aber weiter.
Werden zwei solcher Reihen verschattet reduziert sich die Leistung um 2/3 und erst bei einer kompletten Verschattung werden alle drei Felder durch die Bypass-Dioden umgangen.
Anders sieht es aus bei einem Schatten, der streifenförmig quer über das Modul geht und somit bei allen drei Reihen ein wenig verschattet, hier schalten die Bypassdioden auch um und das Modul bringt keinerlei Leistung mehr, obwohl vielleicht nur ein kleiner 5cm-Streifen Schatten (durch den Ast eines Baumes etwa) über das Modul ragt.
Dagegen kann man auch garnichts machen, auch nicht mit teuren "Optimierern", s. auch hier:
In einer Parallelschaltung jedoch sieht es anders aus. Wird ein Modul (teil-)verschattet, sinkt damit ja auch die Spannung und zieht damit dann automatisch die Gesamtspannung des gesamten Parallelstrings herunter, die Leistung verringert sich massiv.
Das ist erstmal ärgerlich aber noch nicht schlimm.
Was noch dazu kommt ist, dass bei Parallelschaltung von mehr als zwei Modulen (oder Parallelschaltung von mehr als zwei Strings) Rückströme entstehen, die ggf. die Module zerstören können, s. auch dieses Paper von SMA -> Download als Pdf
Um das zu verhindern gibt es:
- Solardioden
- Stringdioden
- Sperrdioden
- Blocking Dioden
- Schottkydioden
Alle Begriffe meinen dasselbe, und technisch gesehen handelt es sich immer um sog. Schottky-Dioden

Die grünen Bypass-Dioden sind die oben bereits beschriebenen, intern verbauten Dioden. Die sind auf der Schemazeichnung lediglich zum besseren Verständnis außerhalb der Module eingezeichnet.
Hier ein paar Beispiele möglicher Verschattung für das obere Aufbauschema:
Wir nehmen mal an, dass jedes der vier Module 300W liefert und, dass die oberen, roten Sperrdioden noch nicht verbaut sind
1. Teilverschattung senkrecht Modul links unten:
- interne Bypassdiode greift
- Modulleistung sinkt um 1/3 also von 300W auf 200W
- der linke String hat entsprechend weniger Leistung also noch 500W
- die gesamte Anlage liefert noch 1.100W
2. Teilverschattung waagerechter Streifen Modul links unten:
- alle drei internen Bypass-Dioden greifen
- Modulleistung sinkt auf 0W
- der linke String hat entsprechend weniger Leistung also noch 300W
- die gesamte Anlage liefert noch 900W
3. beide linken Module sind verschattet - ohne Sperrdioden
- die internen Bypassdioden greifen
- Modulleistung der beiden linken Module sinkt auf 0W
- Spannung des linken Strings bricht zusammen auf 0
- durch die Parallelschaltung zieht der "tote" String die Spannung und damit auch die Leistung des rechten Strings mit runter
- die gesamte Anlage liefert noch etwa 300W oder sogar weniger (je nachdem wie stark die Spannung einbricht)
- ein Rückstrom fließt vom rechten String in den linken, erwärmt dort die PV-Module
- wären hier drei oder mehr Stringsparallel verschaltet könnte der Rückstrom in den "toten" String so hoch werden, dass die beiden Module zerstört werden
4. beide linken Module sind verschattet - dieses Mal mit Sperrdioden
- die internen Bypassdioden greifen
- Modulleistung der beiden linken Module sinkt auf 0W
- Spannung des linken Strings bricht zusammen auf 0
- durch die roten Sperrdioden wird ein Stromrückfluss verhindert
- der rechte String kann normal weiter arbeiten
- die gesamte Anlage liefert noch 600W
Solche Sperrdioden gibt es zu kaufen als MC4 Stecker-Adapter

Erhältlich auf
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
..als einzelnen Schottky-Dioden, die kosten dann 1€ / Stück bzw. 5€ im 5er Pack.
Einfach mal bei eBay eingeben "Schottky Dioden" oder "Solar Dioden".
Dann die passende Größe für die eigenen PV-Module und Stringverschaltung aussuchen, es gibt sie mit
- unterschiedlichen Spannungswerten
- unterschiedlichen Stromstärken
Schottkydioden lassen Strom nur in eine Richtung durch und verhindern so, dass die sonnenbeschienenen Module Strom in die verschatteten Module reinschicken
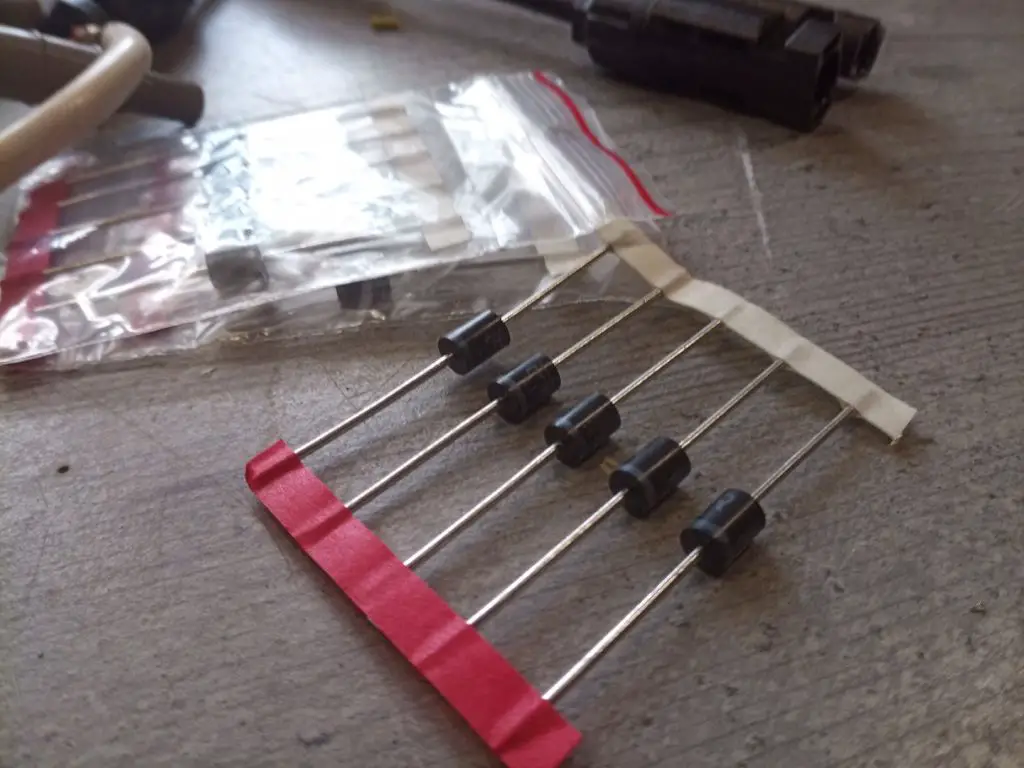
Und da ich eh was basteln muss um von dem alten Steckerstandard der 100W Module an der Mauer-PV...

...auf den MC4 Standard zu kommen...

...bietet sich das an, die Schottky-Dioden in einen Y-Verbinder mitsamt den alten Anschlüssen zu löten

da ich nicht wusste, in welcher Richtung die Schottky-Diode leitet und auch die Markierung auf der Diode nicht deuten konnte habe ich es einfach ausprobiert. Jetzt weiß ich: der Strich ringsherum um die Diode markiert die Kathode und damit den Minus-Anschluss
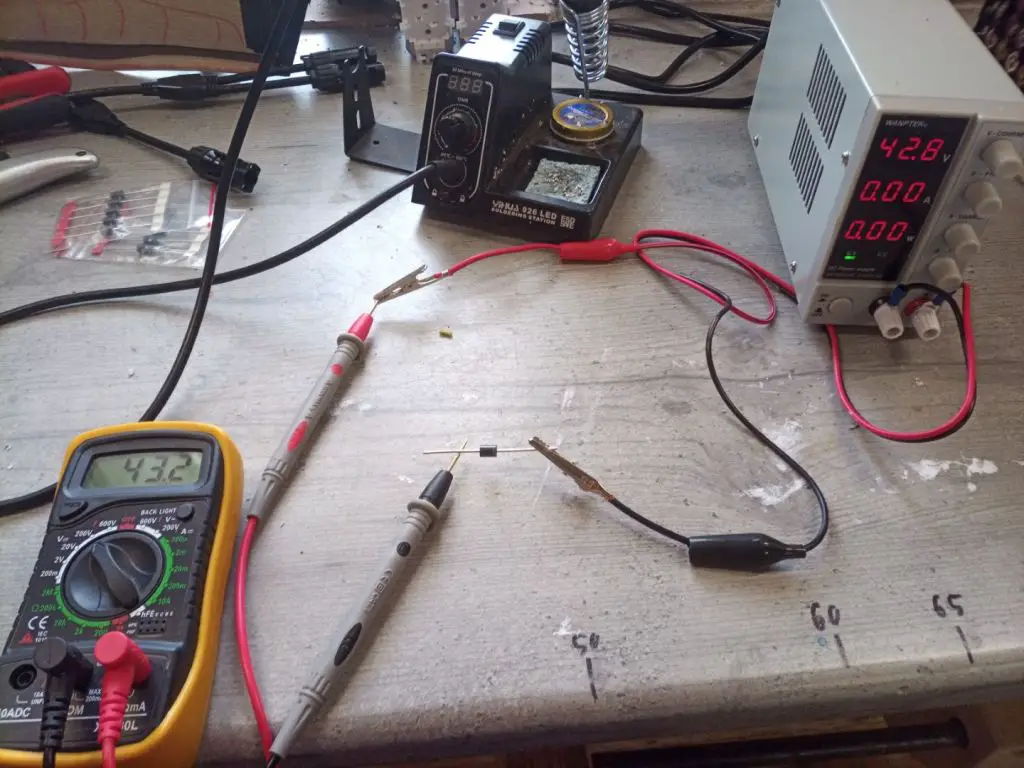
beideitig gekürzt und verlötet
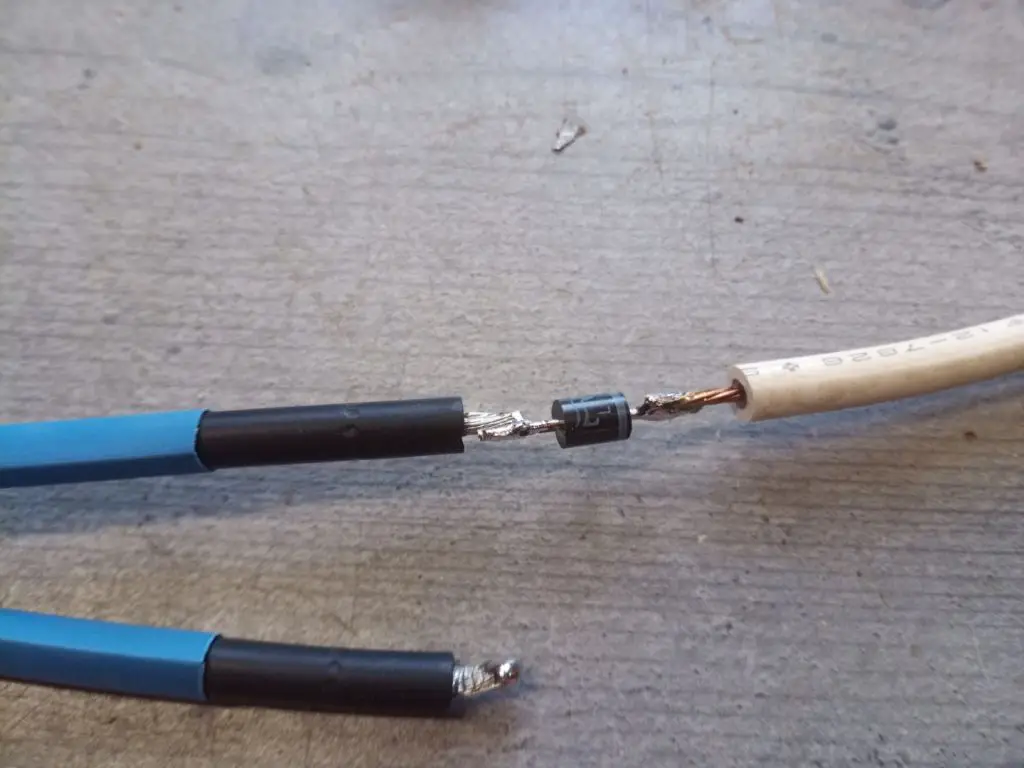
Schrumpfschlauch drüber - fertig

hätte ich anstelle der alten PV-Module neuere gehabt mit ganz normalen MC4-Steckern dann hätte ich am Y-Adapter die beiden Kabelenden in der Mitte durchgeschnitten und dann dort die Diode eingelötet


So kann man nun zwei parallele Module oder zwei parallele Strings anschließen.
Man braucht die Sperrdioden nur entweder auf der Plusseite oder an der Minusseite -> Anschlussrichtung der Sperrdiode beachten.
Will man mehr als zwei Strings parallel verschalten dann braucht man eben mehrere Adapter.
Ich habe in meinem Beispiel insgesamt 12 Module angeschlossen.
Je zwei in Reihe, also insgesamt 6 parallele Strings.
Dabei habe ich immer zwei der Strings mit einem Y-Adapter mit Dioden parallel angeschlossen und hatte danach drei "geschützte" Strings, diese habe ich dann mit normalen Y-Adaptern ohne Dioden parallel geschaltet.
Inhaltsverzeichnis:
- 1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)
- 2 Idee + Plan
- 3 Akku-Arbeitsplatz
- 4 eBike Akku Komponenten
- 5 eBike Akku zerlegen
- 6 Laptop Akkus zerlegen
- 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte
- 8 neue Hülle für 18650
- 9 China-Akkutest
- 10 Werkzeuge + Messgeräte
- 11 Null-Watt Einspeisung
- 12 Modbus / RS485 Adapter
- 13 BMS + Balancer
- 14 aktiv Balancer BMS - JKBMS
- 15 Ladegeräte + Kapazitätstester
- 16 kpl. Akkupacks testen
- 17 Innenwiderstand Ri
- 18 Solar Laderegler
- 19 Wechselrichter, Inverter
- 20 Löten - Anleitung für Akkus
- 21 Schlüsselanhänger aus 18650
- 22 Sicherheitskonzept
- 23 Akkus Beschaffung - wie und wo?
- 24 WVC / SG / GMI / PVGS Mikroinverter
- 25 Schritt-für-Schritt zur 18650 Powerwall
- 26 ATS - Automatic Transfer Switch
- 27 Schottky Sperrdioden für Parallelschaltung
- 28 Balkonsolar & Balkonkraftwerk
- 29 Hybrid Wechselrichter einrichten
28 Balkonsolar & Balkonkraftwerk

Hier dreht sich alles um Balkonsolaranlagen von der Berechnung der Wirtschaftlichkeit über den idealen Aufstellort bis zur Aufbauanleitung.
Empfehlungen für Bezugsquellen von steckerfertigen Komplettsets sowie auch Einzelkomponenten zur Optimierung findest Du hier ebenfalls.
Inhaltsverzeichnis:
28.1 das Wichtigte in Kurzform
28.2 Die Komponenten & Bezugsquellen
28.2.1 Balkonsolar-Komplettsets mit Zulassung
28.2.2 Zubehör & Einzelkomponenten
28.3 (Wann) rechnet sich das?
28.3.1 Begriffserläuterungen
28.3.2 Verbräuche üblicher Haushaltsgeräte bestimmen
28.3.3 die eigene Grundlast kennen
28.3.4 die perfekte Sonnenausrichtung
28.3.5 Balkonsolar muss nicht an den Balkon
28.3.6 Erspartes & Amortisationsdauer berechnen
28.3.7 Optimierungsmaßnahmen & mehr Einsparung herausholen
28.4 (Wie) kann ich das selbst machen?
28.4.1 handwerklich- technisches
28.4.2 rechtliche Rahmenbedingungen & Anmeldung
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
28.1 das Wichtigste in Kurzform

Als Balkonsolaranlage oder auch Balkonkraftwerk, Steckersolar oder Mikro-PV bezeichnet man eine kleine Photovoltaik-Anlage mit folgenden Merkmalen
- üblicherweise 600 Watt Leistung
- Bestandteile sind: 2x Solarmodule, 1x Wechselrichter, Befestigungsmaterial für Balkon / das (Gartenhaus-)Dach / Carport / Fassade / Wiese
- erzeugter Strom wird selbst verbraucht, Überschuss geht ohne Entgelt ins Netz
- Kosten (Stand 2023) liegen bei um 700-800€ für ein Komplettset (Bezugsquellen weiter unten)
- Energieeinsparung: 100 - 200€ pro Jahr --> Amortisationszeitraum: 5 - 7 Jahre je nach persönlicher Nutzung und Ausrichtung (Berechnungen dazu s. weiter unten)
- niedrigerer bürokratischer Aufwand gegenüber großen PV-Anlagen
- kann & darf zum Großteil in Eigenleistung installiert werden
- ein Balkonkraftwerk muss nicht zwangsweise an den Balkon und darf auch auf einem Carport, Gartenhütte, Brennholzlager installiert oder einfach auf den Boden gestellt werden
28.2 die Komponenten & Bezugsquellen

Eine Balkonsolaranlage besteht im Grunde nur aus zwei Kern-Komponenten
- ein oder mehrere PV-Module -> erzeugt aus Sonnenenergie eine Gleichspannung
- ein Wechselrichter -> wandelt Gleichspannung in 230V Wechselspannung für die Steckdose um
Optionale Komponenten können sein:
- Einspeisesteckdose z.B. von Wieland
- Aufständerung für Flachdach / Garten oder sonstiges Befestigungsmaterial für Balkongeländer- oder Dachmontage
- Energiemessgerät um den Sonnertrag zu visualisieren
Und was ist mit der Verkabelung?
Die Verkabelung ist denkbar einfach und kann auch weitestgehend von Nicht-Fachleuten durchgeführt werden denn
- PV Module sind bereits mit Kabeln ausgestattet
- der Anschluss der PV-Module an den Wechselrichter erfolgt mittels verpolungssicherer, eindeutiger, bereits montierter Stecker im sog. MC4 Standard
- der Anschluss des Wechselrichters an das Hausnetz kann ganz einfach erfolgen, indem man ihn mit seinem normalen 230V Schukostecker in eine beliebige Steckdose* in Haus / Wohnung einsteckt
Und damit wäre die Anlage bereits fertig verkabelt und bereit zum Arbeiten.
*Hinweis:
Die Benutzung einer normalen Steckdose bei Balkonsolar ist zwar im EU-Ausland sowie in vielen Regionen Deutschlands zulässig, aber nicht überall. Manche Stromnetzbetreiber fordern noch die Verwendung einer sog. "Einspeisesteckdose" von Wieland. Das ist eine speziellen Einbausteckdose, die von einem Elektrofachbetrieb installiert werden sollte.
Im Zweifelsfall muss man seinen eigenen, regional zuständigen Netzbetreiber fragen, ob er Schuko akzeptiert oder die Wielanddose fordert.
Mehr dazu weiter unten unter dem Punkt -> 28.4.2 rechtliche Rahmenbedingungen
Bezugsquellen:
Balkonkraftwerke findet man am besten im Internet, dort gibt es unzählige Onlineshopps, die dank hoher Stückzahlen zu guten Preisen verkaufen können.
Qualitätsmäßig unterscheiden sich diese Balkonsolar-Komplettsets in der Regel kaum. Worauf man allerdings unbedingt achten sollte ist die Zulassung nach VDE AR-N 4105 des Wechselrichters, denn ohne darf eine solche Anlage in Deutschland nicht betrieben werden.
Achtung - Vorsicht!
Leider gibt es auch viele Angebote von Komplettsets, die ohne diese Zulassung daherkommen wie z.B diese hier:
 -
- 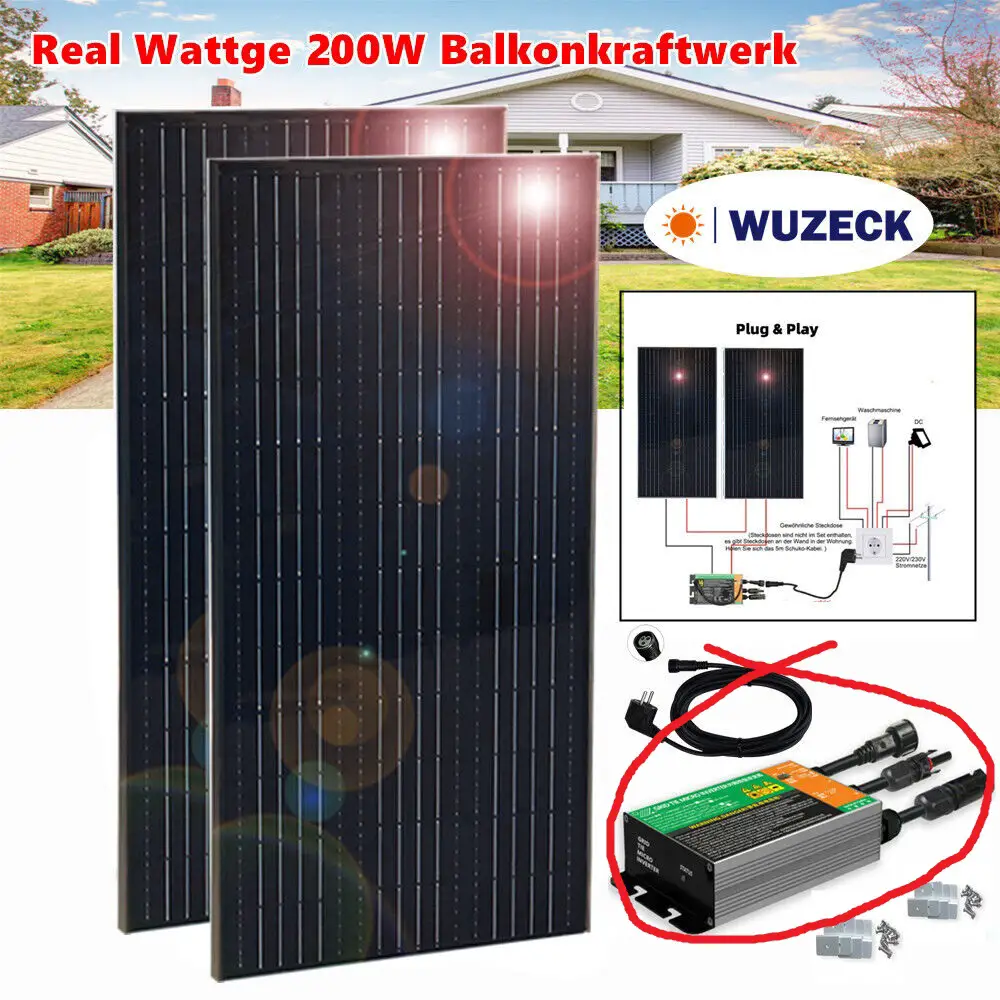 -
- 
Die dort verwendeten Wechselrichter funktionieren zum Teil zwar sehr gut, wie bereits an anderer Stelle ausführlich dargestellt wurde s. -> Leitfaden Akkus & PV von A-Z - 24 WVC / SG / GMI / PVGS Mikroinverter
Jedoch ohne Zulassung kann eine solche Balkonsolaranlage nicht beim Energieversorger angemeldet werden und ist demnach nicht legal zu betreiben, weswegen ich davon abrate.
Inhaltsverzeichnis:
28.1 das Wichtigte in Kurzform
28.2 Die Komponenten & Bezugsquellen
28.2.1 Balkonsolar-Komplettsets mit Zulassung
28.2.2 Zubehör & Einzelkomponenten
28.3 (Wann) rechnet sich das?
28.3.1 Begriffserläuterungen
28.3.2 Verbräuche üblicher Haushaltsgeräte bestimmen
28.3.3 die eigene Grundlast kennen
28.3.4 die perfekte Sonnenausrichtung
28.3.5 Balkonsolar muss nicht an den Balkon
28.3.6 Erspartes & Amortisationsdauer berechnen
28.3.7 Optimierungsmaßnahmen & mehr Einsparung herausholen
28.4 (Wie) kann ich das selbst machen?
28.4.1 handwerklich- technisches
28.4.2 rechtliche Rahmenbedingungen & Anmeldung
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
28.2.1 Balkonsolar-Komplettsets mit Zulassung*

Hier findest Du eine Vorauswahl an Komplettsets, die geprüft und in Deutschland zugelassen sind.
- eBay1 / eBay2 / eBay3 / eBay4 / eBay5 / eBay6 / eBay7 / eBay8 / eBay-Suche (ungefiltert)
- Amazon1 / Amazon2 / Amazon3 / Amazon4 / Amazon5 / Amazon6 / Amazon7 / Amazon8 / Amazon-Suche (ungefiltert)
Inhaltsverzeichnis:
28.1 das Wichtigte in Kurzform
28.2 Die Komponenten & Bezugsquellen
28.2.1 Balkonsolar-Komplettsets mit Zulassung
28.2.2 Zubehör & Einzelkomponenten
28.3 (Wann) rechnet sich das?
28.3.1 Begriffserläuterungen
28.3.2 Verbräuche üblicher Haushaltsgeräte bestimmen
28.3.3 die eigene Grundlast kennen
28.3.4 die perfekte Sonnenausrichtung
28.3.5 Balkonsolar muss nicht an den Balkon
28.3.6 Erspartes & Amortisationsdauer berechnen
28.3.7 Optimierungsmaßnahmen & mehr Einsparung herausholen
28.4 (Wie) kann ich das selbst machen?
28.4.1 handwerklich- technisches
28.4.2 rechtliche Rahmenbedingungen & Anmeldung
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
28.2.2 Zubehör & Einzelkomponenten*
Je nach Einbauort und baulicher Gegebenheit benötigt man vielleicht noch das eine oder andere Zubehör, oder möchte sich sein Balkonkraftwerk aus Einzelkomponenten zusammenstellen.
Strom-Messgerät mit WLan & App um den Sonnenertrag sehen zu können
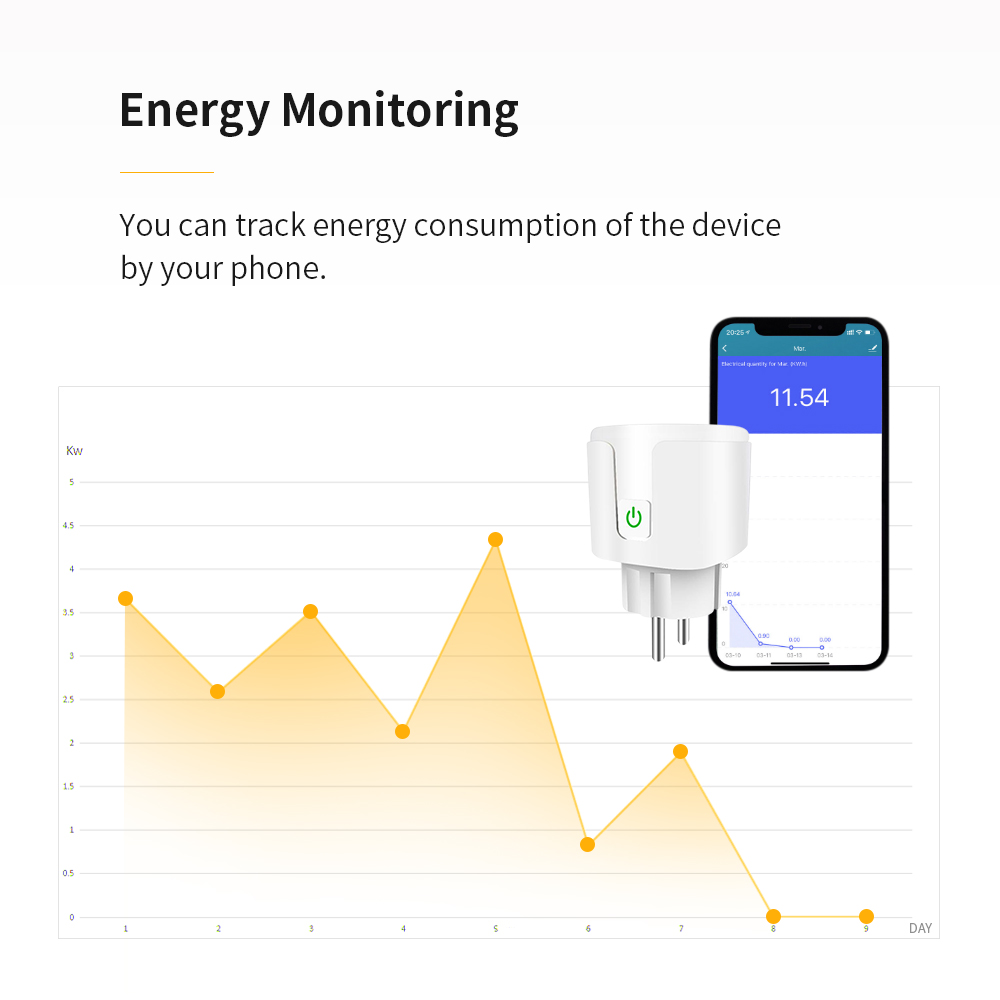
- eBay1 / eBay2 / eBay3 / eBay4 / eBay-Suche
- Amazon1 / Amazon2 / Amazon3 / Amazon-Suche
- Aliexpress1 / Aliexpress2 / Aliexpress3 / Aliexpress4 / Aliexpress5 / Aliexpress6
Solarkabel-Verlängerung auf eBay1 / eBay2 / eBay-Suche / Amazon1 / Amazon2 / Amazon-Suche

Y-Adapter um 2 Module an 1 Anschluss am Wechselrichter anzuschließen

- eBay1 / eBay2 / eBay3 / eBay-Suche
- Amazon1 / Amazon2 / Amazon3 / Amazon-Suche
- Aliexpress1 / Aliexpress2 / Aliexpress3 / Aliexpress4
Kabelbinder zum ordentlichen Fixieren der Kabel auf Aliexpress1 / Aliexpress2 / Amazon1 / Amazon2 / eBay1 / eBay2
Solar-Trennschalter auf Aliexpress1 / Aliexpress2 / Aliexpress3 / Aliexpress4 / Aliexpress5 / Aliexpress-Suche / eBay-Suche / Amazon-Suche

Halterungen für Balkonmontage auf eBay1 / eBay2 / eBay3 / eBay4 / eBay5 / eBay-Suche / Amazon1 / Amazon2 / Amazon3 / Amazon-Suche

Befestigungs-Komplettset für Montage auf Ziegel-Dach auf eBay1 / eBay2 / eBay-Suche / Amazon-Suche

Befestigungs-Komplettset für Montage auf (Well-)Blech-Dach auf eBay1 / eBay2 / eBay-Suche / Amazon-Suche
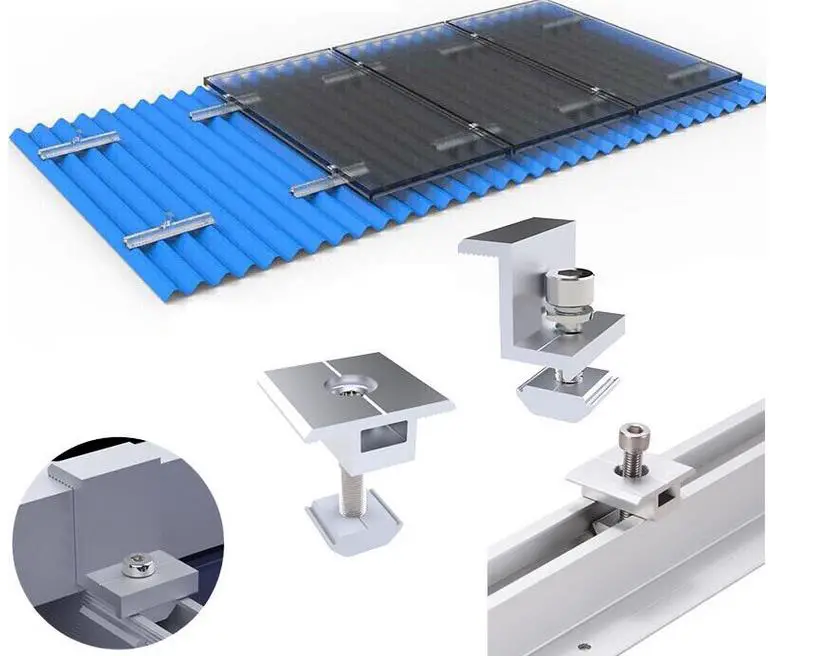
Befestigungs-Komplettset für Montage auf Flach-Dach (Bitumen, Garage, Gartenhaus, Holzlager) auf eBay1 / eBay2 / eBay-Suche / Amazon-Suche

Aufständerung für Flachdach, Carport, Garage oder Boden auf eBay1 / eBay2 / eBay-Suche / Amazon1 / Amazon2 / Amazon-Suche

Wieland Einspeisesteckdose auf eBay1 / eBay2 / eBay-Suche / Amazon1 / Amazon2 / Amazon-Suche
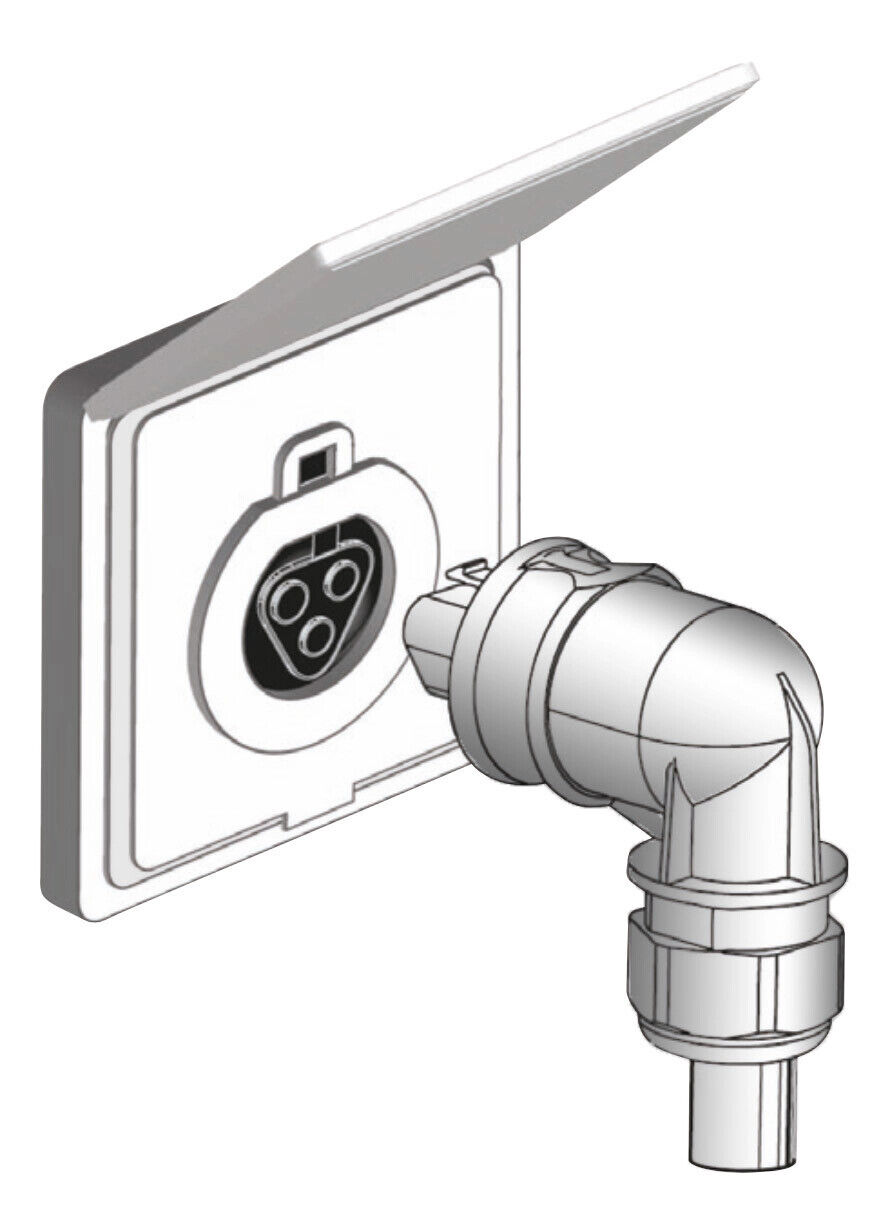
mehr Montagematerial wie z.B. Aluprofilschienen und Dachhaken für Ziegeldach oder separate Sicherungskasten etc. findest Du hier
Wechselrichter mit gültiger VDE AR-N 4105:

Wechselrichter mit 800W Leistung:
- Hoymiles HM-600 auf eBay / Amazon
- Hoymiles MI-600 auf eBay / Amazon
- Envertech EVT560 auf eBay / Amazon
- APSystems YC600 auf eBay / Amazon
- APSystems DS3-S EU auf eBay / Amazon
- Deye SUN600 auf eBay / Amazon
- Growatt MIC 600TL-X auf eBay / Amazon
Wechselrichter mit 800W Leistung:
- Hoymiles HM-800 auf eBay / Amazon
- Envertech EVT720 auf eBay / Amazon
- Deye SUN800G3 auf eBay / Amazon
Netzstecker für Hoymiles / Envertech / Deye Wechselrichter auf eBay / Amazon

Solarmodule
empfohlene Kriterien:
- 2x identische Module kaufen
- Leistung je zwischen 330 und 450 Watt
- monokristallin (= effizienter als polykristallin)
- keine 12V oder 18V Campingmodelle - üblicherweise haben normale PV-Module zwischen 40 und 50 Volt
- ansonsten sind Hersteller, Modell, Farbe des Alurahmens im Grunde egal, stattdessen die Versandkosten im Blick behalten
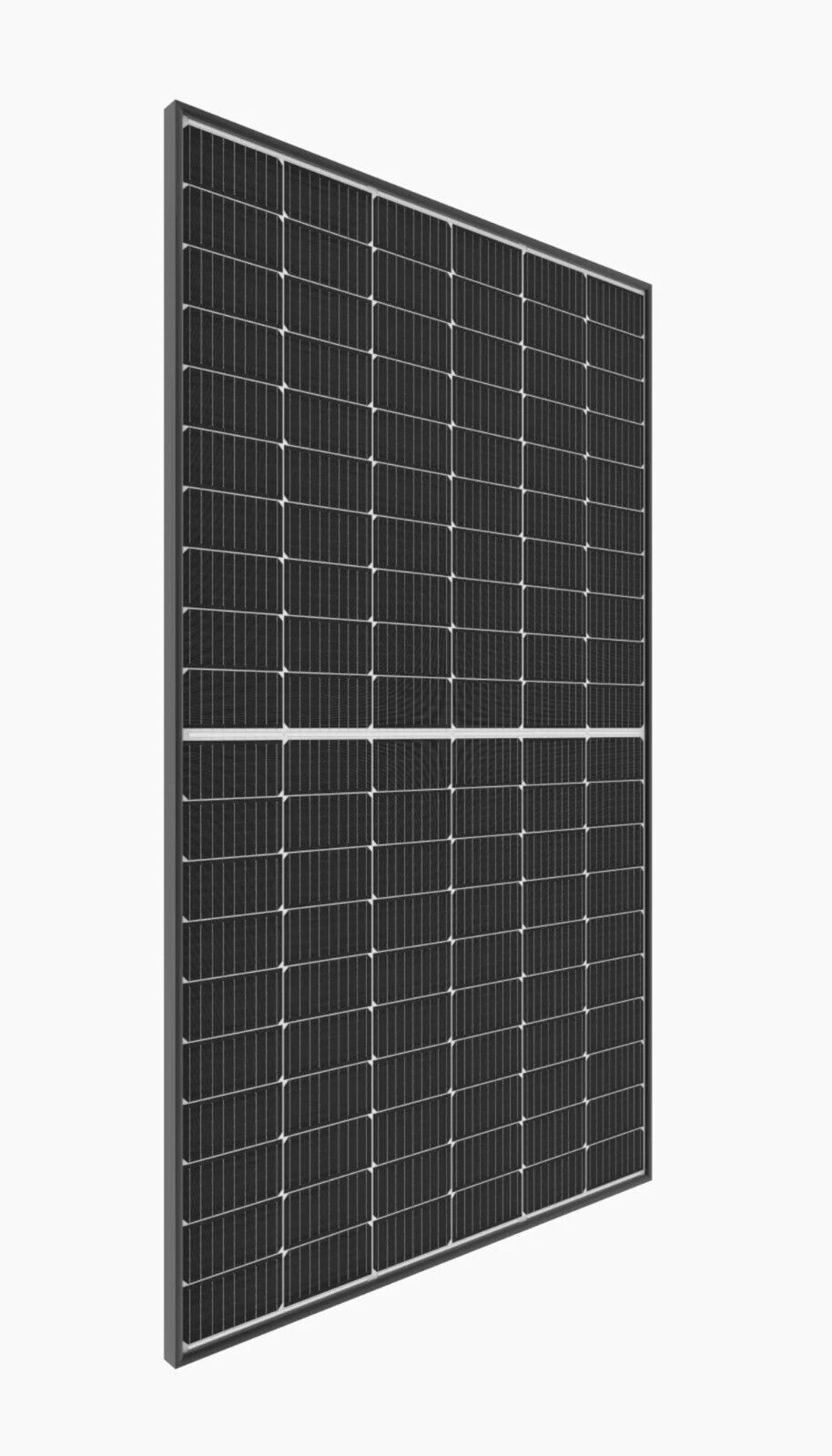
flexible Solarmodule
ideal da, wo eine feste Montage nicht möglich ist (Camping, mobile Anwendung, keine massive Halterung am Balkongeländer möglich, ...)

- Aliexpress1 / Aliexpress2 / Aliexpress3 / Aliexpress4 / Aliexpress5 / Aliexpress6 / Aliexpress7 / Aliexpress8 / Aliexpress9 / Aliexpress-Suche
- eBay1 / eBay2 / eBay-Suche
- Amazon1 / Amazon2 / Amazon-Suche
Inhaltsverzeichnis:
28.1 das Wichtigte in Kurzform
28.2 Die Komponenten & Bezugsquellen
28.2.1 Balkonsolar-Komplettsets mit Zulassung
28.2.2 Zubehör & Einzelkomponenten
28.3 (Wann) rechnet sich das?
28.3.1 Begriffserläuterungen
28.3.2 Verbräuche üblicher Haushaltsgeräte bestimmen
28.3.3 die eigene Grundlast kennen
28.3.4 die perfekte Sonnenausrichtung
28.3.5 Balkonsolar muss nicht an den Balkon
28.3.6 Erspartes & Amortisationsdauer berechnen
28.3.7 Optimierungsmaßnahmen & mehr Einsparung herausholen
28.4 (Wie) kann ich das selbst machen?
28.4.1 handwerklich- technisches
28.4.2 rechtliche Rahmenbedingungen & Anmeldung
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
28.3 (Wann) rechnet sich das?

Eine Balkonsolaranlage wird für die meisten Leute interessant sein, da sie es mit überschaubaren Kosten ermöglicht, die eigenen Stromkosten zu reduzieren.
Doch ab wann und für wen rechnet sich das?
Kurz und knapp wurde die Frage ja bereits eingangs pauschal beantwortet: innerhalb von 5 - 7 Jahren rechnet sich eine Balkonsolaranlage.
Für alle, die es jedoch genauer wissen möchten und ggf. auch mit ein paar Stellschrauben diese Zeit um ein, zwei Jahre verbessern möchten stellt sich eine weitere Frage, und zwar
Wie berechnet man das?
Die Antwort darauf findest Du im nächsten Kapitel.
28.3.1 Begriffserläuterungen
Um ein paar Grundbegriffe kommt man nicht herum, wenn man Photovoltaik verstehen und genaue Werte errechnen möchte.

Solarzelle / Module / Platten
Gleich vorneweg: man spricht nicht von "Platten". Es gibt
a) Solarzellen
b) Photovoltaik Module
Dabei sind Solarzellen die kleinstmögliche Baugröße, um Strom aus Sonnenenergie zu gewinnen, diese sehen so aus

Ein Photovoltaik (oder PV-) Modul besteht idR entweder aus 60 einzelnen Solarzellen oder aus 72 Stück je nach Bauform

Wechselrichter / Gleichrichter / Wandler
Auch hier vorweg: Gleichrichter / Wandler sagt man im Zusammenhang mit Photovoltaik nicht. Man spricht vom Wechselrichter da das Gerät aus der Gleichspannung der PV-Module eine Wechselspannung erzeugt.

Da der Umgang mit Strom für viele Menschen (auch Handwerker) fremd und "unheimlich" ist, wohl auch da man ihn nicht sehen kann versuche ich an dieser Stelle Vergleiche zu einem Gartenschlauch zu ziehen.
Der Vergleich ist nicht zu 100% perfekt aber es gibt einige Parallelen, die es anschaluch erklären lassen.
Volt [V] = Spannung
In etwa vergleichbar mit dem Druck auf einem Gartenschlauch. Ist der Druck niedrig, da der Schlauch z.B. nur an einem Regenfass angeschlossen ist kommt weniger Wasser raus, als am Wasserhahn.
Andererseits ist bei einem Hochdruckreiniger der Druck ganz enorm hoch, aber es kommt trotzdem keine Wassermenge zusammen, da der Schlauchdurchmesser sehr gering ist.
Je höher die elektrische Spannung, desto höher der "Druck".
- Gleichspannung: fester Pluspol und Minuspol. z.B. Autobatterie mit 12V. Ein PV-Modul hat typischerweise 40 - 50V. Gleichspannung wird ab 120V lebensgefährlich
- Wechselspannung: Plus- und Minus wechseln ständig z.B. Steckdose 230V, wechselt 50x pro Sekunde. Wechselspannung wird ab 50V lebensgefährlich
Ampère [A] = Stromstärke
Etwa vergleichbar mit dem Schlauchdurchmesser. Wasserdruck und Schlauchdurchmesser zusammen bestimmen, wieviel Wassermenge am Schlauchende rauskommt.
Watt [W] oder kW = Kilowatt = 1.000 Watt = Leistung
Vergleichbar mit der Wassermenge. Dicker Schlauchdurchmesser und niedriger Wasserdruck kann dieselbe Wassermenge befördern wie dünner Schlauchdurchmesser und hoher Druck.
So ist es beim Strom auch, hierzu wird Spannung und Stromstärke multipliziert:
12V x 10A = 120 Watt
24V x 5A = 120 Watt
240V x 0,5A = 120 Watt
Kilowattstunde [kWh] = Energiemenge
kWh findet man auf der Stromabrechnung und auch als Bezeichnung von Akkugrößen z.B. am eBike (meist Wh also Wattstunde) oder Elektroauto.
1 kWh Stromverbrauch hat man, wenn man z.B.
- 1.000W Fön 1 Stunde lang läuft
- 100W Glühbirne 10 Stunden brennt
- 1W Standby-LED 1.000 Stunden brennt
ein eBike-Akku hat typischerweise um 600Wh = 0,6 kWh Speicherkapazität und kann damit z.B.
- einen 600W Motor für 1 Stunde betreiben
- eine 60W LED für 10 Stunden
- eine 1W Standby-LED für 600 Stunden
Zusammenfassung:
Wichtig im Zusammenhang mit Balkonsolar ist das Verständnis für; sowie die Unterscheidung von Watt und kWh um später die Wirtschaftlichkeit zu berechnen
Inhaltsverzeichnis:
28.1 das Wichtigte in Kurzform
28.2 Die Komponenten & Bezugsquellen
28.2.1 Balkonsolar-Komplettsets mit Zulassung
28.2.2 Zubehör & Einzelkomponenten
28.3 (Wann) rechnet sich das?
28.3.1 Begriffserläuterungen
28.3.2 Verbräuche üblicher Haushaltsgeräte bestimmen
28.3.3 die eigene Grundlast kennen
28.3.4 die perfekte Sonnenausrichtung
28.3.5 Balkonsolar muss nicht an den Balkon
28.3.6 Erspartes & Amortisationsdauer berechnen
28.3.7 Optimierungsmaßnahmen & mehr Einsparung herausholen
28.4 (Wie) kann ich das selbst machen?
28.4.1 handwerklich- technisches
28.4.2 rechtliche Rahmenbedingungen & Anmeldung
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
28.3.2 Verbräuche üblicher Haushaltsgeräte bestimmen
Ein paar Beispiele von typischen Verbräuchen gängiger Haushaltsgeräte
| Notebook | 50 W |
| Zimmerbeleuchtung als Glühbirne | 60 W |
| Zimmerbeleuchtung als LED | 6 W |
| Herd | 4.000 W |
| Wasserkocher / Geschirrspüler / Waschmaschine (Heizphase) | 2.500 W |
| Fön | 2.000 W |
| 50" LED Fernseher | 100 W |
| Playstation | 150 W |
| elektrischer Heizlüfter | 3.000 W |
| Kühlschrank | 0 - 90 W |
| Kaffeemaschine | 1.000 W |
| Heizungs-Umwälzpumpe (Hocheffizienz. / alt) | 30 / 300 W |
| Handy laden | 5 W |
| Handyladegerät nur in Steckdose eingesteckt | 0,5 W |
| WLan-Router | 10 W |
Die angegebenen Verbräuche sind Durchschnittsverbräuche können sich natürlich je nach verwendetem Gerät unterscheiden.
Den eigenen Verbrauch bestimmen
Um den Stromfressern im eigenen Haushalt auf die Schliche zu kommen und um sich mal einen Eindruck zu verschaffen, wo der Stromverbrauch am Jahresende auf der Stromrechnung eigentlich herkommt empfiehlt es sich unbedingt
- ein Strommessgerät anzuschaffen (kostet um 20€)
- nacheinander die eigenen Geräte mal für mindestens 24 Stunden (besser eine Woche) am Strommessgerät stecken zu lassen
- Verbrauch ablesen und notieren -> multiplizieren mit dem aktuellen Strompreis (um 0,40€ / kWh)
Beispiel:
Fernseher 1 Woche lang messen ergibt z.B. 2,1 kWh gemessener Stromverbrauch
- 2,1 kWh x 0,40€ = 0,84€ für diese eine Woche
- 0,84€ x 52 Kalenderwochen = 43,68€ pro Jahr
Danach kann man wunderbar abschätzen, ob es sich lohnt bei einzelnen Verbrauchern die Einschaltdauer zu begrenzen (z.B. Playstation oder TV auf Dauer-An) oder gegen ein energieeffizienteres Modell auszutauschen (z.B. Glühbirne, Kühlschrank)
Strommessgeräte gibt es entweder als einzelnes Gerät

Bezugsquelle:*
- eBay1 / eBay2 / eBay3 / eBay-Suche
- Amazon1 / Amazon2 / Amazon3 / Amazon-Suche
oder mit Smartphone App zur einfachen Auswertung
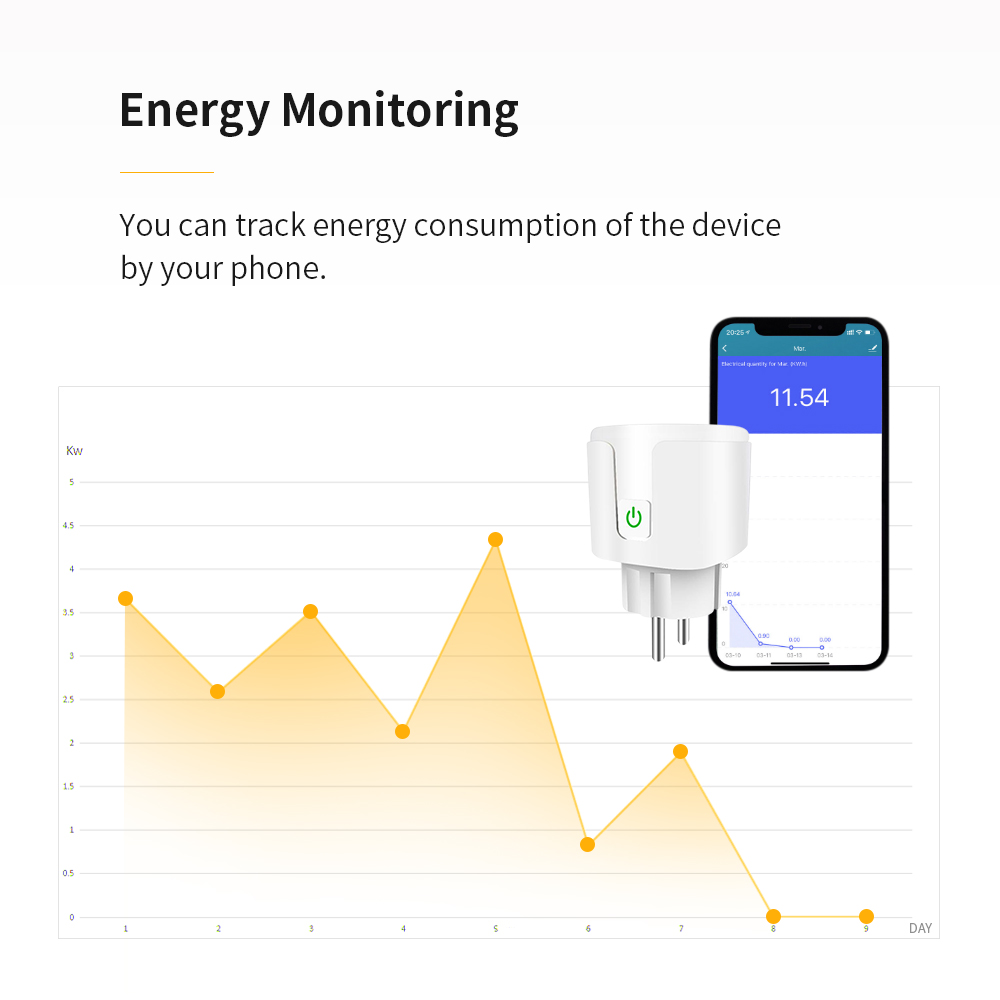
Bezugsquelle:*
- eBay1 / eBay2 / eBay3 / eBay4 / eBay-Suche
- Amazon1 / Amazon2 / Amazon3 / Amazon-Suche
- Aliexpress1 / Aliexpress2 / Aliexpress3 / Aliexpress4 / Aliexpress5 / Aliexpress6
Inhaltsverzeichnis:
28.1 das Wichtigte in Kurzform
28.2 Die Komponenten & Bezugsquellen
28.2.1 Balkonsolar-Komplettsets mit Zulassung
28.2.2 Zubehör & Einzelkomponenten
28.3 (Wann) rechnet sich das?
28.3.1 Begriffserläuterungen
28.3.2 Verbräuche üblicher Haushaltsgeräte bestimmen
28.3.3 die eigene Grundlast kennen
28.3.4 die perfekte Sonnenausrichtung
28.3.5 Balkonsolar muss nicht an den Balkon
28.3.6 Erspartes & Amortisationsdauer berechnen
28.3.7 Optimierungsmaßnahmen & mehr Einsparung herausholen
28.4 (Wie) kann ich das selbst machen?
28.4.1 handwerklich- technisches
28.4.2 rechtliche Rahmenbedingungen & Anmeldung
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
28.3.3 die eigene Grundlast kennen

Grundlast - was ist das?
Die Grundlast ist der Verbrauch, der in der Wohnung / am Haus permanent anliegt und setzt sich zusammen aus der Summe der Verbräuche derjenigen Geräte, die immer an sind wie z.B.
- Kühlschrank
- Gefriertruhe
- WLan-Router
- Heizungsumwälzpumpe
- SAT-Verteiler
- eingesteckte Netzteile
- diverse Geräte im Standby
- ...
wie hoch ist meine Grundlast?
Das lässt sich ganz einfach bestimmen und zwar in drei Schritten:
- abends vor dem Zubettgehen am Stromzähler den Zählerstand + Uhrzeit der Ablesung notieren (über Nacht sollte dann keine Waschmaschine o.ä. laufen und auch sonst alle anderen Personen im Haushalt zu Bett gegangen sein)
- morgens direkt nach dem Aufstehen, vor dem Kaffeekochen erneut den Zählerstand + Uhrzeit notieren
- die Zählerstandsdifferenz dividieren durch die Anzahl der Stunden zwischen den beiden Ablesungen
Beispiel:
- um 23.00 Uhr abends ablesen -> 243546 kWh
- um 7.00 Uhr morgends ablesen -> 243549 kWh
- Differenz 3 kWh / 8 h = 0,375 kW oder 375 Watt
-> die Grundlast beträgt 375 Watt d.h. der Haushalt verbraucht ständig und permanent 375 Watt. Ohne, dass ein Wasserkocher oder ein Backofen zusätzlich an ist.
Diese Zahl ist wichtig
denn die Grundlast ist genau das, was ein Balkonkraftwerk sicher und zumindest tagsüber dauerhaft ausgleichen kann.
Randnotiz:
Das hat im Grunde nicht direkt etwas mit Balkonsolar zu tun aber 375 W Grundlast sind für ein Einfamilienhaushalt sehr hoch, ein guter Wert wäre eher 200 Watt.
Falls Du einen höheren Verbrauch hast lohnt es sich umso mehr, das vorherige Kapitel nochmal durchzulesen und die eigenen Verbräuche zu bestimmen, denn durch Reduzierung der Grundlast kann man sofort und dauerhaft bares Geld sparen.
Beispielrechnung:
- 375 Watt Grundlast x 24h = 9 kWh pro Tag x 365 Tage = 3.285 kWh im Jahr x 0,40€ pro kWh = 1.314€ die pro Jahr an Stromkosten anfallen alleine für Dauerverbraucher und Standby
- 200 Watt Grundlast = 700,80€
bedeutet: 10 Watt eingesparte Grundlast bringen 35€ Ersparnis. Jedes Jahr.
Inhaltsverzeichnis:
28.1 das Wichtigte in Kurzform
28.2 Die Komponenten & Bezugsquellen
28.2.1 Balkonsolar-Komplettsets mit Zulassung
28.2.2 Zubehör & Einzelkomponenten
28.3 (Wann) rechnet sich das?
28.3.1 Begriffserläuterungen
28.3.2 Verbräuche üblicher Haushaltsgeräte bestimmen
28.3.3 die eigene Grundlast kennen
28.3.4 die perfekte Sonnenausrichtung
28.3.5 Balkonsolar muss nicht an den Balkon
28.3.6 Erspartes & Amortisationsdauer berechnen
28.3.7 Optimierungsmaßnahmen & mehr Einsparung herausholen
28.4 (Wie) kann ich das selbst machen?
28.4.1 handwerklich- technisches
28.4.2 rechtliche Rahmenbedingungen & Anmeldung
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
28.3.4 die perfekte Sonnenausrichtung
Der Ertrag von PV-Modulen ist am höchsten, wenn die Sonne im rechten Winkel = 90° auftrifft.
Berücksichtigt man noch, dass die Sonne wandert (von Ost über Süd nach West) sowie im Winter tiefer steht als im Sommer ergibt sich nachfolgendes Bild
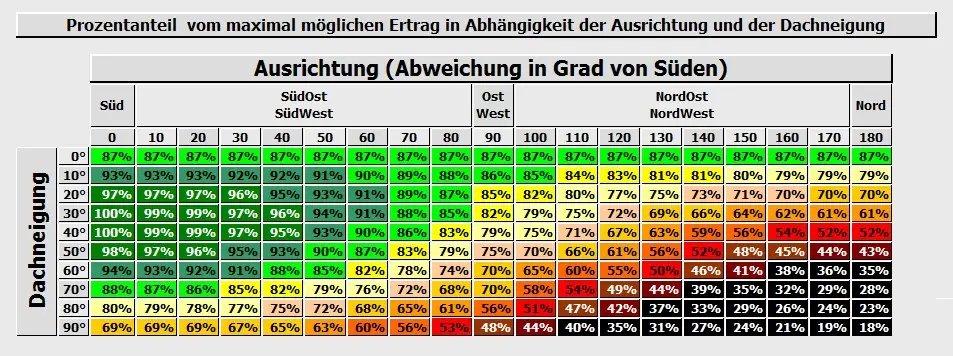
Das bedeutet, dass bei exakter Südausrichtung mit einem Neigungswinkel der PV-Module zwischen 30° und 45° der Ertrag maximal hoch ist.
Aber:
das bedeutet auch, dass
- vormittags und nachmittags kaum Sonne auf die PV-Module scheint
- mittags die vollen 600 W des Balkonkraftwerks produziert werden aber bis auf die Grundlast nur selten mehr ausgenutzt werden können -> der Rest geht ungenutzt ins öffentliche Netz, ohne dass wir etwas davon haben
Besser wäre es also, wenn unser Balkonkraftwerk möglichst lange über den Tag verteilt Strom produzieren würde wobei das durchaus weniger als 600 W sein darf, anstatt zur Mittagszeit Spitzenwerte zu produzieren, die wir nicht oder nur selten ausnutzen können.
Lösung:
Ost-West-Ausrichtung

Bildquelle: E.T. @ science-at-home.de
Wenn es der eigene Platz erlaubt ist eine Ausrichtung der Balkonsolaranlage mit 1x Modul nach Osten, 1x Modul nach Westen ideal, um den ganzen Tag über Sonnenstrom produzieren und nutzen zu können.
Wichtig:
dazu müssen beide Module parallel an den Wechselrichter angeschlossen werden.
Entweder der Wechselrichter besitzt bereits mehrere gesonderte Eingänge (was die meisten haben) dann ist der richtige Anschluss automatisch erledigt,
oder falls der Wechselrichter nur einen Anschluss hat dann benötigt man einen solchen Y-Adapter

Bezugsquellen:*
- eBay1 / eBay2 / eBay3 / eBay-Suche
- Amazon1 / Amazon2 / Amazon3 / Amazon-Suche
- Aliexpress1 / Aliexpress2 / Aliexpress3 / Aliexpress4
Grundsätzlich gilt aber, dass jede Ausrichtung, egal ob Ost, Süd oder West, egal ob 45° Neigung, flach auf dem Boden / Garagendach oder senkrecht an der Fassade Strom produzieren wird und dabei helfen wird, den eigenen Stromverbrauch zu reduzieren.
Hier ein Vergleich bzw. eine Übersicht, wieviel Leistung eine Balkonsolaranlage bringt abhängig von der Ausrichtung
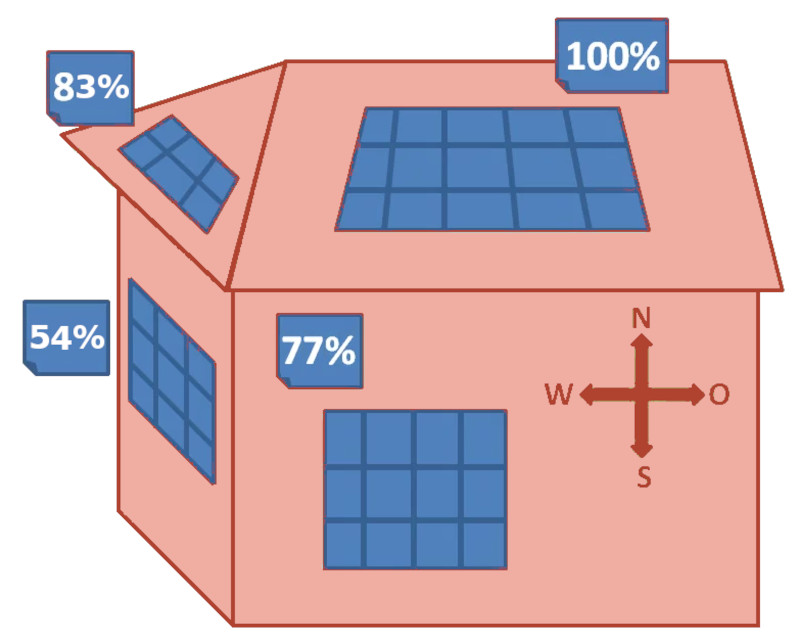
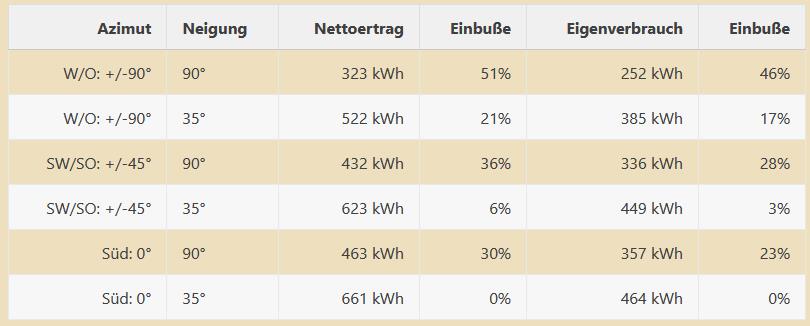
Bildquelle: ddvo.github.io/Solar
Noch genauer abschätzen, wie sich die Ausrichtung auswirkt kann man mit dem kostenlosen Online-Tool PVGIS, welches weiter unten vorgestellt wird unter dem Punkt 28.3.6 Erspartes & Amortisationsdauer berechnen
Inhaltsverzeichnis:
28.1 das Wichtigte in Kurzform
28.2 Die Komponenten & Bezugsquellen
28.2.1 Balkonsolar-Komplettsets mit Zulassung
28.2.2 Zubehör & Einzelkomponenten
28.3 (Wann) rechnet sich das?
28.3.1 Begriffserläuterungen
28.3.2 Verbräuche üblicher Haushaltsgeräte bestimmen
28.3.3 die eigene Grundlast kennen
28.3.4 die perfekte Sonnenausrichtung
28.3.5 Balkonsolar muss nicht an den Balkon
28.3.6 Erspartes & Amortisationsdauer berechnen
28.3.7 Optimierungsmaßnahmen & mehr Einsparung herausholen
28.4 (Wie) kann ich das selbst machen?
28.4.1 handwerklich- technisches
28.4.2 rechtliche Rahmenbedingungen & Anmeldung
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
28.3.5 Balkonsolar muss nicht an den Balkon
Wenn man von einem Balkonkraftwerk oder einer Balkonsolaranlage spricht denkt man möglicherweise zuerst an das, wozu es genau ursprünglich gedacht war - die Anlage muss an einen Balkon montiert werden so wie hier.

Aber dem ist nicht so, es gibt viele andere, mögliche Installationsorte, hier ein paar Beispiele:
auf dem Gartenhaus

oder Brennholzlager

Hallendach

auch senkrechte Montage ist möglich, idealerweise dann nach Süden, gut für tiefstehende Sonne der Wintermonate

oder auch so
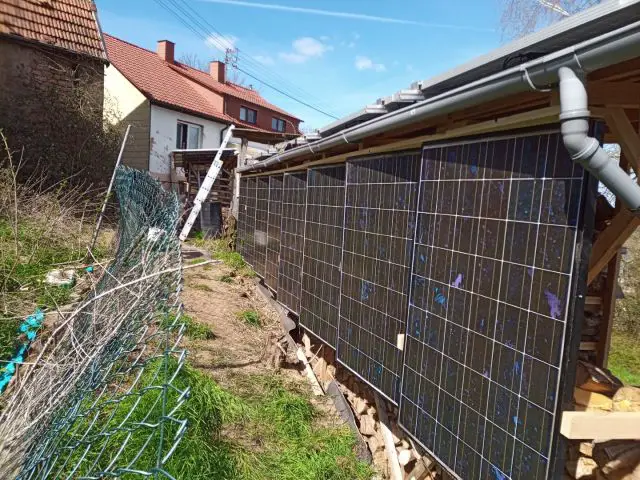
auch Carport oder Flachdach funktioniert mit Hilfe einer Aufständerung (fertige Aufständerungen aus Aluminium s. 28.2.2 Zubehör & Einzelkomponenten)

eine Aufständerung als Freiflächenanlage in der Wiese ist auch möglich

hier als ganz simple, selbstgebaute Ausführung

jede ungenutzte Fäche ist nutzbar

Mit der Idee im Hinterkopf, welche Montageorte in Frage kommen und dem Wissen über die Ideale Ausrichtung aus dem vorangegangenen Kapitel können wir nun als nächstes einige Wirtschaftlichkeitsberechnungen anstellen.
Inhaltsverzeichnis:
28.1 das Wichtigte in Kurzform
28.2 Die Komponenten & Bezugsquellen
28.2.1 Balkonsolar-Komplettsets mit Zulassung
28.2.2 Zubehör & Einzelkomponenten
28.3 (Wann) rechnet sich das?
28.3.1 Begriffserläuterungen
28.3.2 Verbräuche üblicher Haushaltsgeräte bestimmen
28.3.3 die eigene Grundlast kennen
28.3.4 die perfekte Sonnenausrichtung
28.3.5 Balkonsolar muss nicht an den Balkon
28.3.6 Erspartes & Amortisationsdauer berechnen
28.3.7 Optimierungsmaßnahmen & mehr Einsparung herausholen
28.4 (Wie) kann ich das selbst machen?
28.4.1 handwerklich- technisches
28.4.2 rechtliche Rahmenbedingungen & Anmeldung
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
28.3.6 Erspartes & Armortisationsdauer berechnen
Im Internet finden sich mehrere Tools für Photovoltaikanlagen. Doch die meisten zielen nur darauf ab, dass man hinterher etwas beim Anbieter des jeweiligen Rechner-Tools kauft, oder sie sind nur für große PV-Anlagen gedacht.
Hier stelle ich drei Tools zur Berechnung der Wirtschaftlichkeit, vor, die ich selbst nutze und sehr brauchbar finde.
1. Steckersolar-Simulator der HTW Berlin
Eine schnelle, wenn auch sehr grobe Abschätzung lässt sich mit dem "Steckersolar-Simulator" der HTW Berlin berechnen.
- Vorteil: recht genaue Abschätzung von Ertrag, Verbrauch und Amortisation in einem Tool, relativ einfach in der Bedienung
- Nachteil: um den Anschaffungspreis der eigenen Balkonsolaranlage oder Modulleistungen abweichend von 600W händisch eintragen zu können muss man teilweise noch ein, nicht auf den ersten Blick ersichtliches, Schloss-Symbol anklicken.
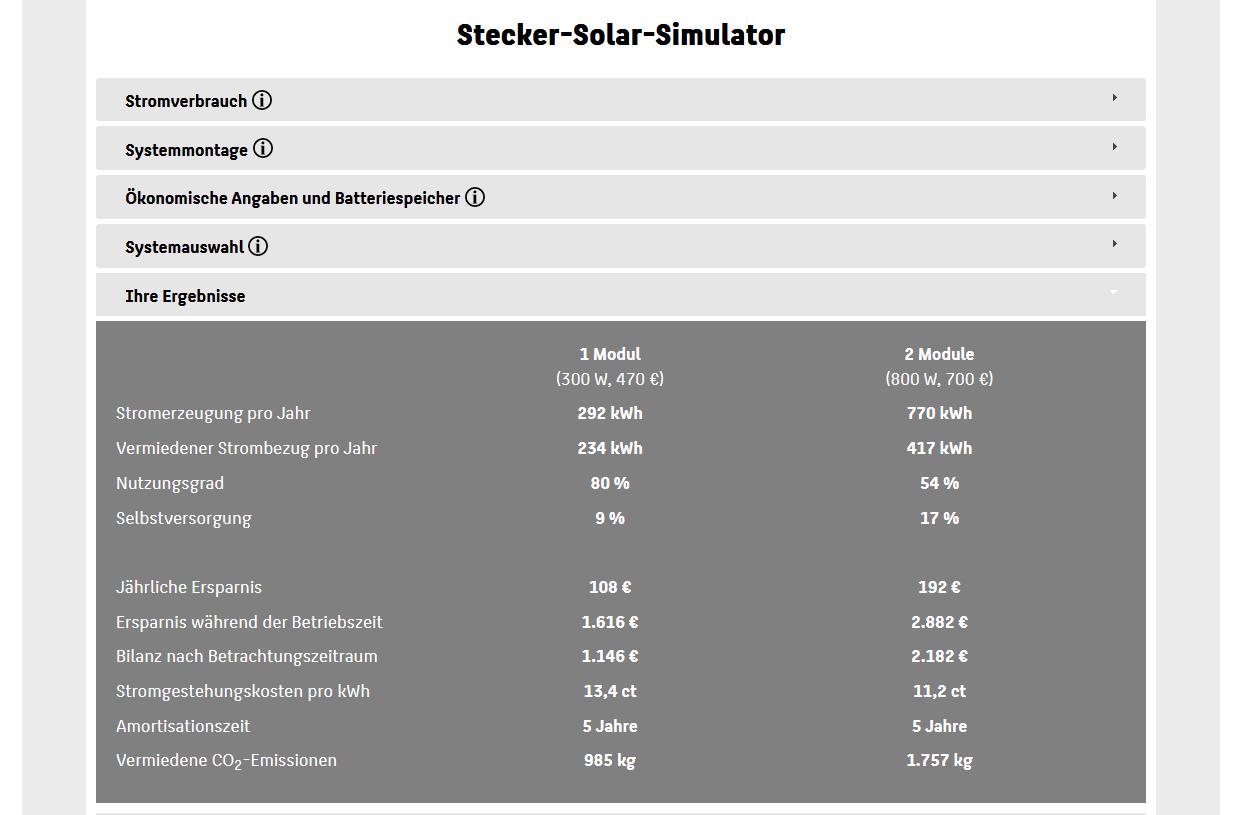
Hier geht's -> zum Stecker-Solar-Simulator
2. PV-Ertragsrechner von Solarserver
Der Rechner von Solarserver ist sehr einfach in der Bedienung. Ausrichtung der Module eingeben nebst Leistung (600 Watt = 0.6 kW, wichtig hier ist einen Punkt zu benutzen und kein Komma) und auf der Karte den eigenen Standort anzuklicken.
- Vorteil: einfach & schnell gemacht
- Nachteil: man erhält nur den Ertrag also die produzierte Strommenge der Anlage, kann aber nicht den eigenen Verbrauch angeben
Das Ergebnis sieht dann so in etwa aus:
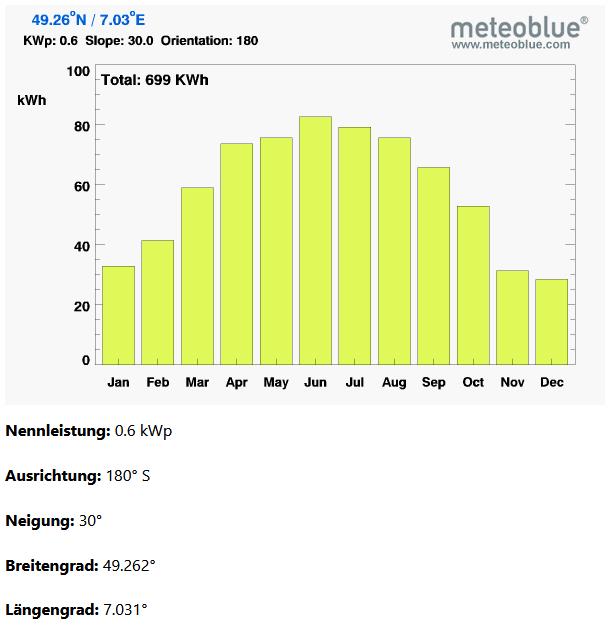
Hier geht's -> zum PV-Ertragsrechner von Solarserver
3. PVGIS - Profi-Tool der EU
Dieses Online-Tool errechnet den Photovoltaikertrag auf basis von Wetterdaten aus den letzten 50 Jahren und ist daher sehr genau, wenn man abschätzen möchte, wieviel Sonneneinstrahlung am eigenen Standort zu erwarten ist.
- Vorteil: sehr aussagekräftig, Profitool. Als Ergebnis erhält man den zu erwartenden Ertrag pro Monat
- Nachteil: nicht ganz einfach in der Bedienung und in der Deutung. Zu allererst unterhalb der Karte den eigenen Standort eingeben, dann die restlichen Daten ausfüllen
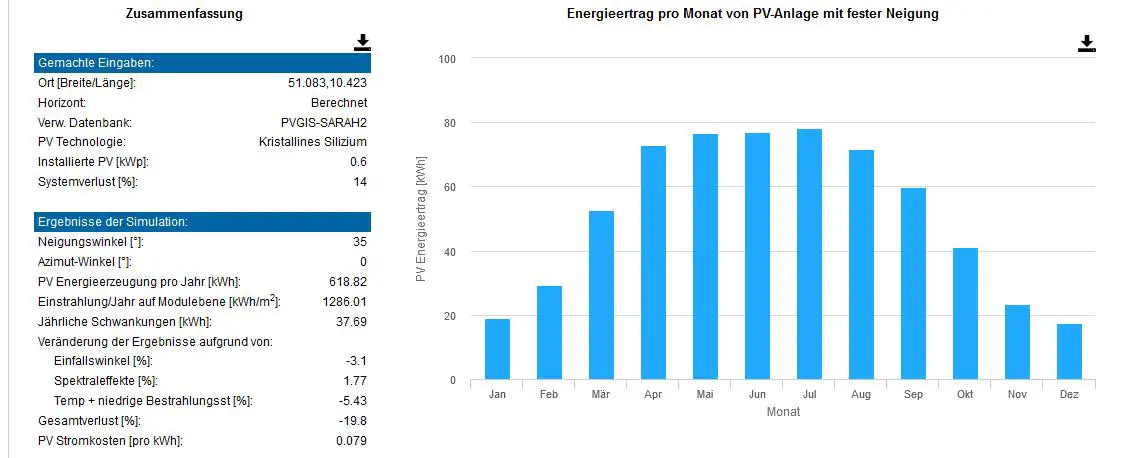
Hier geht's -> zum PVGIS Rechner
Inhaltsverzeichnis:
28.1 das Wichtigte in Kurzform
28.2 Die Komponenten & Bezugsquellen
28.2.1 Balkonsolar-Komplettsets mit Zulassung
28.2.2 Zubehör & Einzelkomponenten
28.3 (Wann) rechnet sich das?
28.3.1 Begriffserläuterungen
28.3.2 Verbräuche üblicher Haushaltsgeräte bestimmen
28.3.3 die eigene Grundlast kennen
28.3.4 die perfekte Sonnenausrichtung
28.3.5 Balkonsolar muss nicht an den Balkon
28.3.6 Erspartes & Amortisationsdauer berechnen
28.3.7 Optimierungsmaßnahmen & mehr Einsparung herausholen
28.4 (Wie) kann ich das selbst machen?
28.4.1 handwerklich- technisches
28.4.2 rechtliche Rahmenbedingungen & Anmeldung
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
28.3.7 Optimierungsmaßnahmen & mehr Einsparung herausholen
Um Ertrag bzw. Wirtschaftlichkeit einer Balkonsolaranlage zu optimieren bieten sich drei Maßnahmen an

1. Ausrichtung der Solarmodule optimieren
Diese Maßnahme wurde bereits erläutert unter 28.3.4 die perfekte Sonnenausrichtung
Dennoch an dieser Stelle nochmal eine Zusammenfassung
- eine reine Südausrichtung produziert mehr Strom als selbst genutzt werden kann und lässt unnötig viel Strom ungenutzt ins öffentliche Netz fließen
- besser: zwei PV-Module unterschiedlich ausrichten, Ost+West oder Ost+Süd oder Süd+West
- eine steilere Neigung (60 - 70° Aufstellwinkel) bringt mehr Ertrag in den sonnenschwachen Wintermonaten
2. Überbelegung
Um die nicht optimale Ausrichtung der Module aus dem vorherigen Tipp zu kompensieren macht es Sinn, obwohl der Balkonsolar-Wechselrichter nur 600 Watt Leistung erbringen kann, PV-Module mit mehr als 600 Watt anzuschließen.
So wird ein beispielsweise 400 Watt Modul, dass mit steilen 70° Aufstellwinkel nach Westen ausgerichtet ist dennoch rund 300 Watt produzieren können, während ein knapp bemessenes 300 Watt Modul an gleicher Stelle vielleicht nur noch 200 Watt produzieren würde.
Das Anschließen von höherer Solarleistung als der Wechselrichter liefern kann nennt man Überbelegen.
Das ist unschädlich für den Wechselrichter denn es ist nicht so, dass die PV-Module ihre Leistung in den Wechselrichter "drücken" sondern der Wechselrichter nimmt sich nur soviel von den PV-Modulen, wie er selbst verarbeiten kann.
3. Eigenverbrauch optimieren
Wir erinnern uns an die Grundlast aus dem vorangegangenen Punkt 28.3.3 die eigene Grundlast kennen
Ein Balkonkraftwerk kann hauptsächlich die tagsüber anliegende Grundlast des eigenen Haushalts abdecken. Stromerzeugung, die größer ist als diese Grundlast geht ungenutzt ins öffentliche Netz.
Und genau hier liegt ein weiteres Optimierungspotential. Wie?
Indem wir versuchen, unsere Gewohnheiten so zu ändern, dass wir elektrische Haushaltsgeräte mit hohem Stromverbrauch dann benutzen, wenn die Balkonsolaranlage viel Strom produziert.
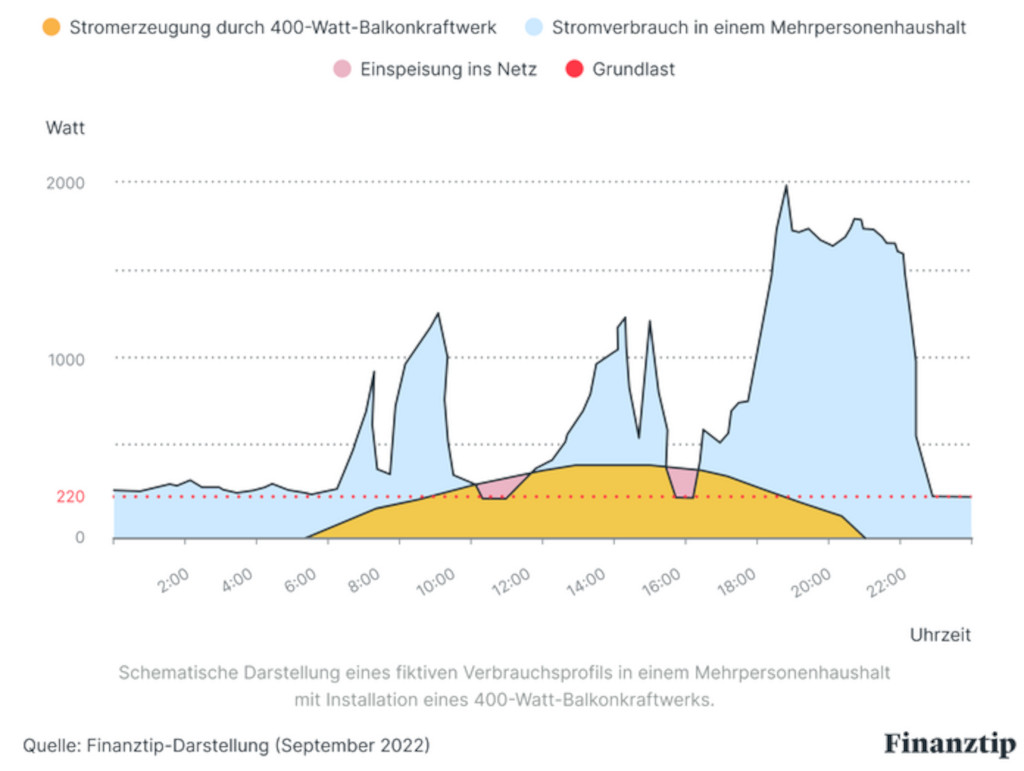
Bilderklärung:
- die rot gestrichelte Linie ist die dauerhaft anliegende Grundlast, die tagsüber durch das Balkonkraftwerk gedeckt wird
- wenn die Sonne richtig scheint und die PV-Module gut ausgerichtet sind produziert die Anlage über die Mittagszeit mehr Strom, als verwendet werden kann = die zwei roten Flächen
- da hier im Bild ein lediglich 400W starkes Balkonkraftwerk verwendet wird werden bei 600W deutlich mehr und größere rote Flächen zu sehen sein
damit so wenig Strom wie irgend möglich "verschenkt" wird ist es sinnvoll, in den sonnenreichen Stunden stromhungrige Geräte anzuschalten damit möglicht viel eigener Sonnenstrom ausgenutzt werden kann
- Waschmaschine
- Geschirrspüler
- Kochen / Backen
- Wasserkocher, Kaffeemaschine
- elektrische Gartengeräte
- Laden von Akkus z.B. eBike, Tablet, Handy
- ...
Tipp:
Hier lohnt sich die Verwendung eins Strommessgeräts wie unter Punkt 28.3.2 Verbräuche üblicher Haushaltsgeräte bestimmen in welches der Wechselrichter des Balkonkraftwerks eingesteckt ist um die erzeugte Leistung in Echtzeit sehen zu können und dann entsprechend zusätzliche Verbraucher anzuschalten, damit der selbsterzeugte Sonnenstrom möglichst gut ausgenutzt ist.
Inhaltsverzeichnis:
28.1 das Wichtigte in Kurzform
28.2 Die Komponenten & Bezugsquellen
28.2.1 Balkonsolar-Komplettsets mit Zulassung
28.2.2 Zubehör & Einzelkomponenten
28.3 (Wann) rechnet sich das?
28.3.1 Begriffserläuterungen
28.3.2 Verbräuche üblicher Haushaltsgeräte bestimmen
28.3.3 die eigene Grundlast kennen
28.3.4 die perfekte Sonnenausrichtung
28.3.5 Balkonsolar muss nicht an den Balkon
28.3.6 Erspartes & Amortisationsdauer berechnen
28.3.7 Optimierungsmaßnahmen & mehr Einsparung herausholen
28.4 (Wie) kann ich das selbst machen?
28.4.1 handwerklich- technisches
28.4.2 rechtliche Rahmenbedingungen & Anmeldung
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
28.4 (Wie) kann ich das selbst machen?

Die Frage, ob und wie man eine solche Steckersolaranlage selbst installieren kann ist naheliegend.
Hierzu eine Unterteilung in die beiden Aspekte, die es zu betrachten gilt.
28.4.1 handwerklich- technisches

Vom Handwerklichen her ist die Installation einer Balkonsolaranlage denkbar einfach.
Die Stecker zum Verbinden von Photovoltaik-Modulen und Wechselrichtern sind genormt und verpolungssicher, d.h. der "Plus" am Modul passt auch nur auf den "Plus" am Wechselrichter, der Minus nur auf den Minus.

Das sind so.g MC4 Stecker bzw. MC4-kompatible Stecker (so ähnlich wie mit "Tesa" oder "Tempo" ist auch "MC4" ein Markenname und es gibt unzählige, kompatible weitere Hersteller), Werkzeug braucht man dazu nicht.
Der Wechselrichter wird dann entweder direkt in eine beliebige Steckdose eingesteckt oder mittels Wieland-Einspeisesteckdose.
Die Installation der PV-Module und des Wechselrichters darf auch ohne weiteres selbst durchgeführt werden, da gibt es keinerlei Vorschrift, die dagegen spricht.
Einzig die Installation einer Einspeisesteckdose darf nur durch einen Elektro-Fachbetrieb durchgeführt werden, näheres dazu im nächsten Punkt.
Inhaltsverzeichnis:
28.1 das Wichtigte in Kurzform
28.2 Die Komponenten & Bezugsquellen
28.2.1 Balkonsolar-Komplettsets mit Zulassung
28.2.2 Zubehör & Einzelkomponenten
28.3 (Wann) rechnet sich das?
28.3.1 Begriffserläuterungen
28.3.2 Verbräuche üblicher Haushaltsgeräte bestimmen
28.3.3 die eigene Grundlast kennen
28.3.4 die perfekte Sonnenausrichtung
28.3.5 Balkonsolar muss nicht an den Balkon
28.3.6 Erspartes & Amortisationsdauer berechnen
28.3.7 Optimierungsmaßnahmen & mehr Einsparung herausholen
28.4 (Wie) kann ich das selbst machen?
28.4.1 handwerklich- technisches
28.4.2 rechtliche Rahmenbedingungen & Anmeldung
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
28.4.2 rechtliche Rahmenbedingungen & Anmeldung

Es gibt eine knappe handvoll rechtlicher Rahmenbedingungen, die relevant sind,
diese werden hier kurz und einfach aufgeführt und erklärt.
1. Art des Wechselrichters

Da der Wechselrichter eine 230V Spannung erzeugt und in das Hausnetz sowie bei Überschuss auch in das öffentliche Stromnetz einspeist muss er den Anforderungen der VDE = Verband Deutscher Elektriker entsprechen und zwar ganz konkret der
VDE AR-N 4105
Wechselrichter ohne diese Zertifizierung dürfen nicht verwendet werden und man kann sie auch nicht beim Netzbetreiber anmelden, was zwingend erforderlich ist für einen legalen Betrieb s. auch weiter unten unter 4. Anmeldung der Anlage.
Vorsicht: Im Internet findet man auch viele Angebote mit Wechselrichtern ohne gültige VDE
Bezugsquellen für erlaubte Wechselrichter findest Du unter -> 28.2.2 Zubehör & Einzelkomponenten
2. Anschluss des Wechselrichters
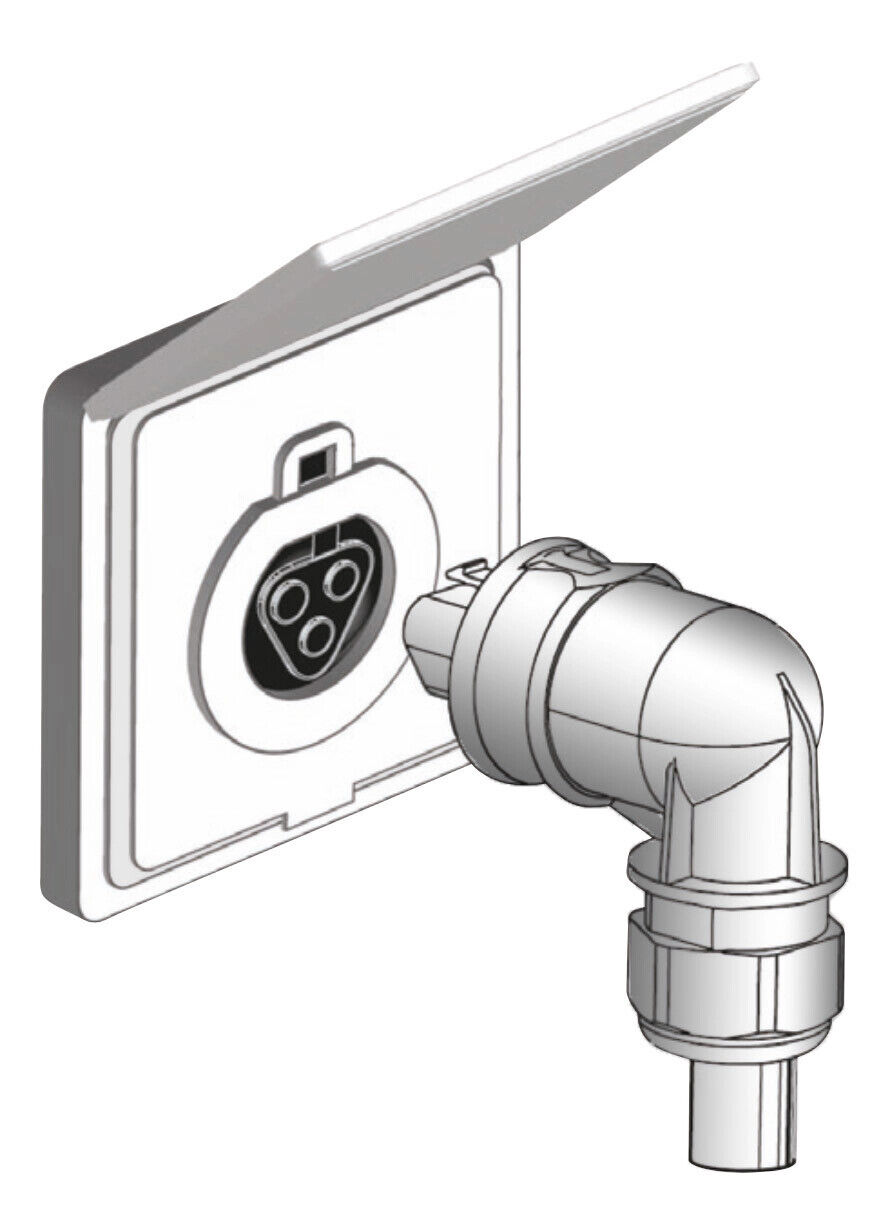
nach aktuellem Stand* (03.2023) darf der Wechselrichter eines Balkonkraftwerkes nur angeschlossen werden
- entweder mittels spezieller Wieland (= Markenname) Einspeisesteckdose - diese muss von einem Fachbetrieb installiert werden
- oder fest verdrahtet mittels z.B. Aufputz-Verteilerdose - diese muss ebenfalls von einem Fachbetrieb installiert werden
Bezugsquellen für eine solche Einspeisesteckdose findest Du unter -> 28.2.2 Zubehör & Einzelkomponenten
Leider sind alle VDE-Normen nicht frei zugänglich, müssen gegen eine recht hohe Lizenzgebühr erworben werden um sie einsehen zu können, deswegen hier ein Zitat der VDE-Webseite zu diesem Punkt, wo es auch eine Zusammenfassung zu Balkonkraftwerken gibt:
Der Anschluss der Anlagen darf nur über eine spezielle Energiesteckvorrichtung unter Berücksichtigung der Anforderungen nach DIN VDE V 0100-551 und DIN VDE V 0100-551-1 erfolgen
Quelle: VDE.com
*Anmerkung: die VDE selbst schlägt Anfang 2023 mit einem ausgiebigen Positionspapier nun vor, ihre eigenen Vorgaben zu lockern und per Gesetz abzuändern. Eine der Änderungen soll sein, dass die Einspeisesteckdose nicht mehr benötigt wird und stattdessen jede normale Steckdose benutzt werden darf. Allerdings ist diese Neuerung Stand 03.2023 noch nicht umgesetzt
{phocadownload view=file|id=83|target=b}
3. Art des Stromzählers

Beim Stromzähler gilt die Vorgabe, dass dieser nicht rückwärtsdrehend sein darf.
Das sind generell schonmal alle schwarzen Stromzähler mit Drehscheibe, die sog. "Ferraris Zähler" - hat man einen solchen verbaut ist der Betrieb eines Balkonkraftwerkes nicht zulässig, der Zähler muss vorher getauscht werden.
Aber auch bei den neueren, digitalen Zählern muss man hinschauen ob dieser eine sog. Rücklaufsperre hat.
Wenn Dein Zähler eines der beiden untenstehenden Symbole aufgedruckt hat dann besitzt er eine Rücklaufsperre und kann benutzt werden. Falls das Symbol fehlt muss er getauscht werden.

Wer tauscht den Stromzähler und was kostet das?
Das wird leider regional unterschiedlich gehandhabt. Manchmal genügt ein Anruf beim zuständigen Netzbetreiber und dieser tauscht, mit einer gewissen Vorlaufzeit, den Zähler aus gegen einen neuen, oftmals auch kostenfrei denn es werden sowieso gerade deutschlandweit nach und nach die alten Zähler gegen neue getauscht. Manche Netzbetreiber lassen sich den (vorzeitigen) Tausch jedoch bezahlen oder sperren sich gänzlich.
Das ist auch ein Punkt, der nach den neuen VDE-Normen geändert werden soll. Ziel: der Netzbetreiber soll künftig den Zähler tauschen müssen, bis dahin sollen auch die alten Zähler in Verbindung mit Balkonsolar erlaubt sein.
4. Anmeldung der Anlage
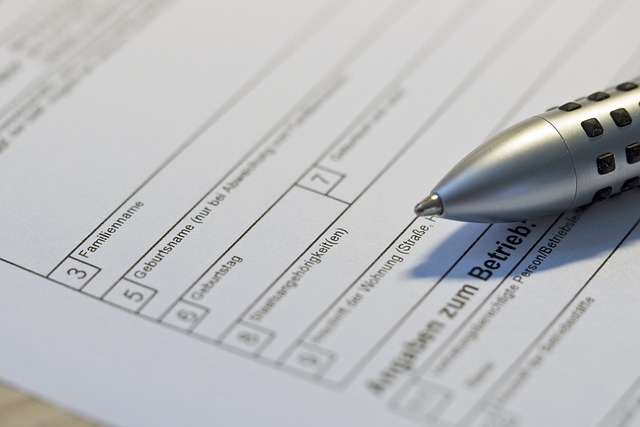
Vorweg die gute Nachricht: die meisten Netzbetreiber erlauben mittlerweile das sog. "vereinfachte Anmeldeverfahren" sodass viele bürokratische Gängeleien weggefallen sind
- kein mehrseitiges Anmeldeformular inkl. Inbetriebnahmeprotokoll mehr
- keine Anmeldung mehr durch Fachbetrieb notwendig sondern darf selbst vorgenommen werden
- keine Gebühren für die Anmeldung
- keine Prüfung vor Ort
- keine Anmeldung beim Finanzamt erforderlich
- kein zusätzlicher Aufwand bei der Steuererklärung (auch keine Umsatzsteuer)
was bleibt sind zwei Anmeldeschritte, die gemacht werden müssen
1. beim Netzbetreiber
2. beim Marktstammdatenregister
Beide Anmeldungen können in wenigen Minuten selbst durchgeführt werden und sind kostenfrei. Eine ANleitung dazu findest Du nun nachfolgend.
Anmeldung 1 - beim zuständigen Netzbetreiber
Hinweis: der Netzbetreiber ist nicht zwangsläufig der Stromlieferant.
Mit dem Stromlieferanten hast Du einen Vertrag über Strombezug, dieser kann auch in einem ganz anderen Bundesland sitzen und ist frei wählbar.
Der Netzbetreiber hingegen unterhält die Stromleitungen und Trafostationen vor Ort, ist demnach auch nicht frei wählbar. Viele Netzbetreiber haben zusätzlich auch eine Vertriebssparte als Stromlieferant, aber das ist nicht zwangsläufig so und deswegen muss man unterscheiden, um schlussendlich die ANmeldung auch an der richtigen Stelle durchzuführen.
Im Saarland ist der Netzbetreiber in fast allen Regionen die "Energis Netzgesellschaft".
Hier nun das Anmeldeformular, welches als Pdf gedownloaded, selbst ausgefüllt und per Mail zurück an die Energis Netzgesellschaft geschickt werden kann bzw. muss (Anklicken zum Download)
Sollte der Download mal nicht funktionieren hat die Energis vermutlich ein neues Formular herausgebracht. Dann am besten die Energis anrufen und um Zusendung des Formulars per Mail bitten.
Hinweis: das oben gezeigte und verlinkte Formular gilt nur für die Energis Netzgesellschaft. Du musst beim für Dich zuständigen Netzbetreiber dessen eigenes Anmeldeformular benutzen! Hierzu einfach auf der jeweiligen Webseite stöbern / Google bemühen / dort anrufen und nachfragen.
Mit der Übermittlung der Zählernummer an den Netzbetreiber wird dieser auch in seinem System nachschauen, um welchen Zählertyp es sich handelt und Rückmeldung geben, falls der Zähler für ein Balkonkraftwerk unzulässig ist.
In diesem Fall kannst Du dann vereinbaren, wie oder ob ein Zählertausch erfolgen wird.
Daher mein Tipp: unbedingt vor dem Kauf einer Anlage das Formular ausfüllen und abschicken und auf Rückmeldung des Netzbetreibers warten um sicher zu gehen, dass der verbaute Zähler entweder bereits passt oder dass ein Zählertausch in absehbarer Zeit durchgeführt wird.
Anmeldung 2 - beim Marktstammdatenregister MaStR

Die Anmeldung im MaStR dient rein statistischen Zwecken und ist verpflichtend für alle Betreiber einer Photovoltaik-Anlage.
Auch diese Anmeldung kann einfach selbst durchgeführt werden, ist kostenlos und in 5 Minuten erledigt.
Hier geht's zur Anmeldung -> Anmeldung der Balkonsolaranlage im MaStR
Das war's 😀
Inhaltsverzeichnis:
28.1 das Wichtigte in Kurzform
28.2 Die Komponenten & Bezugsquellen
28.2.1 Balkonsolar-Komplettsets mit Zulassung
28.2.2 Zubehör & Einzelkomponenten
28.3 (Wann) rechnet sich das?
28.3.1 Begriffserläuterungen
28.3.2 Verbräuche üblicher Haushaltsgeräte bestimmen
28.3.3 die eigene Grundlast kennen
28.3.4 die perfekte Sonnenausrichtung
28.3.5 Balkonsolar muss nicht an den Balkon
28.3.6 Erspartes & Amortisationsdauer berechnen
28.3.7 Optimierungsmaßnahmen & mehr Einsparung herausholen
28.4 (Wie) kann ich das selbst machen?
28.4.1 handwerklich- technisches
28.4.2 rechtliche Rahmenbedingungen & Anmeldung
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
Inhaltsverzeichnis:
- 1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)
- 2 Idee + Plan
- 3 Akku-Arbeitsplatz
- 4 eBike Akku Komponenten
- 5 eBike Akku zerlegen
- 6 Laptop Akkus zerlegen
- 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte
- 8 neue Hülle für 18650
- 9 China-Akkutest
- 10 Werkzeuge + Messgeräte
- 11 Null-Watt Einspeisung
- 12 Modbus / RS485 Adapter
- 13 BMS + Balancer
- 14 aktiv Balancer BMS - JKBMS
- 15 Ladegeräte + Kapazitätstester
- 16 kpl. Akkupacks testen
- 17 Innenwiderstand Ri
- 18 Solar Laderegler
- 19 Wechselrichter, Inverter
- 20 Löten - Anleitung für Akkus
- 21 Schlüsselanhänger aus 18650
- 22 Sicherheitskonzept
- 23 Akkus Beschaffung - wie und wo?
- 24 WVC / SG / GMI / PVGS Mikroinverter
- 25 Schritt-für-Schritt zur 18650 Powerwall
- 26 ATS - Automatic Transfer Switch
- 27 Schottky Sperrdioden für Parallelschaltung
- 28 Balkonsolar & Balkonkraftwerk
- 29 Hybrid Wechselrichter einrichten
29 Hybrid Wechselrichter einrichten
In diesem Kapitel geht es um netzparallele = Ongrid Hybrid Wechselrichter:
- MPP Solar MPI Serie (MPI 3k, MPI 4k, MPI 5k, MPI 5.5k, MPI 10k)
- Infinisolar (2KW, Plus 3KW, Plus II 3KW, Super 4KW, 5KW, 5.5KW, 10KW, 15KW)
- EASun (IGrid SE 5.5KW, IGrid TT 10KW)
- FSP Powermanager-Hybrid Serie (4KW, 5k Plus, 10KW, 15KW)

Die o.g. Markennamen sind bis auf unterschiedliche Gehäusefarben allesamt identisch da der originäre und einzige Hersteller, der die Geräte tatsächlich auch produziert "Voltronic" ist wobei Voltronic nicht selbst verkauft sondern nur für Großhändler produziert.
Bezugsquellen findest Du hier:
- Hybrid Wechselrichter MPI 10k mit 10000 Watt von MPP Solar Infinisolar
- Hybrid Wechselrichter MPI 5.5k mit 5500 Watt von MPP Solar Infinisolar
Es geht hier NICHT um Offgrid Modelle die so oder so ähnlich aussehen:

Noch ein Satz zum Unterschied:
Die meisten Hybrid-Wechselrichter, die auf eBay und Amazon für 400 - 700€ kursieren in diversen Farben und unter zig Markennamen sind Offgrid-Wechselrichter, d.h.
- sie können keinen Strom ins öffentliche Netz einspeisen
- sie können nicht parallel an einem beliebigen Punkt eines bestehenden Hausnetzes angeklemmt werden, sondern der gesamte Hausstrom muss durch den Wechselrichter hindurch fließen
Mehr zu den unterschiedlichen Wechselrichterarten habe ich hier erklärt: Leitfaden Akkus & PV von A-Z - 19 Wechselrichter, Inverter
Inhaltsverzeichnis:
- 29.1 Wechselrichter einstellen mittels Solarpower Software
- 29.2 SDM 630 Energy Meter & Überschusseinspeisung einstellen
- 29.3 Ethernet anstatt Modbus
- 29.4 Wechselrichter über Netzwerk steuern & auslesen
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
29.1 Wechselrichter einstellen mittels Solarpower Software
Man kann die Wechselrichter allesamt auf zwei Arten einstellen
- direkt am Display mittels der Knöpfe. Ist ziemlich umständlich da es sehr viele Optionen zum Einstellen gibt
- mittels USB-Anschluss und PC / Laptop und der dazugehörigen "Solarpower" Software
Solarpower Software (NICHT Watchpower, die ist für die Offgrid Modelle) zur Steuerung des Wechselrichters
zum Downloaden unter: MPPSolar.com -> Downloads -> Monitoring Software -> SOLARPOWER (HYBRID)
Software downloaden, installieren, PC und Wechselrichter mittels USB-Kabel verbinden. Es wird einen Moment dauern, bis die Software den Wechselrichter gefunden hat. Solange die Verbindung noch nicht erfolgreich besteht wird die Software erstmal in etwa so aussehen:

wenn die Verbindung steht und die Werte des Wechselrichters übermittelt wurden sieht das dann so aus (hier im Beispielbild mein Infinisolar 5.5k)
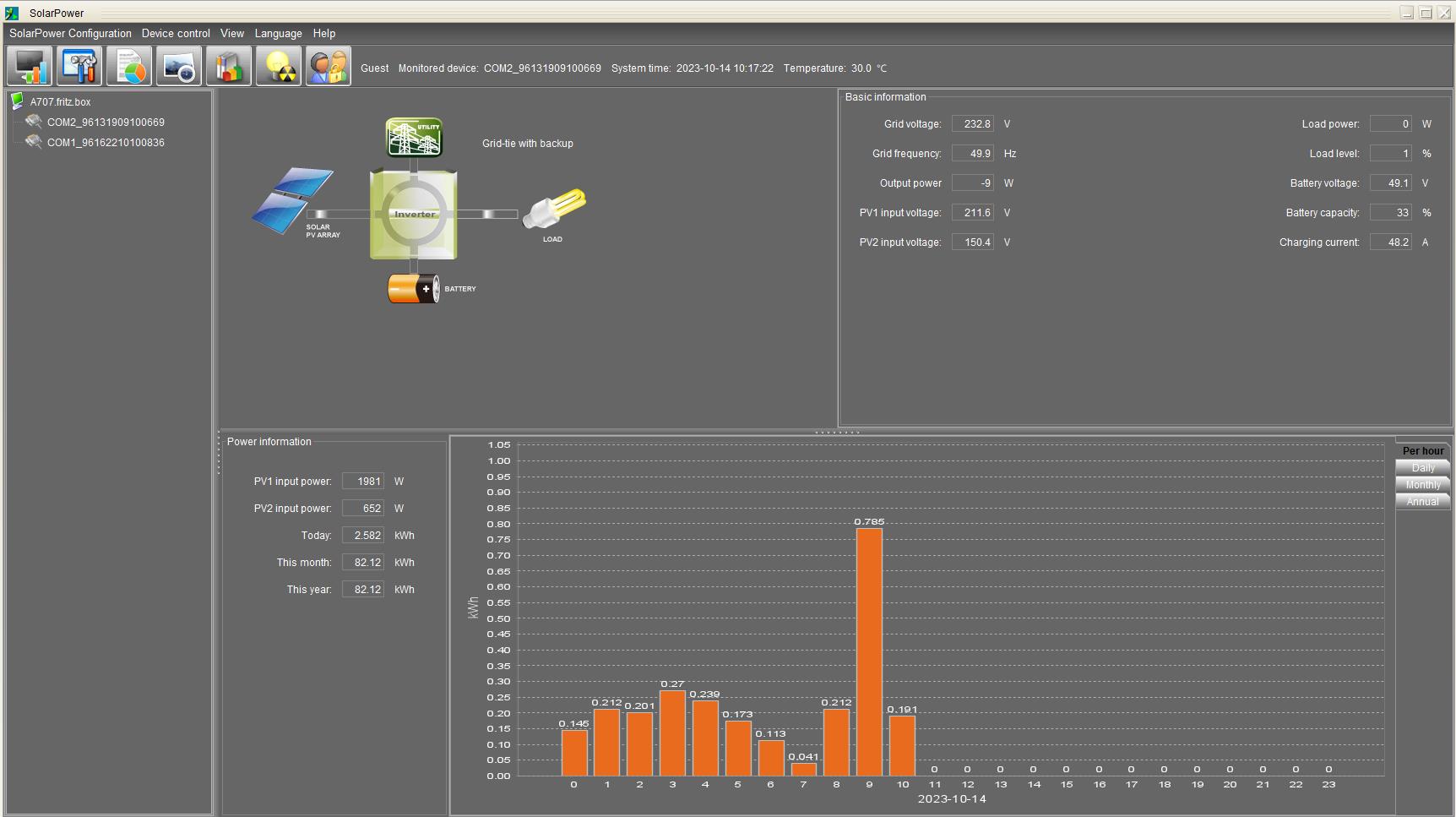
In den beiden nachfolgenden Kapitel werden wir den Hybrid Wechselrichter korrekt einstellen um eine Überschusseinspeisung zu realisieren.
Ich benutze (aktuell) Solarpower in dieser Version:
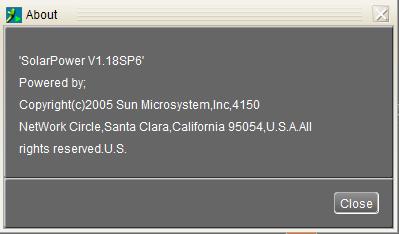
Inhaltsverzeichnis:
- 29.2 SDM 630 Energy Meter & Überschusseinspeisung einstellen
- 29.3 Ethernet anstatt Modbus
- 29.4 Wechselrichter über Netzwerk steuern & auslesen
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
29.1.1 einphasiger Hybrid Wechselrichter einstellen (2kW, 3kW, 4kW, 5kW, 5.5kW)
Hier zeige ich, wie ich meinen Infinisolar 5.5k eingestellt habe.
Bezugsquelle: Hybrid Wechselrichter MPI 5.5k mit 5500 Watt von MPP Solar Infinisolar
Da der 5.5k ein einphasiges Modell ist sind die Einstellungsoptionen weitestgehend deckungsgleich mit den kleineren Modellen 2k, 3k, 4k sowie 5k.
Zu den Einstellungen der dreiphasigen Modelle 10k und 15k weiter unten.
Hier nochmal die benötigte Software: Solarpower Software (NICHT Watchpower, die ist für die Offgrid Modelle) zur Steuerung des Wechselrichters
zum Downloaden unter: MPPSolar.com -> Downloads -> Monitoring Software -> SOLARPOWER (HYBRID)
Ich zeige hier nur die notwendigen Einstellungen für den Modus "Überschusseinspeisung".
Das bedeutet:
- der Wechselrichter muss netzparallel angeschlossen sein, also nicht im Inselbetrieb
- es ist ein SDM 630 Energymeter verbaut und angeschlossen
- mit dem PV-Strom wird zuerst der Haushaltsverbrauch abgedeckt, ist dann noch Strom übrig wird damit der Akku geladen, ist kein Akku vorhanden oder ist der Akku voll dann wird der überschüssige Strom ins öffentliche Netz eingespeist
- wenn die Sonne nicht scheint oder nicht stark genug ist dann wird aus dem Akku soviel Strom entnommen, dass der Haushaltsverbrauch abgedeckt ist. Wenn weder die Sonne scheint noch der Akku voll ist dann wird der benötigte Haushaltsstrom ganz normal aus dem öffentlichen Netz bezogen
MyPower Management
In Solarpower unter "Device Control" nun den Menüpunkt "MyPower Management" öffnen und alles so einstellen wie hier auf dem Bild zu sehen.
- Anmerkung1: wenn Du anstelle einer Überschusseinspeisung eine Null-Einspeisung (Null-Watt-Einspeisung) haben möchtest dann nimm den Haken raus bei "Allow to feed-in to the Grid"
- Anmerkung2: bei Verwendung von gebrauchten Akkuzellen oder eines sehr alten Akkus, der sich bei längerer Nichtbenutzung von alleine entlädt macht es Sinn diesen bei Unterschreitung von 46V automatisch sporadisch vom Netz etwas nachzuladen. Dazu (und nur dann) den Haken setzen bei "AC to charge battery" sowie die Einstellungen unten links in dem Block unterhalb "This option is ineffective during of AC charging"
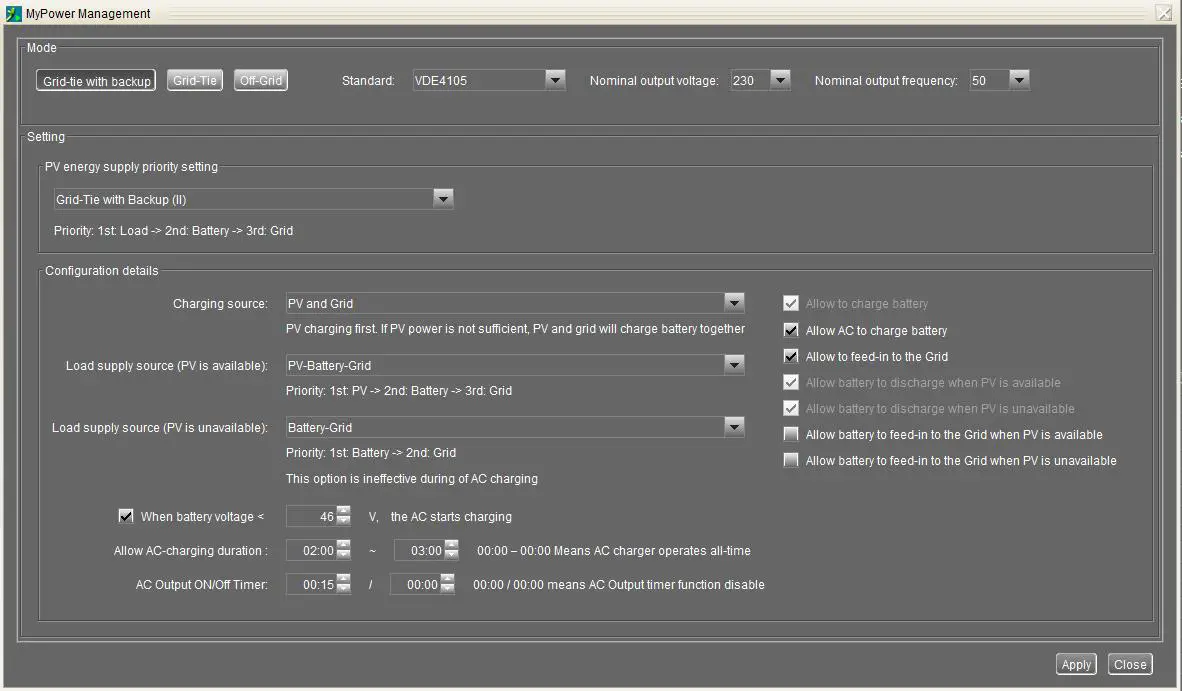
Parameters setting
In Solarpower unter "Device Control" nun den Menüpunkt "Parameters setting" auswählen. Viele der unten gezeigten Einstellungen sind default Werte.
Zu den Spannungswerten die Batterie betreffend ist folgendes zu sagen: diese sind immer anzupassen auf den verwendeten Akku und können daher bei Dir abweichen, je nachdem welches System Du hast. Ich nutze einen 48V Akku bestehend aus gebrauchten 18650er LiIon Zellen in 14S Konfiguration, also 14 Zellen in Reihe. Ich möchte die Zellen schonen betreiben zwischen maximal 4,0V und minimal 3,3V und komme daher auf folgende Gesamtspannungswerte:
- minimale Gesamtspannung: 14x 3,3V = 46,2V
- maximale Gesamtspannung: 14x 4,0V = 56,0V
Das bedeutet, der Akku soll bis 56,0V geladen werden und bis 46,2V entladen werden, dann soll der Wechselrichter aufhören, Strom zu entnehmen. Ich habe 46,0V eingestellt da bei Belastung die Spannung eh etwas einbricht, wenn dann bei 46,0V abgeschaltet wird dann springt die Batteriespannung nochmal etwas nach oben.
Für die EInstellungen bedeutet das:
- Bulk charging voltage sowie auch floating charging voltage beide auf den identischen Wert 56,0V setzen (floating voltage ist bei LiIon und LiFePo4 immer auf denselben Wert zu setzen, lediglich bei Blei-Säurebatterien oder AGM wird die floating Spannung höher gesetzt)
- Battery cut-off discharging voltage auf 46,0V setzen
Hier noch ein paar Besonderheiten in meinen Einstellungen:
- Anmerkung1: Max. feed-in grid power habe ich auf 3.700W gesetzt, Standard ist hier 5.500W. Da meine 230V Stromleitung nicht ausreichend stark dimensioniert ist kann ich lediglich mit 16A = 3.700W einspeisen und musste den Wert entsprechend im Wechselrichter anpassen, um die Zuleitung nicht zu überlasten. Um diesen Wert zu verändern braucht man das "factory password". Das Passwort lautet: zAxE12_ObB8ya
- Anmerkung2: ich musste auch den Wert "max. battery discharge current in hybrid mode" reduzieren auf 50A da meine verwendete DC-Sicherung zwischen Wechselrichter und Batterie nur für 50A Dauerstrom ausgelegt ist, deswegen ist auch der Wert "Max. charging current" auf 60A eingestellt (das Laden geschieht meist ja nicht stundenlang mit Höchstleistung deswegen kann der Wert ruhig höher sein als der Entladestrom, denn wenn z.B. das E-Auto geladen wird dann ja über mehrere Stunden konstant)
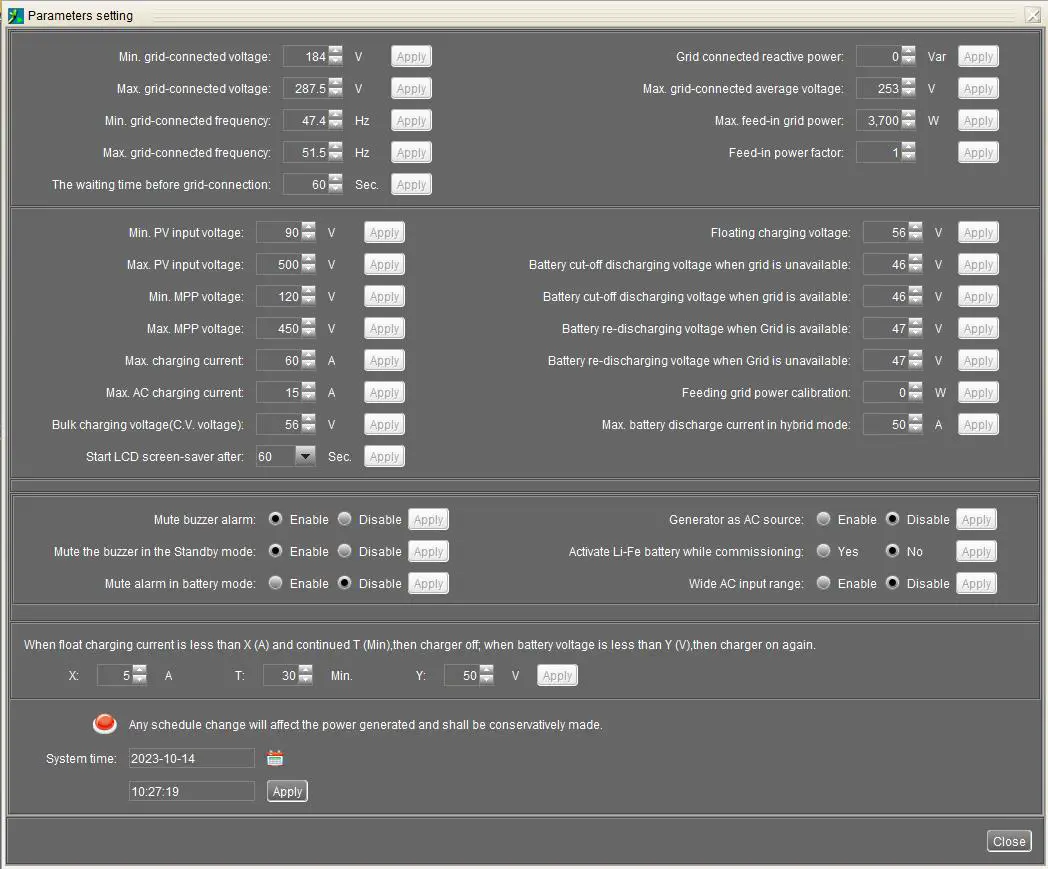
Das war's schon im Großen und Ganzen, mehr braucht man nicht einstellen.
Hier noch als Video, wie man den Wechselrichter samt Batterie für eine Überschusseinspeisung / Null-Watt-Einspeisung konfiguriert:
Inhaltsverzeichnis:
- 29.2 SDM 630 Energy Meter & Überschusseinspeisung einstellen
- 29.3 Ethernet anstatt Modbus
- 29.4 Wechselrichter über Netzwerk steuern & auslesen
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
29.1.2 dreiphasiger Hybrid Wechselrichter einstellen (10kW, 15kW)
Hier zeige ich, wie ich meinen EASun iGrid TT 10k eingestellt habe.
Bezugsquelle: Hybrid Wechselrichter MPI 10k mit 10000 Watt von MPP Solar Infinisolar
Da der 10k ein dreiphasiges Modell ist sind die Einstellungsoptionen weitestgehend deckungsgleich mit dem größeren Modell 15k
Zu den Einstellungen der einphasigen Modelle 2k, 3k, 4k, 5k und 5.5k weiter oben.
Hier nochmal die benötigte Software: Solarpower Software (NICHT Watchpower, die ist für die Offgrid Modelle) zur Steuerung des Wechselrichters
zum Downloaden unter: MPPSolar.com -> Downloads -> Monitoring Software -> SOLARPOWER (HYBRID)
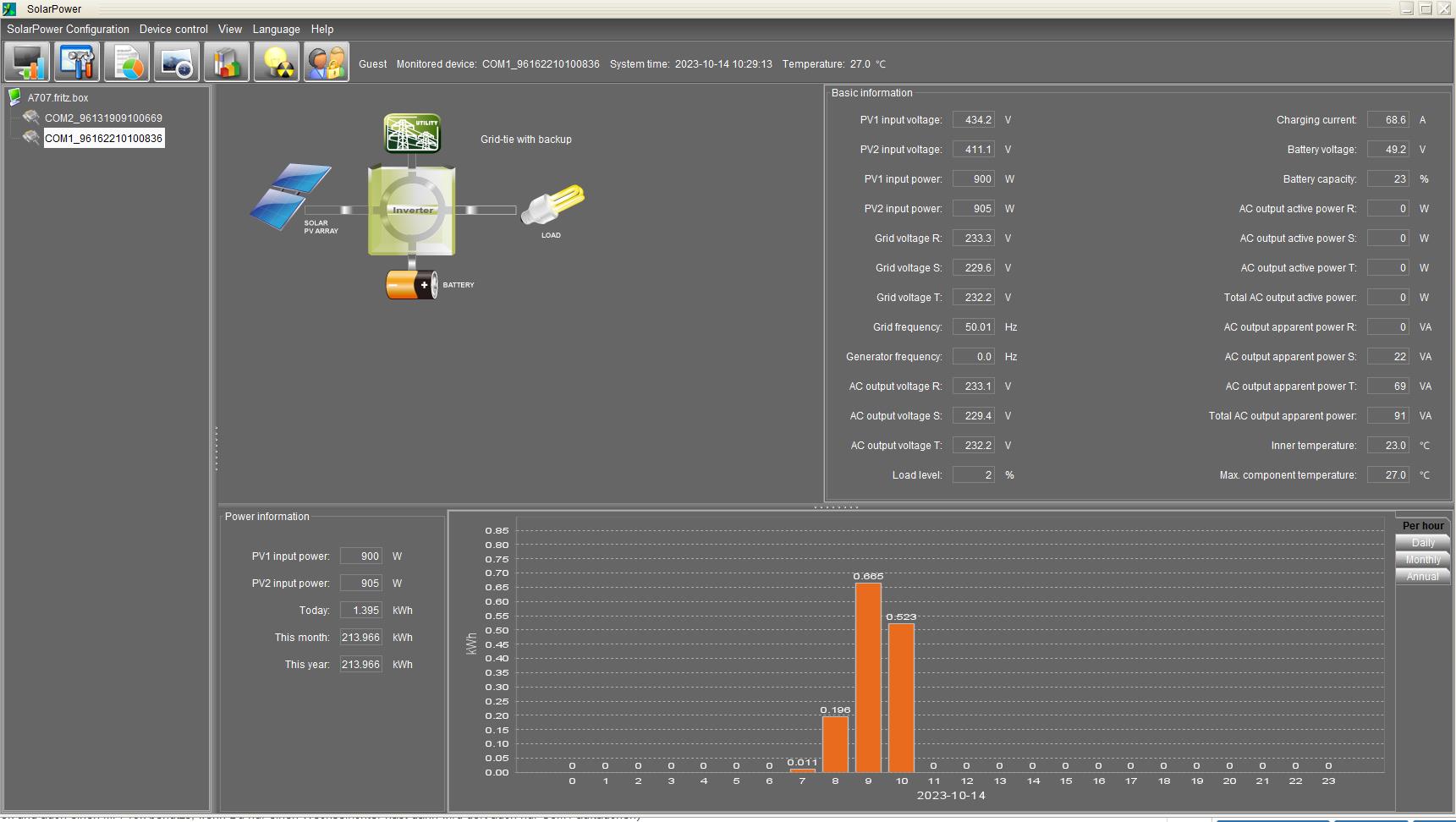
Ich zeige hier nur die notwendigen Einstellungen für den Modus "Überschusseinspeisung".
Das bedeutet:
- der Wechselrichter muss netzparallel angeschlossen sein, also nicht im Inselbetrieb
- es ist ein SDM 630 Energymeter verbaut und angeschlossen
- mit dem PV-Strom wird zuerst der Haushaltsverbrauch abgedeckt, ist dann noch Strom übrig wird damit der Akku geladen, ist kein Akku vorhanden oder ist der Akku voll dann wird der überschüssige Strom ins öffentliche Netz eingespeist
- wenn die Sonne nicht scheint oder nicht stark genug ist dann wird aus dem Akku soviel Strom entnommen, dass der Haushaltsverbrauch abgedeckt ist. Wenn weder die Sonne scheint noch der Akku voll ist dann wird der benötigte Haushaltsstrom ganz normal aus dem öffentlichen Netz bezogen
MyPower Management
In Solarpower unter "Device Control" nun den Menüpunkt "MyPower Management" öffnen und alles so einstellen wie hier auf dem Bild zu sehen.
- Anmerkung1: wenn Du anstelle einer Überschusseinspeisung eine Null-Einspeisung (Null-Watt-Einspeisung) haben möchtest dann nimm den Haken raus bei "Allow to feed-in to the Grid"
- Anmerkung2: bei Verwendung von gebrauchten Akkuzellen oder eines sehr alten Akkus, der sich bei längerer Nichtbenutzung von alleine entlädt macht es Sinn diesen bei Unterschreitung von 45,5V automatisch sporadisch vom Netz etwas nachzuladen. Dazu (und nur dann) den Haken setzen bei "AC to charge battery" sowie die Einstellungen unten links in dem Block unterhalb "This option is ineffective during of AC charging"
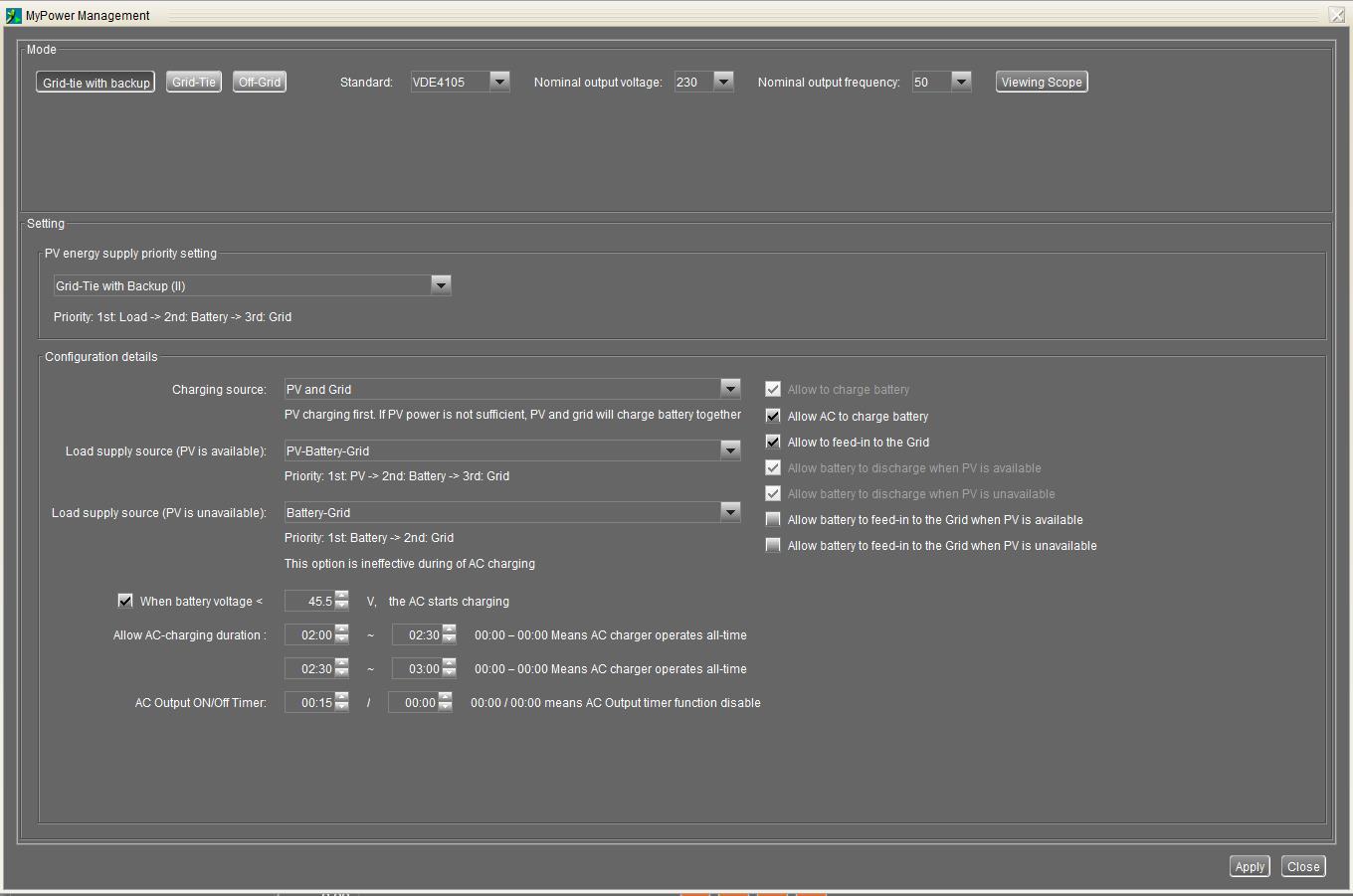
Parameters setting
In Solarpower unter "Device Control" nun den Menüpunkt "Parameters setting" auswählen. Viele der unten gezeigten Einstellungen sind default Werte.
Zu den Spannungswerten die Batterie betreffend ist folgendes zu sagen: diese sind immer anzupassen auf den verwendeten Akku und können daher bei Dir abweichen, je nachdem welches System Du hast. Ich nutze einen 48V Akku bestehend aus gebrauchten 18650er LiIon Zellen in 14S Konfiguration, also 14 Zellen in Reihe. Ich möchte die Zellen schonen betreiben zwischen maximal 4,0V und minimal 3,3V und komme daher auf folgende Gesamtspannungswerte:
- minimale Gesamtspannung: 14x 3,3V = 46,2V
- maximale Gesamtspannung: 14x 4,0V = 56,0V
Das bedeutet, der Akku soll bis 56,0V geladen werden und bis 46,2V entladen werden, dann soll der Wechselrichter aufhören, Strom zu entnehmen. Ich habe 46,0V eingestellt da bei Belastung die Spannung eh etwas einbricht, wenn dann bei 46,0V abgeschaltet wird dann springt die Batteriespannung nochmal etwas nach oben.
Für die EInstellungen bedeutet das:
- Bulk charging voltage sowie auch floating charging voltage beide auf den identischen Wert 56,0V setzen (floating voltage ist bei LiIon und LiFePo4 immer auf denselben Wert zu setzen, lediglich bei Blei-Säurebatterien oder AGM wird die floating Spannung höher gesetzt)
- Battery cut-off discharging voltage auf 46,0V setzen
Hier noch ein paar Besonderheiten in meinen Einstellungen:
- Anmerkung1: ich musste die Werte für "Max. charging current" sowie "max. battery discharge current in hybrid mode" reduzieren von Standard 200A auf 180A da meine verwendeten DC-Sicherungen zwischen Wechselrichter und Batterie nur für 180A Dauerstrom ausgelegt sind.
- Anmerkun2: bei "Feeding grid power calibration" musst Du nur etwas eintragen, wenn Dein Wechselrichter im Batteriemodus nicht exakt auf Null Watt ausregelt (Schwankungen um +/- 25W sind normal, alles was darüber hinausgeht kann man versuchen durch diese Werte einzudämmen)

Parameters setting 2
In Solarpower unter "Device Control" nun den Menüpunkt "Parameters setting 2" auswählen. Viele der unten gezeigten Einstellungen sind default Werte.
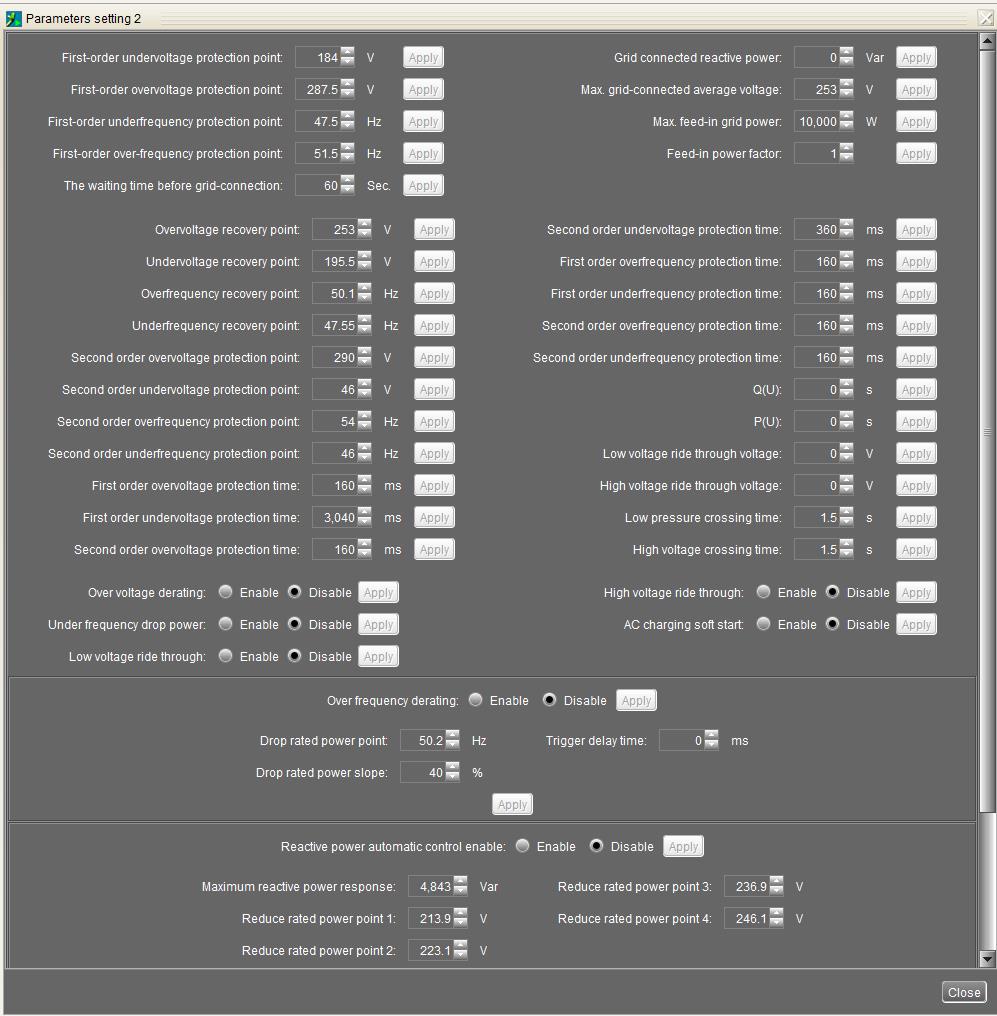
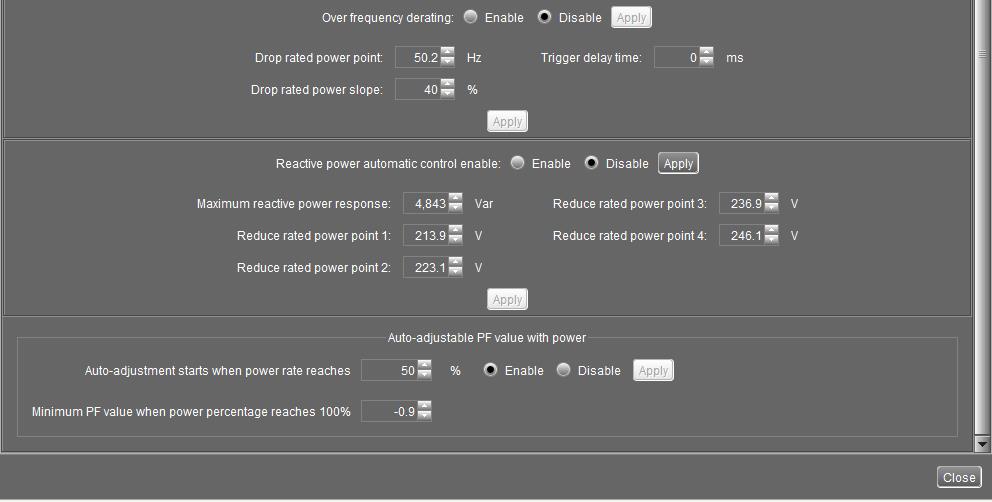
Das war's schon im Großen und Ganzen, mehr braucht man nicht einstellen.
Hier noch als Video, wie man den Wechselrichter samt Batterie für eine Überschusseinspeisung / Null-Watt-Einspeisung konfiguriert:
Inhaltsverzeichnis:
- 29.2 SDM 630 Energy Meter & Überschusseinspeisung einstellen
- 29.3 Ethernet anstatt Modbus
- 29.4 Wechselrichter über Netzwerk steuern & auslesen
|
*Transparenzhinweis: Wir sind Teilnehmer des Werbung-Partnerprogramms u.A. von Amazon, Aliexpress, eBay sowie Manomano und benutzen Affiliate Links in unseren Beiträgen zu Produkten, die wir getestet haben und selbst benutzen. Wenn Du darauf klickst kostet Dich das nichts extra aber wenn dadurch ein Kauf zustande kommt erhalten wir eine kleine Provision. Das hilft uns, die laufenden Serverkosten dieser Webseite zu bezahlen. Danke, für Deine Unterstützung 😀 |
Inhaltsverzeichnis:
- 1 Die Anfänge (Akkulautsprecher)
- 2 Idee + Plan
- 3 Akku-Arbeitsplatz
- 4 eBike Akku Komponenten
- 5 eBike Akku zerlegen
- 6 Laptop Akkus zerlegen
- 7 ATX Computer Netzteil umbauen für Ladegeräte
- 8 neue Hülle für 18650
- 9 China-Akkutest
- 10 Werkzeuge + Messgeräte
- 11 Null-Watt Einspeisung
- 12 Modbus / RS485 Adapter
- 13 BMS + Balancer
- 14 aktiv Balancer BMS - JKBMS
- 15 Ladegeräte + Kapazitätstester
- 16 kpl. Akkupacks testen
- 17 Innenwiderstand Ri
- 18 Solar Laderegler
- 19 Wechselrichter, Inverter
- 20 Löten - Anleitung für Akkus
- 21 Schlüsselanhänger aus 18650
- 22 Sicherheitskonzept
- 23 Akkus Beschaffung - wie und wo?
- 24 WVC / SG / GMI / PVGS Mikroinverter
- 25 Schritt-für-Schritt zur 18650 Powerwall
- 26 ATS - Automatic Transfer Switch
- 27 Schottky Sperrdioden für Parallelschaltung
- 28 Balkonsolar & Balkonkraftwerk
- 29 Hybrid Wechselrichter einrichten